 |

Zugriffszähler seit 4.11.2003
Dieser vom Enkel des Verfassers, Herrn Friedrich Arnold Bösenthal, bereitgestellte Text ist in dem neu überarbeiteten Band 4 der maritimen Zeitzeugenreihe "Seemannsschicksale" erschienen.
Beitrag aus Band 4
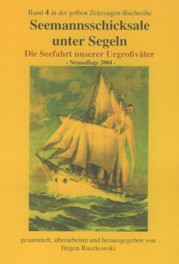
der gelben Buchreihe "Zeitzeugen des Alltags" von Jürgen Ruszkowski
Dieses Buch können Sie direkt bei mir bestellen:
Erinnerungen des Kapitäns Arnold Otte - Arnold Otte
Herkunft und Kindheit
Ich wurde am 24.4.1872 in Bremerhaven geboren. Mein Geburtshaus war in der Deichstraße, gegenüber vom Volksgarten. Mein Vater hieß Jacob Otte, geboren in Ollenermoor bei Berne, Amt Elsfleth im Oldenburgischen, geboren im Jahre 1836. Er hatte zwei Brüder und eine Schwester, mit Namen Friedrich, Niklaus und Sophie. Die beiden Brüder mussten schon in der Schulzeit, von ihrem 9. Jahre an, mit Musik machen auf dem Tanzboden.
Die Schwester Sophie ging schon in ihren jungen Jahren hinüber nach Amerika. Sie kam noch einmal zurück auf Besuch, als sie ihre Eltern und Geschwister als reiche Dame besuchte. Sie hatte es in Amerika mit ihrem ersten Mann zu Wohlstand gebracht. Mein Vater war ihr Liebling, und so versprach sie dann auch demselben, wenn sie dereinst mal sterbe, solle mein Vater oder dessen Kinder ihr Vermögen haben. Jedoch ist dieses bis auf den heutigen Tage, an dem ich diesen Lebenslauf schreibe, nicht eingetroffen. Es gibt zwei Möglichkeiten: Sie hat sich in Amerika noch zum zweiten Mal verheiratet und zwar mit 58 Jahren, vielleicht hat dieser zweite Mann das ganze Vermögen bekommen, oder es ist in den Kriegsjahren von dem Amerikanischen Staat zurückgehalten worden.
Meine Mutter, Rebecka Magarete Otte, geboren am 12.2.1842, ist eine geborene Bolte. Sie kommt ebenfalls von dort her, wo mein Vater herstammt. Ihre Eltern hatten eine Moorbauerei. Sie hatte einen Bruder und drei Schwestern. Der älteste war ihr Bruder, dann kam Anjen, hierauf sie selbst, dann Lina und zuletzt Meta. Ihr Bruder erhielt den Bauernhof, aber durch sein leichtsinniges Leben musste er ihn dann bald seinem Schwiegersohn übergeben.
Anjen, Lina und Meta mussten schwer im Hause mitarbeiten. Es kam mal eine von diesen dreien in Stellung. Was meine Mutter anbetraf, so lernte sie das Nähen im Gewerbe und hatte sich so aus der schweren Arbeit herausgezogen.
Meine Mutter lernte mit ihrem 20. Lebensjahr einen Bäcker kennen. Das Verhältnis wurde immer intimer und auch die Heirat war schon festgesetzt. Durch eine leichtsinnige Stunde sollte sie nun Mutter werden. Durch fortwährendes Prellen des Bäckergesellen gegen seinen Schwiegervater, ihm eine Summe von 17000 Mark auszuhändigen, um ein Geschäft anfangen zu können, kam es soweit, dass mein Großvater ihm, da der Schwiegersohn doch ziemlich leichtsinnig war, die Tür wies. Der Bäcker wurde vollständig beiseite gesetzt und mein Vater, ein Cousin meiner Mutter, heiratete sie unter diesen Verhältnissen.
Im Ehestand mit meinem Vater, als meine Mutter 22 Jahre alt war und mein Vater 28 Jahre, wurde mein ältester Bruder Friedrich Wilhelm am 13.4.1864 in Bremerhaven geboren. Meine Eltern wohnten in Bremerhaven. Mein Vater fuhr beim Norddeutschen Lloyd. Nach Friedrich wurde Hinni geboren, welcher mit seinem 4. Lebensjahr starb. Hierauf wurde ein Zwillingspaar geboren, welche ebenfalls starben. Nach mir wurde Betti geboren, welche in meinem 4. Lebensjahr starb. Als ich vier Jahre alt war, zog meine Mutter mit mir und meinem Bruder Friedrich wieder nach ihrer Heimat in Ollen bei Berne.
Mein Vater fuhr in dieser Zeit als Lampenwärter auf der „HOHENSTAUFEN“. Es war in dem Jahre, als ich zur Schule musste, 1878, als uns unser Vater durch Unglücksfall auf der HOHENSTAUFEN entrissen wurde. Es war am Vormittage, als meine Mutter bei der Gutsbesitzerin nähte, kamen die beiden Töchter von unseren Nachbarn, Adele Holthusen und Johanne Fitern und sagten, meine Mutter möchte sofort zu Hause kommen. Wir wohnten bei Schuster Kückens. Diese Frau sagte mit frechem Ton, dass mein Vater verunglückt sei.
Der Unglücksfall meines Vaters: Wie ich schon erwähnte, war er Lampenwärter. Die Lampenwärter haben allabendlich, wenn es dunkel wird, alle Lampen nachzusehen, ob die auch brennen. Es herrschte die Nacht schwerer Sturm. Die damaligen Dampfer waren nicht so gebaut, wie die neuzeitigen. Das Deck lief von vorn nach hinten glatt durch, sozusagen ohne Aufbauten. Die Schanzen hatten keine feste Reeling, sondern waren mit Drahtmaschen versehen, so das die Sturzsee glatt von der einen Seite nach der anderen schlagen konnte. Als mein Vater nun vorn die Treppe runter wollte, um in sein Logis zu kommen, glitt er aus und fiel ins Unterdeck, wo sein Zimmer war. Er logierte mit dem Bäcker und Proviantsteward zusammen. Seine Kollegen fragten ihn, ob er schwer gefallen sei und wollten ihm helfen. Er lehnte jedoch die Hilfe ab, nahm seine Waschschüssel, um sich hiermit die drei Wunden am Kopf auf Deck abwaschen zu können. Beim Waschen auf der Vorkante von der Kommandobrücke kam eine schwere Sturzsee und riss ihn über Bord. Da der Wachhabende Offizier dies gesehen hatte, ließ er sofort die Maschinen stoppen. Der Dampfer hatte drei Stunden nach ihm gesucht und hierauf, da alles aussichtslos war, die Fahrt fortgesetzt.
Meine Mutter musste nun, um sich selbst und uns beiden durch die Zeit zu bringen, durch Nähen ihren Unterhalt verdienen. Eine Kleinigkeit bekam sie noch durch den Norddeutschen Lloyd aus der damaligen Seemannskasse.
Mein Bruder Friedrich kam das Jahr aus der Schule und als Lehrling nach Elsfleth zu Maler von Linn. Ich ging bis zu meinem 11. Lebensjahr in die Ollener Dorfschule bei Lehrer Niemeier.
Nun zogen wir nach Berne, ein kleiner Flecken, der eine halbe Stunde von Ollen abliegt. Hier kam ich ebenfalls wieder in die Volksschule, doch mit dem Unterschied, dass hier zwei Klassen waren. Mit meinem dreizehnten Lebensjahr zogen wir von Berne nach Burgdamm bei Burglesum im Hannoverschen. Dieses Verziehen vom Oldenburgischen nach dem Hannoverschen kam von der zweiten Ehe, welche meine Mutter mit einem Zigarrenmacher Karl Dänzer einging. Aus dieser zweiten Ehe sprossen noch 2 Kinder, Lina Dänzer, geboren am 31.10.1885, und Karl Bernhard Dänzer, geb. 31.8.1887. Ich kam mit meinem 13. Lebensjahr in Burgdamm in eine vierklassige Schule. Den Konfirmandenunterricht erhielt ich in Burglesum und wurde auch dort konfirmiert.
Erste Seereise als Schiffsjunge nach Amerika
Da mein Vater zur See gefahren war, so war es auch mein Wunsch, diesen Beruf zu wählen. Meine Gedanken schritten vorwärts, und so dachte ich auch einmal Kapitän zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, musste man erst auf Segelschiffen fahren. Um die Zeit war es schwer, ein Segelschiff zu bekommen, und so war mein Stiefvater schon verschiedene Male mit mir nach Vegesack gewesen, zu den beiden Heuerbaasen Deist und Schipphorst.
Eines guten Tages ließ uns der Heuerbaas Schipphorst kommen, um mich beim Kapitän und Reeder vorzustellen. Der Reeder meinte zum Kapitän: „Der ist man ’n bisschen klein“. Der Kapitän sagte: „Litschet und kregel, is beter als grot und ’nen Flegel“. Ich wurde also angenommen. Mein Stiefvater drückte dem Heuerbaas ein Zwanzigmarkstück in Gold in die Hand und der Handel war geschlossen. Wir wurden per Bahn mit Sack und Pack nach Hamburg geschickt und hier lag die Bark „Port Royal“. Für mich war die Reise und dann die Ansicht vom Schiff eine Herrlichkeit, jedoch es sollte bald anders kommen.
Die Besatzung der “PORT ROYAL“ bestand aus dem Kapitän, zwei Steuerleuten, einem Segelmacher, dem Zimmermann, einem Koch, acht Matrosen, einem Leichtmatrosen und zwei Jungens. Mein Kollege, der andere Junge, welcher noch einen Kopf größer war als ich, kam in die Kajüte als Steward. Im Logis waren die 8 Matrosen, der Leichtmatrose und ich. Also war ich Steward für die 8 Matrosen.
Meine Meinungen über die Seefahrt waren aber zuerst noch naiv. Ich dachte mir, es würde an Bord auch aufgetischt wie bei Muttern zu Hause und dass ich arbeiten müsste, hatte ich auch nicht bedacht. Ich meinte, die Masten wären zum Klettern aus Vergnügen da, wie zu Hause die Bäume. Den ersten Nachmittag ließen mich die Matrosen auch so halb zufrieden. Jedoch vom anderen Tag an lernte ich schon die Schiffsmettwurst kennen. Den zweiten Tag ging die Reise bereits in See, unser Ziel war New Orleans.
Mein erstes Abenteuer, das ich erlebte, waren die umgefallenen Zwiebeln in der Kajüte. Wir hatten sehr schlechtes Wetter, so dass das Schiff stark schlingerte. In der Kajüte stand ein Korb mit Zwiebeln. Dieser war beim starken Schlängeln umgefallen und die Zwiebeln rollten in der Kajüte hin und her. Ich war im allgemeinen noch nicht seefest. An Deck, in der frischen Luft, wusste ich wenig davon, aber im Zimmer stand es mir bis zum Halse. Auf der Wache von 8-12 sagte der 2. Steuermann zu mir: „Geh’ mal hin und such in der Kajüte die Zwiebeln auf.“ Im Laufschritt stürmte ich die Kajüte, um meine Arbeit schnell zu verrichten. Aber, o weh, mit einem Mal kam es bei mir hoch und hinein ging die ganze Soße in den Zwiebelkorb. Meine Gedanken waren nun, ich wollte die guten Zwiebeln dazwischen heraussuchen, aber da kam der Steuermann. Bei meiner schweren Krankheit bekam ich noch eine Tracht Prügel zu, aber in der Lust am Seemannsabenteuer vergisst man alles wieder schnell.
So ging die Reise weiter, das zweite Abenteuer hatte ich wieder nachts auf der Wache, und zwar von 8-12 (meine Reiseschilderung geht von Hamburg nach New Orleans). Es war im Golf von Mexiko, als um 11 ½ Uhr der Steuermann rief: „Pump Schipp“. Da wir in der heißen Zone waren, war es nachts auch sehr warm, so dass sich diejenigen Matrosen, welche keinen Dienst am Ruder und Ausguck hatten, sich auf die Luke legten und schliefen. Ich sollte nun aufpassen, wenn irgend ein Befehl vom Steuermann gegeben wurde, das sie diesen dann ausführten, also musste ich sie dann wecken. Ich dachte nun in meinen Sinn, du legst dich auf die Reserverah hin und wenn du dann einschläfst, fällst du von selbst herunter. Da hat aber eine Eule gesessen, die Sache kam ganz anders. Wie ich schon erwähnte, rief der Steuermann: „Pump Schipp“. Von der ganzen Wache an Deck hörte keiner was, auch ich nicht. Jetzt kam der Steuermann und weckte die Matrosen, welche auf die Luke lagen. Der einzige, der nun kein „Pump Schipp“ mitmachte, war ich, denn mich hatten sie wohlweislich liegen lassen. Als „Pump Schipp“ nun beendet war, sagte der 2. Steuermann „gaat mal henn und halt mal ‘n Brunteerpott unt Kwast. Dies wurde auch ja schnell gemacht und mir wurde dann das ganze Gesicht mit Teer eingeschmiert, so dass ich nach Ablösung der Wache noch mindestens zwei Stunden zutun hatte, um den Mist wieder vom Gesicht zu kriegen. Dieser Scherz hätte aber für den Steuermann verhängnisvoll werden können, denn anstatt Braunteer hatten sie in der Dunkelheit Kohlenteer gekriegt. Da es nun ganz unmenschlich heiß war bei Tage und die Sonne stark brannte, blätterte mir das ganze Fell vom Gesicht. Der Kapitän fragte mich: „Was ist mir dir denn los?“ Ich log ihm natürlich was vor und sagte, mir wäre beim Arbeiten Kohle ins Gesicht geflogen. Hätte ich ihm die Wahrheit gesagt, dann hätten sie nachher alle auf mich herum gehackt, also ich suchte das bessere Übel. So hatte ich nun auf der Ausreise schwere Tage, aber wenn alles meist gut gelaunt war, auch mal gute.
Unser Kapitän Putscher hielt viel vom Fischfang. Eines Tages, es war Totenstille und wir lagen still im Wasser, kamen drei Walfische auf Seite, der Kapitän sagte zum 1. Steuermann: „Soll ich den Walfisch mal eine Harpune in den Rücken werfen?“ So warfen der Kapitän und auch der Steuermann, beide zugleich, dem Tier die beiden Harpunen in den breiten Rücken. Die Tauenden dieser Harpunen waren mehr als einen Daumen dick. Als das Tier den Schmerz fühlte, tauchte es nach unten und die beiden Tauen zerrissen wie Zwirnfäden. Die zwei Harpunen nahm er mit in die Tiefe, und so haben wir uns gedacht, er würde wohl nach einer bestimmten Zeit verenden. Diese Angelegenheit war für mich ja damals eine große Sehenswürdigkeit. An dem Fischfang hatte ich immer große Freude.
Die Ausreise war für uns dann ja zu Ende, denn wir liefen zwei Tage darauf in den Mississippi ein. Wir machten alle Segel fest und ein Schlepper nahm uns in Tau. Da der Tag schon beinahe zu Ende war, gingen wir vor Anker, ebenso der Schlepper. Die Nacht, in der wir vor Anker lagen, habe ich kein Auge zu gehabt. Erstenmal die große Hitze und dann noch die Moskitos. Die Moskitos sind so ungefähr mit den Mücken zu vergleichen, welche wir im Sommer bei uns haben. Jedoch sind sie größer und stechen noch viel schlimmer und dringen in jede Kammer ein, auch wenn sie dunkel ist und stechen ruhig weiter.
Den anderen Tag wurden wir den Mississippi rauf geschleppt. Auf beiden Seiten des Ufers waren große Tabakplantagen und Felder mit Südfrüchten. Am Nachmittag kamen wir in den Hafen von New Orleans. Hier bot sich mir ein Bild voller Staunen. Schwarze Menschen hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen und dann die Sprache. Ich dachte damals so in meinem Sinn, hier sind die Menschen ja wohl alle verrückt. Die Sprache war dort englisch und so konnte ich auch schnell yes und no sagen. Überhaupt lernte ich schnell, mich dort halbwegs mit den Eingeborenen zu verständigen. Den ersten Sonnabend, wo jeder einen kleinen Vorschuss bekam, nahmen mich die Matrosen mit an Land. Hier wurde ich von den Schwarzen freundlich aufgenommen, sie amüsierten sich an meiner Schüchternheit, denn ich hatte tatsächlich Angst, dass sie mich auffressen.
Unsere Ladung, die wir dort einnahmen, war Tabak. Dieser kam in großen Holzfässern an Bord und wurde mit großen Daumschrauben in die Räume eingepresst. Die Neger arbeiteten dabei fast nackend, denn wir hatten dort eine Hitze, die viele hier in unserem Klima nicht vertragen könnten.
So kam es dann auch, dass wir beiden Jungens eines Tages bald unser Leben verloren hätten. Im Fluss Mississippi kann nicht gebadet werden, derweil dort sehr viele Alligatoren sind. Wir beide wussten davon nichts, zogen uns aus und da wir beide gut schwimmen konnten, sprangen wir über Bord und schwammen am Schiff längs. Dieses sahen die Neger und machten dann einen heillosen Radau. Uns wurde schnell eine Seeleiter heruntergeworfen, und als ich als letzter die dritte Stufe von der Leiter hoch war, steckte ein Ungeheuer seinen großen Rachen aus dem Wasser, um nach mir zu schnappen. Wenn ich jemals einen Schreck bekommen habe, dann war es diesmal. Als ich an Deck war, konnte ich gar nicht wieder zu mir selbst kommen. Diese Alligatoren sind Tiere von 8 bis 12 Meter Länge, einen Rachen haben sie, da kann man wohl einen Handwagen reinschieben. Dieses Erlebnis war mir ein Lehrgeld. In der Unbedachtsamkeit der Jugend tut man vieles ohne Erlaubnis. Auch auf einer anderen Reise ging es mir noch mal so, worüber ich später noch schreiben werde.
Nach einer Liegezeit von vier Wochen verließen wir dann den Hafen von New Orleans, um unsere Ladung nach Bremerhaven zu bringen. Auf der Rückreise wurde ich nicht mehr seekrank. In meinen Gedanken stellte ich mich schon als ein Fürst vor, wenn die Reise beendet sein würde und ich mit all meinem Geld die Heimat würde begrüßen können. Im allgemeinen waren die Matrosen, ebenso der Steuermann während der Rückreise, welche zwei Monate dauerte, viel humaner gegen mich, als auf der Ausreise. Nach einem Zeitraum von fünf Monaten und sechs Tagen trafen wir mit unserer Bark „Port Royal“ wieder in Bremerhaven ein.
Den anderen Tag wurde abgemustert, alle gaben mir die Hand und ich reiste sofort ab nach Burgdamm. Die große Freude, nun meine Mutter wieder begrüßen zu können, ging an diesem Tag nicht in Erfüllung. Meine Eltern waren in der Zeit, als ich weggewesen war, von Burgdamm wieder nach Berne gezogen. Den anderen Tag traf ich dann in meiner lieben alten Heimat ein. Etwas über 60 Mark hatte ich ausbezahlt bekommen. Ich kaufte mir jetzt einen großen schlappen Seemannshut und spielte den großen Seemann. Alles in Allem war es bei Mutter besser als auf See, auf jeden Fall hatte ich die Nase voll von Segelschiffen, denn die Schiffsmaatwäsche hatte ich noch nicht vergessen. So blieb ich dann vom 3. Oktober 1886, als wir abgemustert hatten, bis zum 2. Januar 1887 zu Hause. Innerlich war mir so zu Mute, dass ich am liebsten gar nicht wieder weggegangen wäre.
Auf Dampfern beim Norddeutschen Lloyd
Aber ein „Mann ein Wort“, ich ließ mich nicht verdrießen und reiste nach Bremerhaven. Hier hatte ich einen Onkel zu wohnen, dieser besorgte mir eine Stelle auf dem Lloyddampfer „GENERAL WERDER“. Ich wurde auf zwei Jahre als Junge angemustert und bekam 18 Mark Gage. Für mich war dies schon eine gute Heuererhöhung, denn ich war doch erst 14 Jahre, das machte meine Segelschifffahrt. Aber wie war hier der Unterschied groß, zwischen einem Passagierdampfer und Segelschiff. Den zweiten Tag mußte ich mir schon eine Uniform holen: Ein blauwollenes Hemd, eine blaue Hose, eine blaue Mütze, darauf stand der Name in Messingbuchstaben „Norddeutscher Lloyd“, und ein seidenes Tuch. Zwei weiße Streifen waren auf den Kragen vom blauen Hemd genäht. Die Jungensuniform kostete 12 M. Die der Matrosen kosteten 18 M. Die erste Uniform musste bezahlt werden, und dann gab es alle vier Monate eine umsonst. In dieser Uniform fühlte ich mich so recht stolz und war bei meinen Vorgesetzen auch beliebt.
Am 12. Januar 1887 ging die Reise nach Ostindien. Als Plätze liefen wir nach der Ausreise Antwerpen und Genua an und nach einer Reisedauer von 17 Tagen in den Suezkanal ein. Hier bot sich mir wieder ein erstaunliches Bild. Im Anfang des Kanals wurden Kohlen genommen. Die arabischen Arbeiter, wohl 200 an der Zahl, brachten dieselben alle mit kleinen Körben in die Bunker. Jeder Korb, vielleicht mit 20 Kohlen darin, trug man auf dem Kopf. Dann riefen sie immer Allah, Allah, das heißt Gott. Obwohl diese schwarzen Araber stets im Laufschritt ihre Kohlen heranschafften, bekamen sie obendrein noch Peitschenhiebe. Alles dies war für mich ja ein schauerliches Bild. Diese Kohlenübernahme wurde nachts verrichtet, und am anderen Morgen ging die Reise wieder weiter.
Der Kanal geht streckenweise durch die Wüste, dann durch den Bittersee. An dem Kanal entlang sieht man die Karawanen ziehen. Die Kamele haben einen Kasten auf dem Rücken und hierin sitzt die ganze Familie. So zeigten sich vom Kanal aus noch viele schöne Bilder, die für mich etwas Erstaunliches waren.
Die Reise ging dann weiter an der Insel Ceylon entlang, so dass wir zuerst Singapur wieder anliefen, um Kohlen zu nehmen. Hier lagen wir einen Tag, den wir auch ausnutzten, um uns die Stadt zu besehen. Die Eingeborenen, wegen der furchtbaren Hitze, Chinesen im Adamskostüm. In den Palmen und Kokosbäumen hielten sich Affen, Papageien, Kakadus und sonstige wilde Tiere auf. Dies alles war für mich eine seltene Schönheit.
Von Singapur hatten wir noch 8 Tage zu dampfen, und dann trafen wir in Hongkong ein. Nun sollte erst unsere richtige Küstenreise anfangen, und zwar von Hongkong nach Yokohama, weiter nach Kobe, nach Nagasaki und zurück nach Hongkong. Yokohama, Kobe und Nagasaki waren japanische Seestädte. Wir machten in jedem Monat eine Rundreise mit zwölf Liegetagen in Hongkong. Ich hatte mich mit der Zeit schon so recht mit den Chinesen und Japaner eingelebt, so dass ich mich mit ihnen so ziemlich verständigen konnte.
Wenn der Monat zu Ende war, bekamen wir in Hongkong unser Geld. Da ich nun Assistentenjunge war, bekam ich auch allerhand Trinkgeld. Ich hatte fünf Mann zu bedienen, die gaben mir jeden Monat einen Dollar á Mann. In Japan kaufte ich Handstöcker und die wurden in Hongkong wieder an die deutschen Mannschaften, welche auf den Dampfern fuhren, die wieder nach Deutschland zurück gingen, verkauft. Da ich das Doppelte wieder bekam, so war auch dies ein schöner Verdienst. Da ich nun im allgemeinen sparsam war, legte ich mir ein Sparkassenbuch auf einer englischen Bank an.
In Hongkong bestieg ich an einem Sonntag den Peak, das war ein hoher Berg. Als ich wieder unten war, steckten mir die Zehen durch die Schuhe, dieses kam nämlich von dem ewigen Bergablaufen. Im allgemein war in Hongkong alles sehr billig. Die Eier kosteten das ganze Dutzend 20 Pfennig, ein Dutzend Apfelsinen, aber ganz süße mit dünner Schale 10 Pfennig, eine schöne große Ananas 10 Pfg. Die Bananen konnte man ungefähr umsonst bekommen.
Ich hatte einen befreundeten Chinesen, da ging ich oft hin zu Besuch. Ich zog dann meine Uniform an, und da ich doch erst 15 Jahre war, sah ich drollig aus, so dass er seine Freude an mir hatte. Ich aß mich in seinem Garten satt an allen seinen Südfrüchten.
In den drei japanischen Städten war ich auch mit einigen Japanern sehr befreundet, so dass ich wie ihr Kind in den Familien verkehren konnte. So hatte ich denn ungefähr ein Jahr an der Küste verbracht, als ich auf einmal das Heimweh bekam. Mir war auf einmal alles zuwider.
Eines Tages ging ich zum 1. Offizier, dessen Name war von Rabaskin, und bat ihn, mich doch ablösen zu lassen, damit ich wieder nach Deutschland käme. Dieser Bitte kam unser 1. Offizier aber sehr ungern nach, denn er wollte mich gerne behalten, weil er so viel von mir hielt.
Wegen dieser Angelegenheit muss ich einige Monate zurückgreifen: Als wir 5 Monate draußen waren, entstand ein großen Streit zwischen Kapitän und Mannschaft, und dies kam wegen des Essens. Die Matrosen und Heizer waren verschiedene Male mir dem Essen beim Kapitän gewesen und hatten sich beschwert. Der Kapitän jedoch machte kurzen Prozess und schickte fast die ganze Mannschaft nach Deutschland. Die Unteroffiziere, ein Leichtmatrose von Rodenkirchen und ich mussten bleiben. Der andere Junge von Lehe musste auch mit weg. Was nun den 1. Offizier betraf, so war er früher Offizier bei der Marine gewesen und so war er immer noch für alles Militärische begeistert. Bei den Matrosen konnte er das nicht machen, aber uns Jungen ließ er jeden Morgen, wenn er Wache auf der Bücke hatte, um 5 Uhr in sauberer Uniform und rein gewaschen zur Meldung antreten. Wir hatten dann militärische Haltung anzunehmen, wobei er uns dann scharf musterte. Unser Kollege aus Lehe, der wusch sich nur das Gesicht, so dass der Hals immer einen schwarzen Kranz zeigte. Seine Ohre waren auch nie rein. An mir hatte er eine außerordentliche Freude, denn ich war sehr freundlich und gehorsam zu ihm, und das war was für unseren 1. Offizier. Wenn er dann sage: „Ihr könnt wegtreten“, dann sagte er zu mir: „Geh mal in meine Kammer, da steht ein Teller voll Nüsse und Weintrauben, die kannst du alle nehmen.“ Zu dem Leher Jungen sagte er, du gehst zum Bootsmann und scheuerst zur Strafe eine Stunde die Reeling mit Sand und Lappen.
Wie ich schon erwähnte, wurden unsere Matrosen und Heizer, ebenso der Leher Junge nach Deutschland geschickt und als Ersatz bekamen wir alle schwarzen Kanacker aus Hongkong. Mit diesen Leuten auf einem Schiff zu sein, machte mir keine Freude mehr, und so bekam ich, wie ich schon erwähnte, das Heimweh.
Im achten Monat ging ich zum 1. Offizier und bat ihn, mich doch ablösen zu lassen. Er aber wusste soviel Ausreden, indem er meinte: „Du hast es hier doch so gut, mein Junge, halte doch so lange hier an der Küste aus, bis die 2 Jahre um sind (denn auf 2 Jahre hatten wir uns verpflichtet). Dann fahre ich ja auch mit zurück, und aus dir soll noch was Großes werden. Alles werde ich für dich bezahlen.“ Jedoch ich war jung und hatte damals noch keinen Verstand, und das Heimweh ist doch eine schlimme Krankheit. So bat ich ihn dann jede Reise, mich doch ablösen zu lassen, jedoch ohne Erfolg. Nun sann ich, da ich doch durchaus keine Lust mehr hatte, auf Selbsthilfe.
Die anderen Lloyddampfer hatten immer die Fahrtroute von Bremerhaven über Hongkong nach Schanghai und wieder zurück nach Bremerhaven. Mit diesen Dampfern trafen wir uns jeden Monat in Hongkong. Es war eine lange Pier. Auf der einen Seite lag der Dampfer, welcher von Bremerhaven ankam, und auf der anderen Seite lagen wir mit unserem „GENERAL WERDER“. Nun hatte ich meinen Assistenten mein Leid schon vorgetragen und ihnen erzählt, ich wolle abhauen, um mit dem anderen Dampfer nach Hause zu fahren. Die Assistenten sahen meine Krankheit ein und waren auch ganz schweigsam. Der Dampfer „Preussen“ sollte denselben Tag um 3 Uhr nachmittags abfahren. Somit ging ich nachts hinüber und brachte mein ganzes Zeug rüber und gab es dem zweiten Bäcker in Verwahrung.
Aber den anderen Morgen kam die Sache ganz anders. Der „GENERAL WERDER“ sollte ins Trockendock und das hatte ich nicht gewusst. Wir dampften nun morgens um 6 Uhr von Hongkong weg und legten das Schiff dann in das Dock.
Die Stadt Hongkong auf liegt auf einer Insel. Das Dock lag nun ein ganzes Ende abseits von der Stadt. Es war so cirka 10 Uhr vormittags, als ich noch zum letzten Mal meine Assistenten zu Rate zog. Ich musste ja unbedingt von Bord, denn mein ganzes Zeug war ja auf dem Dampfer „Preussen“. Die Assistenten wollten mich eigentlich nicht laufen lassen, immer wollten sie mich noch zurückhalten und meinten: „Du findest nicht wieder nach Hongkong hin. Denn du musst durch die Berge und die Chinesen sind nicht sauber. Aber ich weinte bitterlich und sagte, ich kann es hier, weit von der Heimat, nicht mehr aushalten. Ich komme entweder lebendig zu Hause oder sterbe hier. Als sie nun sahen, dass nichts mit mir anzufangen war, gaben sie mir alle fünf die Hand, jeder gab mir noch einen Dollar, und ich verschwand stillschweigend vom „GENERAL WERDER“.
Wie ich schon erwähnte, sollte der Dampfer „Preussen“ um 3 Uhr nachmittags abfahren nach Deutschland. Ich hatte nur einen Zeitraum von ungefähr 4 ½ Std. zur Verfügung. In meiner vollen Unkenntnis lief ich in die Berge hinein und traf zum Glück zwei Chinesen, welche des Weges kamen, mit ihren Eimern und Bambusstock über den Rücken. Ich konnte seinerzeit schon ziemlich gut englisch sprechen. Aber das verstanden die beiden Onkels nicht. Auch einige Wörter chinesisch konnte ich schon. Auf jeden Fall verstanden sie das Wort Hongkong. Ich zeigte mit den Fingern den Weg und fragte: „Hongkong?“ Sie zeigten mir die Straße und ich lief in vollem Lauftempo weiter. Als ich eine Stunde gelaufen war, stand ich wieder vor einer Kreuzung. Nun wurde mir bange. Keine Seele zu sehen, eine Uhr hatte ich nicht bei mir. Zurück finden konnte ich nicht wieder und Essen hatte ich überhaupt nicht bei mir. So stand ich nun einsam zwischen den Wäldern und Bergen und malte mir schon den Hungertod aus.
Aber „Gott verlässt einen Deutschen nicht“, so hieß schon früher das Grußwort, als ich irgendwo chinesische Stimmen hörte. An einen Überfall dachte ich überhaupt nicht, denn mein Heimweh drückte alles andere zu Boden. Ich lief nun natürlich gleich auf die Chinesen zu, es waren 4 Mann, und fing dieselbe Zeremonie an. Sie zeigten mir den richtigen Weg, nun wollte ich auch noch gerne wissen, wie lange ich wohl noch zu laufen hätte bis zur Stadt Hongkong. Ich hatte nun keine Uhr und die Chinesen noch lange nicht, und die kannten auch keine Uhr. So fing ich mit den Fingern an und machte halb und voll. Sie deuteten mir nun an, dass dieser Weg immer geradeaus nach Hongkong führe. Dann zeigten sie zwei Finger und noch einen viertel Finger. Hieraus schloss ich, dass ich noch 2 ½ Std. zu gehen hatte. Ich dachte nun aber, wenn du tüchtig läufst, wird es wohl in 1 ½ Std. zu machen sein. Und so kam es auch. Mein Heimweh machte mich nicht müde. Ich dachte immer, wenn du bloß erst glücklich an Bord kommst.
Als ich nun eine Zeitlang gelaufen und zeitweise gegangen war, spalteten sich die Berge und die ersehnte Stadt Hongkong lag vor meinen Augen. Punkt 1 Uhr nachmittags stand ich vor der englischen Bank, wo ich meine 30 Dollar, gleich 95 Mark, auf dem Sparbuch hatte. Ich zeigte mein Buch vor und bekam mein Geld auch ausbezahlt.
Nun war bis jetzt ja alles glücklich verlaufen. Ich hatte nur noch 2 Stunden zu vergeben und Eile tat not. Ich sprang schnell in eine chinesische Dschunke und ließ mich übersetzen nach der anderen Seite, wo der Dampfer lag. Als ich nun in die Nähe des Dampfers kam, musste ich mich vorsichtig verhalten, um ungesehen an Bord zu kommen. Wäre ich nun über den Steg gegangen, dann hätten sie mich ja gleich gefasst, denn ich war ja in Uniform. In Zivil durfte ich ja nicht gehen, denn sonst wäre ich ja nicht von der „General Werder“ heruntergekommen. Seinerzeit waren auf der Preußenklasse große Pforten angebracht, wo die Landfesten durchgingen unter die Back. Hier sah ich nun meine einzige Rettung an Bord zu kommen. Es musste kurze Zeit vor dem Abfahren sein, denn es wurden schon auf dem Achterdeck einige Reservetauen eingeholt. Ich stand während diesem Moment hinter einem Eisenbahnwagen. Verschiedene Personen an Land sahen, dass ich etwas vorhatte. Ich spuckte fest in die Hände und los ging die Sache: Ein Stahldraht wurde erklommen, die Augen wurden so lange zugemacht und hinauf ging es wie eine Katze. Als ich merkte, dass ich ungefähr oben war, machte ich die Augen wieder auf, und mit einem tüchtigen Ruck war ich über die Back. Einige von den Matrosen und Unteroffizieren sahen diesen Fall. Ich erzählte in einem Schnelltempo meine Angelegenheit und alle meinten: „Verstecke dich man so schnell du kannst, so dass dich keiner finden kann. Denn der Dampfer fährt in zehn Minuten ab.“ Wenn mich nun auch noch einer verraten hätte, der Dampfer wäre trotzdem doch abgefahren.
Ich hatte auch gleich einen guten Freund und das war der Logisjunge von der Steuerbordwache. Ich verkroch mich nun vorläufig in das Steuerbord-Matrosenlogis, und der Logisjunge spitzelte an Deck so lange, bis der Dampfer abgefahren war. Ich atmete schon etwas glücklicher auf, als der Dampfer die Taue losgeworden hatte und abdampfte. Nun gaben mir die Matrosen den Rat, mich nicht eher beim ersten Offizier zu melden, bis der Lotse von Bord sei, denn sonst hätten sie mich vielleicht noch mit dem Lotsendampfer wieder zurückgeschickt.
Als nun der Lotse längst von Bord und es bereits dunkel war, entschloss ich mich, mich bekannt zu geben. Auf der Wache von 8-12 aber hatte der 1. Offizier Dienst. Meine Angst war grenzenlos, aber ich dachte immer: „Über Bord schmeißen können sie dich ja nicht. Nach Deutschland kommst du auf jeden Fall hin und wenn du vielleicht 14 Tage abbrummen musst, dann ist es auch noch so gut.“ Also, ich festen Schrittes auf die Brücke und stellte mich vor dem 1. Offizier hin. Der sagte zu mir: „Was bist du denn für einer, wo kommst du denn her?“ und so weiter. Ich erzählte ihm nun mit Tränen in den Augen meine ganze Angelegenheit. Als ich ihm nun auch berichtete, dass ich schon eine Segelschiffsreise gemacht hatte, wurde er ganz freundlich und meinte: „Wenn du jetzt nach Bremerhaven kommst, dann meldest du dich schön beim Seemannsamt. Ich will dafür sorgen, dass dir nichts passiert und du keine Strafe bekommst. Nun gehe man nach vorn hin und dann kannst du auf der Heimreise Unteroffiziersjunge sein. Ich werde dafür sorgen, dass du auch bezahlt bekommst.“ Ich ging nun voller Freude wieder von der Brücke herunter und meldete mich den andern Morgen beim ersten Bootsmann, und so kam ich dann zu den Unteroffizieren.
Der Dampfer „Preußen“ wurde, wie die Schwesternschiffe „Bayern“ und „Sachsen“ mit je 4.580 BRT beim Stettiner Vulkan für den Reichspostdampferdienst gebaut und 1886/87 an den NDL abgeliefert.
Ich war auf der Heimreise bei denen beliebt und so liefen die Wochen auch schnell hin, so dass wir Ende Januar 1888 wieder in Bremerhaven eintrafen. Ich meldete mich sofort auf dem Seemannsamt, bekam mein Geld, was ich auf der Heimreise verdient hatte. Nur mein Seefahrtsbuch konnte ich nicht wiederbekommen, denn das war ja noch auf der „General Werder“.
Drei Tage danach musterte ich schon wieder auf dem damaligen Schnelldampfer „Saale“ an. Die „Saale“ war ein Lloyddampfer mit 4 Masten und 2 Schornsteinen. Die beiden ersten Masten waren mit Rahen versehen. Als ich an Bord kam, erhielt ich gleich den schönen Posten als erster Promenadendecksjunge. Dieser Posten war für zwei Jungens aufgeteilt, der eine für die Steuerbordwache, der andere für die Backbordwache, so dass immer stets einer vorhanden war. Unsere Arbeit bestand darin, das Deck zu fegen, Stühle zusammenzusetzen, im großen Ganzen den Passagieren behilflich zu sein und diesen vor allen Dingen freundlich entgegen zu kommen. Dieser Posten machte mir viel Freude, und ich erhielt auch manchen Dollar Trinkgeld.
Aber wie das Schicksal eben wollte, eines Abends auf der Wechselwache von 8-12 Uhr kam ich in Streit mit dem backbordschen Promenadendecksjungen. Ich hatte ihn um 12 Uhr abzulösen und fand noch verschiedene Stühle an Deck, die nicht weggesetzt worden waren. Da nun nachts keine Stühle auf Deck stehen durften, hätte ich demnach seine Arbeit machen müssen. Ich stellte ihn deswegen zur Rede. Er wurde gleich unmenschlich grob und wir beide kamen direkt vor der Kommandobrücke in eine Schlägerei. Ich traf ihn bei der Balgerei mit der Faust auf die Nase und das ganze Blut spritzte an die weiße Wand. In dem selben Moment kam der Kapitän von der Kommandobrücke und wollte nach hinten gehen. Mein Gegner schrie auch noch und hielt sich die Nase fest. Der Kapitän sagte weiter nichts, ging die Brücke wieder rauf und meldete es dem ersten Offizier. Der Kapitän ging nach hinten, der erste Offizier sah den armen Bengel dort jammern und pfiff den ersten Bootsmann. Ich erzählte den ganzen Hergang nun richtig, aber der arme Bengel wurde bejammert und ich kriegte die Schuld und wurde den anderen Tag auf das zweite Kajütendeck degradiert. Auf diesem Deck war ja nun nichts zu verdienen, und so musterte ich dann nach einer Dienstzeit von vier Monaten ab.
Unter Segeln auf der Bark „FÜRST BISMARCK“ um Kap Hoorn
Jetzt hatte ich die Nase voll von der Dampferfahrerei und entschloss mich, wieder auf Segelschiffen zu fahren. Im Juli 1888 musterte ich dann als Leichtmatrose auf einer eisernen Bark „FÜRST BISMARCK“ nach Jyuigua Westküste von Südmerika, um eine Ladung Salpeter zu holen. Auf der Hinreise hatten wir Steinkohle als Ladung. Die Reise verlief im allgemeinen bis Kap Hoorn sehr gut. Als nun der Kurs geändert werden sollte auf West, mit einem Abstand von zirka 30 Seemeilen von Kap Hoorn, trat auf einmal ein Weststurm ein. Wir lagen so volle 35 Tage sozusagen beigedreht, bis der Wind nachließ und etwas südlicher ging, so dass wir Kurs steuern konnten. Nach einer Segelzeit von 108 Tagen liefen wir dann in Jyuigue ein. Diese Stadt liegt im Tal am Wasser an hohem Gebirge. So wie sie uns damals erzählten, sei das eine ganz neue Stadt, denn die alte wäre mit einem Erdbeben total verschwunden. Dies konnten wir auch alles an den Häusern sehen. Die Kohlen nun, die wir im Schiff hatten, mussten wir dort entlöschen.
Als das Schiff leer war, wurden die Räume gereinigt und Salpeter eingenommen. Das Laden von Salpeter ging ganz eigenartig vor sich. Ein Sack Salpeter wiegt 3 ½ Zentner. Wir hielten einen Sack zur Zeit mit einer Winde über führten ihn dann in den Raum, wo ein Mann die ganze Ladung staute. Der Fußboden wird erst ganz und gar mit Säcken belegt, die zweite Lage lässt einen Sack an der Bordwand frei, so dass der Unterraum bis Zwischendeck pyramidenmäßig hoch geht. Ebenso wird im Zwischendeck verfahren.
Alle Segelschiffe, (denn nur ein Dampfer kam die Woche und fuhr auch gleich wieder weg) wohl mehr als hundert an der Zahl, lagen in diesem Naturhafen vor Anker. Es waren sämtliche Nationen vertreten. Da alle Schiffe weit von der Stadt ablagen und in der Stadt auch weiter keine Vergnügungen waren, blieb die Mannschaft der Schiffe immer an Bord. So musste denn nach Feierabend und sonntags die Zeit vertrieben werden und es wurde hauptsächlich Wassersport gemacht, ich meine in Form von Fischen und Bootfahren. Das Baden war in dem Hafen verboten, denn es sollten dort Haifische drin sein.
Nun, wenn man in einer so heißen Gegend ist, möchte man sich doch so gerne mal baden. Wir dachten nun immer, es wäre nur ein Schnack, von wegen Haifische, und wir hatten einfach auch noch keine gesehen. So entschloss ich mich dann mal eines guten Sonntagsmorgens außenbords zu gehen. Da ich ein guter Schwimmer war, sprang ich von der Back über Bord. Als ich einmal um das Schiff geschwommen war, schrieen sie von Deck: „Wullt du woll sofort herupp kamen, dor iss jo eenen groten Haifisch“. Sie warfen mir eine Sturmleiter herunter und ich kletterte, so schnell ich konnte, an Deck hinauf, drehte mich um und sah das Ungeheuer mit seinem großen Rachen. Wäre ich noch eine Minute im Wasser geblieben, der hätte mich vollständig übergeschluckt. Denn das Tier war mindestens 6 Meter lang. Er wurde nun von der Mannschaft mit Kohlenstücken beschmissen, aber der quälte sich da gar nicht um. Er stand ganz still auf seiner Stelle und dachte, komm hier bloß noch einer wieder her zum Baden. Aber ich sagte mir seiner Zeit, du gehst aber ganz gewiss nicht wieder ins Wasser und wenn du totschwitzen musst.
Im Ganzen und Großen habe ich noch in keinem Hafen so viele Fische gesehen, wie in diesem. Es waren da vertreten: Haifische, Delphine, Makrelen (das ist aber eine andere Sorte wie die hier in der Ostsee), fliegende Fische und noch viele andere, auch Seelöwen und Seehunde. Die Makrelen zogen scharenweise an unseren Bug vorbei, und so hatte sich einer von unseren Matrosen einen Elker gemacht (ein Eisen mit 5 Zinnen) so ein Ding, womit sonst die Aale im Schlick gestochen werden. An einem Sonntagmorgen stand Anton Schröder auf der Back und wollte Makrelen harpunieren, aber statt der Makrelen kam ein großer Seelöwe an unserem Bug entlanggezogen. Anton Schröder sagt zu seinem Kollegen: „Du, schall ick denn Aas datt mal in den Buckel smieten?“ „Minsch, de geit die mit datt ganze Dings toon Deibel und dee Lien bricht und du bist allet los.“ Der Anton konnte nun aber seinem Vergnügen nicht widerstehen und warf dem Tier die Harpune in den Rücken. Der Seelöwe war ein Tier von mindestens 4-5 m Länge. Als er die Harpune in dem Rücken hatte, drehte er sich nun. Von diesem Schwung brach der Stiel der Harpune. Anton Schröder machte schnell die neue Leine fest, aber wie ein Zwirnsfaden brach dieselbe und sein Seelöwe war verschwunden, mitsamt der Harpune und dem anderen Ende der Leine. Der Stiel trieb auf dem Wasser.
Wie ich schon erwähnte zogen diese Seelöwen und Seehunde scharenweise (wohl 2-300 Stück gleichzeitig) durch die vor Anker liegenden Schiffe. An einem Sonntagvormittag waren von einem englischen Schiff mehrere Offiziersanwärter in einem Boot, hatten Harpunen und Revolver und wollten nun einen Seelöwen fangen oder vielmehr quälen. Wir haben dann alle gesehen, was so ein Tier für Kräfte besitzt. In diesem Boot (es war nicht so klein) saßen 10 Mann. Der Seelöwe hatte die Harpune im Rücke zu sitzen. Die dicke Leine hatten sie vorn im Boot festgemacht und so sauste das Tier mit dem ganzen Boot, zwischen die Schiffe durch. Zeigte er sich mal über Wasser, dann bekam er einen Revolverschuss. Das Boot mit dem Seelöwen verschwand zwischen den anderen Schiffen, so dass wir nicht gesehen haben, wo sie abgeblieben sind und wie lange das Tier noch gelebt hat.
So haben wir uns dort 8 Wochen aufgehalten und traten dann unsere Heimreise wieder an. Ein Schauspiel hatten wir auf der Heimreise noch mit einem großen Hai. Eines Mittags, es war ganz totenstill, so das wir vollständig ruhig im Wasser lagen. Sie Sonne brannte hell. Von oben sah man an Backbord mittschiffs einen großen Haifisch im Wasser stehen. Ich möchte noch bemerken, dass man den Haifisch niemals schwimmen sieht. Wenn man ihn in Sicht bekommt, dann steht er ganz still im Wasser und hat zwei kleine Lotsen bei sich längsseits. Diese kleinen Fische, die er bei sich auf der Seite hat (auf jeder Seite einen) sind zirka 1 Fuß lang und haben buntgewürfeltes Fell. Der Steuermann holte nun den Angelhaken, dieser ist zirka 1 Fuß lang und dementsprechend stark, es wurden zirka 2 Pfund Salzfleisch darauf gemacht und nun ging es los. In einer Entfernung von 5-6 Metern ließ er die Angel ganz langsam zu Wasser. Der Haifisch wartete einen Augenblick, dann auf einmal schoss er los und schnappte zu, verschluckte zugleich das ganze Stück Fleisch mitsamt dem Angelhaken. Jetzt wurde die Leine in einen Block gelegt und alle Mann rissen ihn hoch. Das schönste Schauspiel hatten wir nun, als wir das Ding an Deck gezogen hatten. Hier lag er in einer Länge von zirka 5-6 Metern. Er bekam zuerst vom Steuermann, welcher einen Revolver mit 6 Schuss hatte, diese zu spüren. Ich möchte noch nebenbei bemerken, dass der Haifisch zu den kaltblütigen Fischen gehört, gegenüber Walfischen, die größten Tiere des Atlantiks. Er lebte aber nach diesen Schüssen ruhig weiter.
Da der Haifisch der größte Feind der Seeleute ist, wird er dementsprechend auch gequält, wenn er mal gefangen wird. Zu nahe darf man an das Biest nicht herankommen. Diese Überzeugung bestätigte uns der Bordhund. Der Kapitän hielt sich einen großen Hund an Bord. Er hatte so ein Ding von Hai noch nicht gesehen und war voller Wut auf diesen Fisch. Bekanntlich hat der Schwanz des Haies eine Riesenkraft. Als der Hund nun auf ihn zu bellte, auch wurde er noch von uns gehetzt, bekam er einen Schlag mit dem Haifischschwanz, dass er quer über Deck gegen die Schanzen auf der anderen Seite flog. Der Hund kam so bei kleinem wieder zu sich, steckte den Schwanz zwischen die Beine und verschwand auf nimmerwiedersehen.
Nun ging das Quälen durch die Mannschaft los. Wie ich schon erwähnte, hatte er schon 6 Revolverschüsse in seinem Körper sitzen. Das quälte ihn aber offenbar wenig, denn er war noch gerade so lebendig, wie, als er aus dem Wasser kam. Ihm wurde jetzt eine Handspeiche (ein langer dicker Pfahl) in den Rachen gesteckt, so weit wie sie nur reichte. Dies wurde gemacht, damit er nicht mehr beißen konnte. Hierauf wurde er vom Kopf bis ganz nach hinten aufgeschnitten. Unsere hauptsächliche Neugierde bestand darin, zu sehen, was er wohl in seinem Magen hatte. Hier fanden wir, dass er sechs kleine lebende Haie hatte, sehr viele übergeschluckte Fische und den großen Happen Salzfleisch mit samt Angel. Er wurde dann in zwei Teile geteilt und wieder über Bord geworfen. Es wäre nun lügenhaftiges Seemannsgarn, wenn ich erzählen würde, er schwamm mit dem Kopfteil noch ruhig weiter.
Unser schönstes Vergnügen war, wenn Schweinefische in Sicht kamen. Unser Kapitän war in dieser Gelegenheit ein Sportsmann. Diese Schweinefische, in Büchern Delphine genannt, sind zirka 1-3 Zentner schwer, haben warmes Blut und schmecken sehr gut. Bei einer Geschwindigkeit von 4-5 Seemeilen halten sie sich zu Hunderten vor dem Bug des Schiffes auf. Unser Kapitän hatte aber so ein Interesse daran, einen zu fangen, dass, wenn die Fahrt zu groß war, er verschiedene Segel wegnahm, um das Tempo zu verringern.
So segelten wir dann weiter, hatten noch einige Abenteuer unterwegs, und landeten im Juni 1889 in der großen Seestadt Antwerpen. Die ganze Mannschaft wurde abgemustert, und jeder war sich nun selbst überlassen. Den Abmusterungstag trieb sich die ganze Mannschaft wie wild in den Wirtschaften herum, am schlimmsten war mein Onkel Jacob, selbiger war ja an Bord als Segelmacher gewesen.
Mit Vollschiff „KLARA“ zweimal um Kap Hoorn nach San Francisco
Mir passte dieses Leben jedoch nicht. Ich machte mich aus dem Staube, reiste alleine nach Hause und ging wieder bei meinem Großonkel Bolte in der Sielstraße in Logis. Nach einem Zeitraum von 3-4 Wochen im Juli, musterte ich auf dem Bremer Vollschiff „Klara“ als Leichtmatrose an. Ich war nun 17 Jahre, und so war es auch mein Wunsch, bald Matrose zu werden. Wir musterten in Bremerhaven, und die „Klara“ lag in dem Kohlenladeplatz Cardiff in England.
Von Cardiff aus traten wir mit einer Ladung Kohlen die Reise nach San Francisco an. Die Reise ging anfangs wie üblich vonstatten. Der Kapitän hatte seine Frau und eine Tochter von 17 Jahren an Bord. Als wir nun den Äquator passieren sollten, wurden die Anstalten zur Sonnentaufe gemacht. Kapitän Kuhlmann hatte uns schon einen Wink gegeben, seine Frau und Tochter nicht zu vergessen. Die Taufe wurde ja immer so vollzogen, indem eine große Balje mit Salzwasser auf Deck gesetzt wurde und die Täuflinge wurden hier dann ganz unter Wasser gedrückt. Dieses konnten wir ja mit seiner Frau und Tochter schlecht machen. Der Kapitän hatte nun zu seiner Frau und Tochter gesagt, sie müssten ganz alte Kleider anziehen, denn wenn wir den Äquator passieren, würde ein aschenartiger Regen fallen und das müssten sie unbedingt sehen.
Wir stellten uns nun mit 10 Mann vor dem Achterdeck auf, jeder mit einem Eimer voll Wasser in der Hand, so das die beiden uns nicht sehen konnten. Jetzt kamen sie auf Deck, der Kapitän schickte sie auf die Vorkante vom Achterdeck und sie mussten den Kopf steil in die Luft halten, denn sonst würden sie den Äquator nicht sehen können, und in diesem Moment ergoss sich das Salzwasser auf ihre Köpfe. Ein Schrei, als wenn sie aufgehängt würden. Der Kapitän hielt sich den Bauch vor Lachen, und wir erhielten dafür einige Flaschen Kognak und Bier. Wir hatten dann noch zwei Jungen, die noch nicht getauft waren, und hierbei konnten sich Frau und Tochter mal so eine richtige Taufe mit ansehen.
Dann ging die Reise weiter, und so kamen wir dann in die Nähe von Kap Hoorn. Wir brauchten 35 Tage, um hier herumzukommen, denn schwere Weststürme hielten uns dauernd zurück.
In der Nähe des Äquators, an der Westküste von Amerika, sollte ich eines Abends gegen 7 Uhr mit einem ostfriesischem Leichtmatrosen mit dem Namen Jann, den Außenklüber festmachen. Es war leichter Regen und wir hatten leichte Brise von hinten, so das wir zirka 2-3 m Fahrt machten. Da das Segel nass war, war es schwer auf den Klüverbaum raufzukriegen. Ich wollte mich aber nicht lumpen lassen, so dass die Matrosen nachher sagen konnten, wir hätten nicht das Segel festkriegen können, und so legte ich mich mit den Knien auf den Klüverbaum. Jetzt hatte ich das Segel in voller Gewalt, schimpfte noch mit meinem Kollegen Jann, er solle besser zupacken, und pardauz rutschte ich weg und fiel über Bord. Ich war wohl ein guter Schwimmer, auch war die See ziemlich glatt, obwohl wir auf dem großen Ozean und meilenweit von Land ab waren. Es kam mich doch ein Gruseln an und ich hatte mein Leben schon dem lieben Gott anbefohlen. Ich sah aber vom Wasser aus, dass das große Vollschiff beidrehte, hierauf ein Boot aussetzte und dieses auf mich zugerudert kam. Ich wurde ins Boot reingeholt und so war ich glücklich gerettet Ich muss wohl sagen, obwohl mein Kollege Jann ein furchtbar dusseliger Mensch war, als ich aber über Bord fiel, das hörte ich noch, schrie er ganz laut „Mann über Bord“. Hätte er dieses nicht gemacht, dann hätten sie mich nie wiedergekriegt, denn eine Stunde danach war es dunkel.
So ging die Reise nun weiter und nach einem Zeitraum von 156 Tagen erreichten wir den Hafen von San Francisco. Hier löschten wir unsere Kohlen und nahmen eine Ladung Getreide wieder ein. Im Großen und Ganzen ist San Francisco eine schöne Stadt, welche an einem schönen Meerbusen liegt. Die Einfahrt zu diesem Meerbusen heißt Golden Gate. Ich hatte in unseren 8 Wochen Liegezeit schöne Tage.
Bei meiner Abfahrt hatte mir der Korbmacher Meinke aus Berne die Adresse seiner Kinder, mit denen ich zusammen in der Schule war, mitgegeben. Es waren Karl, Mimi und Johanna. Die Mimi war so alt wie ich, Karl zwei Jahre und Johanna vier Jahre älter. Ihre Eltern hatten es den Kindern geschrieben, dass ich eine Reise nach San Francisco machen wolle. Aber eine Segelschiffsreise ist immer lang und 156 Tage sind über fünf Monate. Nun kann man sich denken, mit welcher Sehnsucht sie das Schiff erwartet hatten. Als wir dann eintrafen, wurde ich gleich mit einer noblen Droschke abgeholt und sie brachten mich zu der ältesten Schwester, die war verheiratet und hatte einen sehr feinen Hausstand. Mimi, die jüngere, war in Stellung. Nun fragte ich die beiden, wo ihr Bruder Karl denn wohne, den möchte ich auch wohl gerne besuchen, sagte ich. „Ja“, sagten die beiden, der wohnt in Aukland, das war auf der anderen Seite vom Meerbusen, „aber wir verkehren nicht mit ihm, denn er hat eine schwarze Frau geheiratet.“
Mich konnte diese Familienangelegenheit ja weiter nicht rühren, und so fuhr ich eines Sonntagsmorgen mit einem Dampfer hinüber nach Aukland. Seine Adresse wusste ich ja, und so dauerte es auch nicht lange, bis ich ihn gefunden hatte. Als ich in seinen großen Kolonialwarenladen eintrat, begrüßte mich eine schwarze Frau mit einem Mischlingskind auf dem Arm. Der englischen Sprache war ich schon ziemlich mächtig, und so fragte ich sie, ob hier wohl Karl Meinke wohne. Sie sagte „Yes“ und ging mit mir nach hinten in die Stube. Hier fragte ich ihn, als wir allein waren, warum er sich denn eine schwarze Frau genommen habe. Er sagte, er lebe da gerade so gut mit und noch besser, wie mit einer weißen Frau. Seine Frau war sehr freundlich zu mir. Ich bin den Sonntag dort geblieben. Karl drückte mir noch 10 Dollar in die Hand und ich fuhr abends wieder an Bord.
Nach 8 Wochen Liegezeit traten wir unsere Heimreise mit einer gemischten Mannschaft wieder an. Die Besatzung der „Klara“ bestand noch zu einem kleinen Teil aus dem Heimathafen, nämlich aus zwei Leichtmatrosen, das waren Theodor Thade, dessen Vater war Direktor eines Gymnasiums in Saarluis und ich, dann 16 neu angemusterte Matrosen, ein Zimmermann, ein Segelmacher, ein Koch, Kapitän Kuhlmann mit zwei Steuerleuten. Die ganzen Matrosen und der Leichtmatrose Jann waren uns in San Francisco weggelaufen und wir bekamen dann eine gemischte Mannschaft (Franzosen, Schweden, Norweger, Finnländer und sonstige Konsorten) wieder an Bord. Mir und auch Theodor waren dort die schönsten Posten angeboten worden. Aber wir beide lehnten dauernd ab, denn die Heimat war uns zu lieb.
Eine Episode von dieser Reise muss ich erwähnen. In den Breitengraden des Äquators hatten wir eine sehr warme Nacht. Die Fahrt des Schiffes war cirka 5-6 Seemeilen, der Wind war hinten. Die Steuerbordwache von 8 Uhr abends bis 12 Uhr nachts war an Deck. Auf dem Achterdeck hat neben dem Rudermann noch der Steuermann Wache und einer von uns beiden Leichtmatrosen. Die Rudergänger, ebenso der Ausgucksmann wurden stündlich abgelöst. Der Matrose Fritz, der die Stunde von 9-10 Rudergänger war, wurde in dieser Nacht nicht abgelöst. Er fing jetzt an mit den Füßen zu trampeln, um den Steuermann oder den Leichtmatrosen heranzuholen. Dieses hörte der Kapitän, welcher nachts in seiner Kajüte schlief. Er kam ganz leise mit Filzpantoffeln an Deck, fragte den Rudersmann, was denn eigentlich los sei. Der Rudersmann sagte: „Ich werde gar nicht abgelöst.“ Nun ging die Komödie los: Der Kapitän schleicht sich ganz still auf dem Achterdeck lang. Zuerst trifft er den Leichtmatrose Theodor, der längs auf den Buckel liegt und schnarcht. Er lässt ihn aber ruhig liegen, und geht weiter, um den Steuermann Stege zu suchen. Den findet er in seiner Kammer - schnarchend auf seiner Seekiste. Auch diesen lässt er ruhig schlafend liegen. Jetzt geht er nach dem Vorderteil des Schiffes. Mitschiffs auf dem großen Luk findet er die ganze Wache an Deck schlafend. Den Ausgucksmann findet er ebenfalls nicht auf seinem Posten. Nun geht er ganz leise ins Mannschaftslogis und findet den Ausgucksmann mit dem Kopf in die Koje hängend, auch schlafen. Nun wieder zurück zum Rudermann und er meinte zu ihm: „Gedulden Sie sich noch einen Augenblick und dann werden Sie abgelöst“. Er weckte jetzt seine Frau und Tochter. Wie diese beide auf Deck sind, gibt er der Tochter die Loggerolle, seine Frau bekommt das Loggeglas. Bei diesem Zeremonium schläft aber nach alles weiter. Unser Kapitän hatte eine furchtbare Stimme, so wie ein Löwe. Nun brüllt er so laut er kann über das stille Schiff: „Hal den groten Brassen tort“. Alles, was Wache an Deck hat, springt auf. Der Kapitän steht mit Frau und Tochter zu Loggen (Loggen heißt, die Fahrt des Schiffes mit einer Leine, welche auf Rollen sitzt, messen). Jetzt kommt der 2. Steuermann heraufgeflogen und will die Loggenrolle anfassen. Mein Theodor springt auch hinzu. Die Matrosen laufen wie die Wilden längst Deck. Der Ausgucksmann stolpert die Back hinauf und der Rudersmann wird abgelöst.
Den anderen Tag war die große Gerichtssitzung. Alle Mann bis auf den letzten mussten auf dem Achterdeck antreten und Kapitän Kuhlmann begann sein Plädoyer und sagte: „Gestern Nacht ist etwas vorgefallen, worüber bald keine Worte zu finden sind. Ein Schiff von 2500 Tonnen groß treibt sich herrenlos auf See herum. Der wachhabende Steuermann liegt in seiner Kammer auf der Kiste und schläft. Der wachhabende Leichtmatrose liegt auf dem Achterdeck und schläft. Der Ausgucksmann liegt mit dem Kopf in der Koje und schläft und der Rest der Wache liegt auf der Luk und schläft.“ Unser Kapitän Kuhlmann kriegte jetzt das Journalbuch her und der ganze Fall wurde eingetragen.
Nach 150 Tage Heimreise trafen wir in Liverpool ein. Ich war nun einen Tag, bevor wir in Liverpool einliefen, beim Segelfestmachen gefallen, und hatte mir dabei das rechte Bein verstaucht. Der Fuß schwoll so furchtbar an, dass ich ungeheuere Schmerzen hatte und ich nicht darauf stehen konnte. So wurde ich dann sofort mit einer Droschke abgeholt und kam in Liverpool ins Hospital. Der Arzt meinte, es wäre gefährlicher als ein Beinbruch.
Nach drei Wochen konnte ich dann humpelnd wieder an Bord gehen. Unser Kapitän fragte uns nun, ob wir beide noch wieder eine Reise machen wollten. Wir beide überlegten uns die Sache und sagten, laut Seemannsordnung müsse er uns nach 24 Monaten Dienstzeit auf einem Schiff zu Matrosen machen, woran er wohl nicht gedacht hatte. Die erste Reise hatte nämlich über 12 Monate gedauert. Von England wurde dann wieder eine Ladung Kohlen mitgenommen und dieselbe San Fancisco-Reise noch mal gemacht.
Die Reise vollzog sich in der Zeitdauer annähernd wie die erste. In San Francisco wurde ich ebenso freundlich aufgenommen. So traten wir denn die zweite Heimreise an.
Noch eine kleine Geschichte muss ich hinzufügen, ich war noch Leichtmatrose und Kapitän Kuhlmanns Liebling und Vertrauensmann. Es handelte sich diesmal um die Weinkammer, die sollte reingemacht werden. Einen Matrose schickte er nicht da hinein, denn er war bange, dass ihm etwas gestohlen werden würde, und so war ich der Ausersehene. Als ich nun mit meinem Eimer voll Wasser in die Weinkammer kam, sah ich all die schönen Flaschen in den Fächern liegen. Eine Flasche lag dort mit Zeitungspapier umwickelt. Auf dem Etikett stand „Portwein“. Der Korken war nicht fest drauf. Dieses hatte ich schon alles ausspekuliert, es fehlte nur der Augenblick, wo ich schnell einen Schluck nehmen konnte, denn er patrouillierte dauernd von der Kajüte hin und her. Aber, als wenn der Teufel dazwischen saß, in einem stillen Augenblick nahm ich einen tüchtigen Schluck aus der vermeintlichen Portweinflache und da hörte ich Tritte. Aber, oh weh, einen Schluck nach unten und den Rest schnell in den Eimer, wo das Auffeudelwasser drin war. Kapitän Kuhlmann betrat die heilige Kammer und meinte: „Watt swimmt dar denn in dienen Waatereimer, ach so, du hest di wohl mal wat got don wullt, an denn Kasteroil, ja mien Jung, ick hebb immer meent, datt du ehrlich wärst, aber du stähls jür so got wie de anneren, mit Speck fängt man die Müs un mit Kasteroil denn Arend.“ Es dauerte auch keine halbe Stunde, da musste ich für mein Portweintrinken dem Lokus meinen Tribut zahlen.
Vollmatrose
Auf See nun, als wir den Äquator östlich von Amerika gut passiert hatten, sagte ich zu meinem Kollegen Theodor: „Du, unsere 24 Monate sind herum, er muss uns doch heute eigentlich zu Matrosen machen.“ Die Matrosen hatten Lunte gerochen und sagten: „Ihr müsst hingehen zum Kapitän und ihm Bescheid sagen.“ Wir beiden nahmen uns ein Herz und schon schoben nach hinten. Als wir beide in die Kajüte eintraten, fragte er gleich: „Nah, watt wült jü beid’n denn?“ Ich musste natürlich das Wort nehmen, denn Theodor beberten alle Glieder. Ich sagte nun: „Kapitän, wir sind jetzt 24 Monate ununterbrochen als Leichtmatrosen an Bord, und nach der Seemannsordnung müssen wir doch Matrosen werden.“ Er brauste zuerst stark auf und meinte: „Das will ich noch erst mal sehen.“ Wir gingen weg und es dauerte kaum eine halbe Stunde, da ließ er uns schon wieder rufen und sagte: „Van gestern aff sünd jü Fullmatros und kriegt anstatt 35 Mark jetzt 60 Mark. Hier hebbt jü jeder twe Flaschen Konjack und nu fiert man juer Beförderung.“
Jetzt ging die Reise wieder weiter und im August 1891 trafen wir in Le Harve (Frankreich) ein. Kapitän Kuhlmann wollte mich noch wieder gerne mit haben, aber ich hatte Heimweh, musterte dort ab, und reiste mit einem Dampfer als Passagier nach Hause. Ich hielt mich einige Wochen dort auf und musterte im September desselben Jahres auf dem kleinen Vollschiff „Stella“ an. Die „Stella“ war ein sehr altes hölzernes Schiff. Der Kapitän hieß Jägermann. Da ich nun unbedingt mal gerne Weihnachten zu Hause sein wollte, entschloss ich mich, mal eine Reise mit diesem alten Pott zu machen, denn die New Jorker Segelschiffsreisen dauerten immer zirka drei Monate. Von Bremerhaven nach New Jork brauchten wir 26 Tage. Unsere Liegezeit dort betrug 14 Tage bis drei Wochen. Ich besuchte während dieser Zeit viele von meinen Schulkollegen, welche nach dort ausgewandert waren.
Wir nahmen eine Ladung Petroleum in Fässern und machten die Rückreise in einem Zeitraum von 45 Tagen, so dass wir eben vor Weihnachten in Bremerhaven ankamen. Meine Gedanken standen nun ja darauf, schleunigst nach Hause zu kommen. Kapitän Jägermann bat mich immer wieder, ich solle doch an Bord bleiben, aber ich lehnte dankend ab. Mir sagte eine innere Stimme, mit dem alten Schiff darfst du nicht wieder mit. Ich habe auch richtig Glück gehabt. Mein vorheriges Schiff, die „Klara“ ist die Reise nach mir, auf hoher See, mit einer Ladung Kohlen, an der Westküste von Amerika auf der Reise nach San Francisco aufgebrannt. Und nun dieses Schiff, die „Stella“, ist die Reise nach mir verschollen. Wir haben nichts wieder von ihr gehört, so dass der Kapitän und die ganze Mannschaft ertrunken sind.
Unter Segeln nach Ostindien
Ich feierte nun so recht schön in Berne Weihnachten und Neujahr. In der Berner Gegend waren wir seinerzeit drei Segelschiffsmatrosen, neben mir noch Reinhard Reimers aus Berne und Georg Braun aus Huntebrück. Ende Januar erhielten wir alle drei vom Heuerbaas Möhlenbrock aus Bremerhaven eine Postkarte mit dem Inhalt, es ständen uns zwei Segelschiffe zur Verfügung mit Namen „MARIA RICKMERS“ und „ELISABETH RICKMERS“, hiervon sollten wir uns ein Schiff aussuchen. Die „Maria Rickmers“ war in Glasgow gebaut und das größte Segelschiff der Welt. Das Schiff hatte fünf Masten, zudem hatte es noch eine Hilfsmaschine. Die „Elisabeth Rickmers“ war eine kleine Bark mit 17 Mann Besatzung. Die „Maria Rickmers“ hatte 49 Mann Besatzung. Wir 3 Kollegen stritten uns nun, worauf es sich am besten fahren ließe. Braun aus Huntebrück wollte mit Gewalt auf das große Riesenschiff. Reinhard und ich entschieden uns für die kleine „Elisabeth“. Die „Elisabeth“ lag in Bremerhaven, wir musterten dort an und segelten mit Ballast nach England (Cardiff), um eine Ladung Kohlen nach Ostindien einzunehmen.
Mein Kollege Braun wurde nach Glasgow geschickt, und von dort aus sollten sie die „Maria“ mit Ballast ebenfalls nach Cardiff bringen, um auch Kohlen zu laden für Ostindien. So kam es denn, dass beide Schiffe in Cardiff nahe beieinander zu liegen kamen. Die „Maria“ war ein stattliches Schiff. Von morgens bis abends war das Schiff besetzt von englischen Besuchern. Die Mannschaft auf der „Maria“ war nicht mit ihrem Kommando zufrieden. Die Mannschaft hatte sozusagen schon in England einen Abscheu gegen das Schiff. Unser Freund Braun bat uns einige Male, doch mit ihm zu tauschen. Wir ließen uns aber auf nichts ein. Im Großen und Ganzen musste dies ja eine gespannte Reise werden, denn ein Segelschiff mit einer Hilfsmaschine war noch nie da gewesen, natürlich außer bei Kriegsschiffen. Die „Maria“ verließ den Hafen von Cardiff mit einer Ladung Kohlen sieben Tage eher als wir. Beide Schiffe hatten Singapur vor Order.
Unsere Reise mit der „Elisabeth“ gestaltete sich schon von Anfang an nicht schön. Unser Kapitän Heinken war krank, so dass der erste Steuermann das Kommando hatte. Auf der Höhe vom Georgkanal sah der 1. Steuermann die Lichter eines Segelschiffes für ein Landfeuer an. Durch falsche Manöver rissen wir dem anderen Segler die ganze Takelage herunter. Es war sehr dunkle Nacht, und da wir beide mit furchtbarer Fahrt aneinander vorbei liefen, dauerte die ganze Havarie nur ein paar Minuten. Wir hörten noch, dass auf dem anderen Schiff noch auf englisch gerufen wurde: „Seht nach den Namen“, aber es war ja stockdunkel und wir flogen ja schnell aneinander vorbei.
45 Grad Süd auf einem Längengrad vom Kap der Guten Hoffnung erhielten wir einen starken Weststurm, so dass wir bei festgemachten kleinen Segeln durchschnittlich 12-14 Seemeilen machten. Eines abends gegen 7 Uhr, als beide Wachen an Deck waren, wurde das große Bramsegel von vier Mann festgemacht. Oben auf der Rah musste sich unser Kollege Hermann von Papenburg erbrechen. Als die vier Matrosen wieder nach unten kamen, fragten wir Hermann, was ihm denn fehle. Er war sonst nicht krank, aber es käme ihm vor, als säße er in einem Schraubstock. Da er nun weiter keine Klagen von sich gab, quälte sich auch keiner um ihn. Eben vor 8 Uhr, also Wachwechsel, hatte er wieder harte Schmerzen. Wir sagten zu ihm: „Geh doch mal zum Steuermann, damit der dir Medikamente gibt.“ Als er von dort wieder herkam, fragten wir ihn, was der ihm denn für Medizin gegeben habe. „Ja“, sagte er, „der Steuermann meint, ich solle mal ein Glas Wasser trinken, dann würde das bisschen Krankheit wohl wieder besser werden.“
Unser Hermann setzte sich auf seine Seekiste, die Wache ging zu Koje, die Wache an Deck löste Ausguck und Rudermann ab und der Rest legte sich auf die große Luke zum Schlafen. Als ich um 9 Uhr vom Ruder kam, war alles still, die Wache zu Koje schlief und ebenso die Wache an Deck auf der Luke. Ich ging ins Logis, um mir eine Pfeife Tabak zu stopfen und Kollege Hermann saß immer noch auf seiner Kiste. Ich fragte ihn: „Hermann, is ett all watt beter?“ Er hat die Augen auf und gibt und gibt mir gar keine Antwort. Mir wird so merkwürdig zu Mute und ich lege dann meine Hände auf seine. Diese waren eiskalt.
Nun wusste ich ja, was los war. Ich weckte die ganze Wache zu Koje und holte auch die andern von Deck. Unser Hermann war eben tot und weiter war nichts zu machen. Dem ersten Steuermann wurde noch eine Epistel vorgebrummt und wir verlangten Journaleintragung. Den andern Tag nähte der Segelmacher ihn in ein Tuch, ein Stück Eisen noch mit hinein und dann wollten wir ihn der See übergeben. Der Kapitän holte die Bibel, las einen Spruch vor, dann wurde er über Bord geworfen.
Wie bekannt, gab es auf den Segelschiffen seinerzeit viele Matrosen, die an Spuk glaubten und so war es auch auf unserer „Elisabeth Rickmers“. Auf jedem Schiff, einerlei, ob Segel- oder Dampfschiff, liegt jeder gerne in einer Längskoje, denn wenn ein Schiff schwer schlingert, steht man einmal auf den Kopf und dann wieder auf den Füßen. Nun hatten wir auf der „Elisabeth“ 8 Matrosen. Davon hatten 6 Längskojen. Ich und mein Kollege Jacob von Papenburg mussten, da wir die Jüngsten waren, je 18 Jahre, uns mit einer Querkoje begnügen. Als unser Hermann nun beerdigt war, kam diese eine Längskoje ja frei. Ich wollte mich schnell derselbigen bemächtigen, als mein Freund Jacob schon sein Bettzeug hinein gelegt hatte. Nun war aber die Katze eine Hexe, alle steckten sie die Köpfe zusammen und murmelten über Spuk. Mein Schulkollege Reimers von Berne meinte zu mir: „Mensch, wolltest du auch in die Koje hinein, hast du denn wirklich keinen Verstand?“ Ich sage zu ihm: „Minsch, denk doch nich an Spöken, sei doch nich so aberglöbsch. Ick kam man nich fröh genoch, sunst wär ick dor och ringahn“. Die abergläubischen Gedanken schwankten noch bei einigen verschiedene Tage weiter.
Wir segelten mit scheren Winden von hinten immer weiter. 4 Tage nach diesem Todesfall, es war an einem Sonntagmorgen, als ich den Rudergang von 8-9 hatte, ging der erste Steuermann auf das Vordeck und sagte zu Albert (auch von Papenburg): „Gaht mal na baben un dreit den Torn ut den Braunschoot.“ Albert, welcher beim Zeugwaschen war, stand im Begriff nach oben zu gehen, dann trat Jacob an ihn heran und sagte: „Wasch man wieder, ick maak datt for di“. Ich stand am Ruder und hörte jedes Wort. Er warf sich den Marlspiker (ein spitzes Eisenwerkzeug) mit einem starken Bentzel um den Hals und ging nach oben, setzte sich auf die Obermarsrahen mit der Front nach dem Mast, also die Bramschot vor sich. Jetzt steckte er den Marlspiker in das Schoottorn vom Bramsegel, oder in die Schootekette (dieses habe ich nicht genau gesehen), drehte, und in dem selben Moment brach die Bramschottenkette, riss ihn, da er den starken Bengel um den Hals hatte, von der Rah herunter und er fiel über Bord. Alles sah ich deutlich. Ich, ebenso Albert, welcher Zeug wusch, riefen laut: „Mann über Bord“. Albert warf ihm sofort einen Rettungsring zu. Ich sah noch deutlich, wie er diesen erfasste.
Nun möchte ich noch betonen, dass, wenn ein Segelschiff mit einem schweren Sturm von achtern 12, 13 oder gar 14 Seemeilen läuft, es dann niemals ein verlorenes Teil vom Schiff wieder kriegen kann, wenn es umdreht und beim Winde segeln muss. Es dauerte auch sehr lange, bis wir alle Segel bis auf die Untermastsegel fest hatten. Als wir nun beigedreht lagen, sagte der erste Steuermann, ein richtiger Sklaventreiber, gleich: „Willt man wiederfahren, den kriegt wie doch nich wedder“. Dabei hatte er noch nicht mal mit einem Fernglas dorthin gesehen. Diese, seine unbarmherzigen Redereien, wurden von uns allen verabscheut. Der Kapitän schickte dann einen Mann mit dem Fernrohr nach oben ins Topp. Leider war nichts mehr zu sehen, auch der Rettungsring nicht.
Die Segel wurden wieder gesetzt und die Reise ging weiter. Nach diesem Todesfall war ja nun wieder eine Längskoje frei geworden, und zwar die, in der schon zwei Verstorbene gelegen hatten. Jetzt durfte ich mich ja nicht ganz und gar lächerlich machen, denn es gab auch einige an Bord, die nicht abergläubig waren. Obwohl ich nun innerlich furchtbar schwankend war, wollte ich mir doch die Blöße nicht geben. Ich packte mein Zeug aus der Querkoje und legte es in die Totenkoje. Meinem Freund Reimers standen die Tränen in den Augen, und er bat mich flehend, doch nicht in diese Koje zu gehen. Ich sagte zu ihm: „Reinhard, glof nich an Spok“. Aber, wie gesagt, der Angstschweiß lief mir über den Rücken, aber ich wollte mich nicht ängstlich zeigen. Jetzt ging die Reise weiter, und so liefen wir nach einem Zeitraum von 20 Tagen in die Sudanstraße ein. Unsere beiden toten Kameraden wurden ja noch lange nicht vergessen, jedoch die schöne Naturlandschaft, welche uns diese Straße bot, brachte uns vorläufig von dem traurigen Verlust ab.
Die Sudanstraße hat eine Breite von zirka 5 Kilometer, wo sich auf beiden Seiten große Kokoswälder hinziehen. Die Eingeboren, schwarze Stämme, welche ihre Beschäftigung beim Bearbeiten der Kokosbäume haben. Auch treiben sie Handel und kommen mir ihren Booten längsseits, um ihre Waren umzutauschen für Kleidung, Schuhe und sonstige europäische Sachen.
Nach zirka 10-12 Stunden war die Straße passiert und nach weiteren 8 Tagen liefen wir in Singapur ein, um Order zu erhalten, wo wir unsere Kohlen löschen sollten. Nach einem Aufenthalt von zwei Tagen wurde weiter gesegelt nach Penang, wo wir nach 10 Segeltagen wohlbehalten eintrafen.
Als wir unsere Kohlen gelöscht hatten, mussten wir die Innenräume reinigen, um Reis laden zu können. Diese Reinigung musste sauber ausgeführt werden, wir mussten daher sämtliche Räume mit Wasser auswaschen. Da es in Penang sehr heiß war, zog ich mir kein Ölzeug an, sondern ließ ruhig den ganzen Tag das Wasser, während es abgespült wurde, über den Körper laufen. In der Abendzeit gegen 8 Uhr bekam ich furchtbare Leibschmerzen, genau wie damals unser verstorbener Freund Hermann. Es wurde so schlimm, dass ich vor Schmerzen zu schreien anfing. Meine Kameraden steckten die Köpfe zusammen und meinten: „Der Arnold geht uns auch tot, wie konnte er bloß in die Unglückskoje gehen, wir hatten ihn doch genug gewarnt“. Ich selber hatte mich auch schon aufgegeben. Als die Schmerzen nun immer größer wurden, ging ich in die Kajüte zum Steuermann. Ich bekam von ihm ein Stück Zucker mit 16 Tropfen Opium und legte mich in die Koje, wo mir dann der Verstand wegging.
Nach Aussagen meiner Kameraden habe ich dann noch erst eine Zeitlang phantasiert und dann wurde alles still. Von der ganzen Mannschaft wurde ich schon für tot erklärt, aber es sollte doch anders kommen, denn man sagt ja, Unkraut vergeht nicht. In der Morgenzeit erwachte ich plötzlich wieder, ich war wohl anfänglich abgespart und matt, aber meine Leibkrämpfe waren vollständig verschwunden und ich habe an dem Tag wieder mitgearbeitet.
Von Penang wurde mit Sand-Ballast nach Rangoon gesegelt. Unterwegs bekamen wir einen Monsum, das ist ein orkanartiger Wind, der aus klarem Himmel kommt. Das Schiff legte sich auf einmal so stark über, dass das Wasser bis zu den Luken stand. Die gesamte Besatzung war auf Deck, jeder hatte sich in die Takelage begeben, damit ihn das Wasser nicht fassen konnte. Alle hatten wir schon unser Leben aufgegeben und erwarteten das Kentern des Schiffes, jedoch durch das gute Aufpassen des Rudermanns, indem er das Schiff scharf am Wind hielt, wurde unser aller Leben gerettet. Dieser starke Orkan dauerte vielleicht 5 Minuten und dann segelten wir wieder mit einer gemütlichen Brise weiter.
Nach acht Tagen Segelzeit trafen wir in Rangoon (Ostindien) ein, um dort eine Ladung Reis zu nehmen. Diese Ladung wurde mit Hilfe der eingeborenen Inder übergenommen. Jeder von uns Matrosen hatte vier Mann zur Beaufsichtigung, damit die Reissäcke gut gestaut wurden. Die ganze Übersicht hatte ein italienischer Vormann, der ein furchtbarer Sklaventreiber war. Wenn ein Arbeitsmann nur einen Fehler machte, dann schlug er ihm mit einem Reitstock über den Rücken. Auch unser erster Steuermann war so ein Biest, der keine Zivilisation kannte. Diese Eingeborenen, Hünen von Männern, wussten es aber nicht anders und ließen sich ruhig schlagen. Uns Besatzung stieg das Blut in den Kopf vor Wut und wir haben unseren Steuermann auch darüber zur Rede gestellt. Mit diesem Manschen war aber nicht viel anzufangen, der war nämlich im Stande, sofort zum Revolver zu greifen, so war denn die Reise wegen des ersten Steuermanns eine sehr ungemütliche. Es konnte auch bei diesen Verhältnissen nicht anders kommen, als dass eine Meuterei ausbrach, die ich weiter unten schildern werde.
Was Rangoon nun anbetrifft, so ist diese Stadt für uns Europäer wohl nicht hübsch, aber es gibt dort viele Sehenswürdigkeiten. z. B. haben wir uns angesehen, wie die Elefanten arbeiten können. Da sieht man Holz lagern, von großen Balken in der Länge zirka 15-20 m und 2 Fuß Durchmesser. Diese Balken tragen die Elefanten, an jedem Ende einer, mit ihren Rüsseln aus dem Wasser und legen sie kunstgerecht auf einen Haufen. Bei dieser Arbeit sieht man 30-40 Elefanten, wobei für je zwei Tiere ein Inder zuständig ist. Haben die Tiere Feierabend, dann werden sie alle in das Bad geführt, danach gibt es Abendbrot.
Auch die großen Kokoswälder interessierten uns. An einem Sonntagmorgen segelten wir mit unserem Boot quer über das Revier (zirka 5 Seemeilen) um uns eine Ladung Kokosnüsse zu holen. Wir dachten nun, die großen, unendlichen Kokoswälder würden niemand zugehören. Eins, zwei, drei kletterten wir die schlanken Bäume hinauf. Die Bäume haben keine Äste, nur ganz oben in der Krone sitzen die Blätter und die Früchte. Hei, wie das ging, die Kokosnüsse hagelten von oben. Deshalb muss ich erwähnen, das nicht ein jeder von uns nach oben konnte, denn die Bäume sind ganz glatt und ohne Äste. So mussten denn diese Arbeit die schlanksten unter uns machen.
Unsere Freude sollte aber nicht lange dauern, wir meinten wohl, wir seien in der Wildnis. Auf einmal hören wir einen Schuss, und siehe da, es kam ein halbes Dutzend Eingeborener, Inder mit einem Gewehr bewaffnet, fragten uns, wer wir seien und wo wir her kämen. Natürlich, wir machten gute Mine zum Spiel und sagten anständig, dass wir Deutsche seien und geglaubt hätten, es wäre hier alles Wildnis. Sie erklärten uns nun in englisch, dass dieser Kokoswald einem englischen Plantagenbesitzer zugehöre, und wir müssten schleunigst machen, das wir wegkämen, würde eine höhere Person kommen, dann müssten sie uns mitnehmen und zur Strafe würden wir 6 Stunden an einen Kokosbaum gehängt, sie würden uns wohl dieses Mal noch laufen lassen. Wir waren nun ja frohen Herzens, das die Eingeborenen so gnädig mit uns waren. Auch ließen sie uns noch die Kokosnüsse mitnehmen, wir mussten aber schleunigst verschwinden.
Als wir nun unsere 19.000 Sack Reis übernommen hatten, sollte die Heimreise beginnen. Wie ich schon eingangs erwähnte, waren wir mit unserem Kommando nicht zufrieden, das konnte auch nicht anders kommen, denn der Kapitän war 23 und der erste Steuermann 24 Jahre, und davor kann eine Mannschaft nicht Respekt für haben. So waren wir denn auch die ganze Reise schon schikaniert worden. Da die Schiffsleitung nun genau wusste, dass wir abends abfahren sollten, ließen sie uns trotzdem den ganzen Tag mit Rostklopfen usw. arbeiten. Dies ärgerte uns über alle Maßen, und es wurde der Entschluss gefasst, abends keinen Anker zu hieven. Wir hatten uns nun wohl überlegt, nicht direkt das Ankerhieven zu verweigern (denn das wäre direkte Meuterei gewesen).
Als der Lotse nun an Bord kam, gab er gleich das Kommando „Hiev Anker“. Alle Matrosen lagen auf der Back, da es im Logis furchtbar heiß war. Als nun der erste Steuermann das Ankerhieven regetierte, stand keiner auf. „Na“, sagte der Steuermann, „kommt wir wollen Anker hieven“. Wir gaben ihm zur Antwort: „Wir können nicht mehr“. Er lief in seiner vollen Wut nach hinten zum Kapitän, der sagte gleich: „Gahn see an Land un holen see 40 bett 50 Kanakers“. Wir legten uns dann alle in unsere Kojen, aber vor Aufregung konnte keiner Schlafen. Es dauerte auch nicht lange, dann hörten wir ein furchtbares Gebrappel.
In der Morgenzeit gegen 4 Uhr war der Anker noch gerade so weit, wie vorher. Wir gingen alle an Deck und meldeten uns beim Steuermann. Er, sowie der Kapitän sagten kein Wort. Sie freuten sich, das wir wieder an Deck kamen. Die ganzen Kulis wurden wieder an Land gejagt, und es dauerte auch keine Stunde und unsere „Elisabeth“ segelte in See.
Nun sollte die große Eintragung im Journal wegen Meuterei gemacht werden. Da hatte nun aber eine ganze große Eule gesessen, denn wir hatten ja nicht direkt gemeutert, wir hatten ja nur gesagt, wir könnten nicht mehr, und dann meinten wir zum Kapitän und Steuermann: „Dregen see datt in’t Jornal inn, aber dregen see ock inn, datt see datt englische Seilschipp dee ganze Tekelasche herunter hahlt heppt und datt see in ... faart heppt“. Der Kapitän meinte natürlich, das seien unsere Angelegenheiten nicht, er schrieb auch was ins Buch ein und las es uns auch vor, aber es muss doch kein Journalbuch gewesen sein, denn bei der Abmusterung in Bremerhaven ist nichts passiert.
Die Heimreise vollzog sich unter gemütlichen Winden. Auf er Rückreise waren Kapitän und Steuermann wie umgewandelt, also sehr freundlich. Da wir keine Kartoffeln mehr hatten, meinte der Kapitän: „Wir wollen doch mal St. Helena ansteuern, ob wir dort nicht Kartoffeln für Salzfleisch umtauschen können, auch können wir dann ja mal Napoleons I. Grab sehen.“
An einem Morgen gegen 6 Uhr lagen wir beigedreht unter St. Helena. Es kamen 2-3 Boote mit vielerlei Proviant. Da der Kapitän kein Geld hatte, und wir schon lange nicht, musste getauscht werden. Aber, meine Herren, was die für einen Zentner Kartoffeln verlangten! Der Kapitän dachte einen Barrel Salzfleisch (200 Pfund) zu opfern und dafür vielleicht 4-5 Ztr. Kartoffeln für zu kriegen. Die Helenaer verlangten zwei Barrel Salzfleisch für einen Zentner Kartoffeln. Dies war denn doch ein bisschen zu unverschämt. Wir haben uns dann noch so recht Napoleons Grab besehen, und die Reise ging weiter.
Nach 115 Segeltagen trafen wir auf der Weser ein. Als der Lotse an Bord kam, wurde natürlich zuerst gefragt, wie lange die „Marie Rickmers“ schon da sei. „Ja, sagte der Lotse, die „Marie“ ist noch nicht hier“. Die ganze Besatzung schüttelte den Kopf, denn die „Marie“ war doch schon 14 Tage eher von dort abgesegelt als wir, zudem hatte das Schiff doch noch eine Hilfsmaschine.
Wir musterten alle in Bremerhaven ab, und als ich eine Jahresreise gemacht hatte, hörte ich, das die „Marie“ mit der gesamten Besatzung (38 Mann) also auch mit meinem Kollegen Braun, verschollen sei. Als ich meinen Kollegen Reimers nachher mal wieder traf, sagte ich zu ihm: „Itt ist doch goot wesen, datt wie daar nich mitgaan sind“.
Um Kap Hoorn nach Honolulu
Denselben Monat, also im Februar 1893 musterte ich auf dem Vollschiff „George N. Willkox“ an. Dieses Schiff gehörte zur Reederei Horkfeld. Die Reederei betrieb das Passagier- und Frachtgeschäft nach Honolulu. Das Schiff war neu gebaut und trat seine erste Reise an. Wir wurden mit der gesamten Besatzung über Hull nach Liverpool geschickt, wo wir auch musterten.
Unser Kapitän hieß Wolters, ein kleiner Mann und an einem Bein etwas humpelnd, im Benehmen und gegen die Mannschaft ein feiner Mann. Auf Ruderwache mochte er gerne erzählen, und so ließ er uns wissen, dass er Mitreeder sei und 60.000 Mark Aktien im Schiff habe. Er erzählte auch, dass er als ganz armer Junge zu fahren angefangen wäre. Er hätte sich das Geld zum Lernen übergespart und nachher sein Geld mit in die Aktien gegeben. Das heißt, sein Vermögen war aber noch viel größer.
So verging die Reise ganz gemütlich. Nur bei Kap Hoorn bekamen wir schwere westliche Winde, so dass wir uns dort 35 Tage vor Untermarssegeln aufhalten mussten. Die Langeweile bei Kap Hoorn vertrieben wir uns mit Albatros- und Kaptaubenfangen. Die Albatrosse wurden mit einem dreikantigen Blech gefangen. In dieses dreikantige Blech war wieder ein Dreikant geschnitten, und dann wurde um die eine Spitze ein Stück Speck gebunden, in die Seitenkante kam ein dicker Bindfaden. Die Albatrosse, ebenso die Kaptauben, haben krumme Schnäbel, ungefähr wie ein Papagei. Die schönste Gelegenheit, diese Vögel zu fangen, besteht, wenn das Schiff beigedreht liegt, so dass es wenig Fahrt durch das Wasser macht. Ein Albatros kann eine Flügelspannweite von 3-4 Metern haben und so ist es auch erklärlich, dass, wenn er den Schnabel in dem Dreikant hat, eine furchtbare Kraft dazu gehört, ihn an Bord zu ziehen. Der Albatros wirft sofort seine Flügel auseinander und so gehören mindestens 4-5 Mann dazu, ihn durch das Wasser zu holen. Von diesen Vögeln wurde nur die Brust genommen, das Fleisch ist wegen Trangeschmacks nicht zu essen.
So trafen wir dann nach einer gesamten Segelzeit von 155 Tagen in Honolulu ein. Die Insel Honolulu gehört zu den Sandwischinseln und stand damals unter der Regierung der Schwester des verstorbenen Königs Kalakaua. Als wir mit unserem Schiff festmachten, war gerade die Revolution beendet.
Die Sandwischinseln und auch Honolulu wurden damals von Schwarzen bewohnt. Aber auch Europäer hielten sich dort auf. Die Königin der Sandwischinseln war eine Schwarze und wie ich schon erwähnte, des verstorbenen Königs Kalakaua Schwester. Die ganzen Eingeborenen, sowie auch die Europäer, wollten von der Regierung nichts mehr wissen, weil sie die ganzen Inseln in Schulden gebracht hatten. So bewaffneten sich dann eines Tages die Europäer und versorgten auch die Eingeborenen mit Waffen, belagerten der Königin Schloss und nahmen ihre Leibwächter gefangen. Man muss sich nun dieses Schloss nicht vorstellen, wie unsere europäischen königlichen Schlösser. Es war vielleicht mit einem Zweifamilienhaus aus Holz bei uns zu vergleichen.
Es lag seinerzeit gerade ein amerikanisches Dampfschiff dort und Amerika hat es nachher auch ja annektiert.
Die Deutschen waren schon damals in aller Herren Länder vertreten, und so wohnte auch hier in Honolulu ein Bremer Gastwirt mit Namen Kropp. Ich hatte mir nun von Bremerhaven eine Ariosa-Orgel mitgenommen, das war eine kleine Orgel, wo man oben eine Drehscheibe auflegte, welches die Noten waren. Sie hatte mich damals 30 Mark gekostet. Auf der Hinreise hatte ich viel damit gespielt, so dass schon einige Stimmen mitspielten, als wir in Honolulu ankamen. Dem Gastwirt Kropp erzählte ich nun, dass ich eine Orgel hätte, dass aber schon einige Stimmen mitspielen würden. Kropp sagte zu mir: „Wenn auch schon Stimmen mitspielen, bringen Sie bloß das Ding her, ich bezahle ihnen dafür gut.“ Wie bekannt, gab uns der Kapitän nur einen Dollar die Woche und da konnten wir jungen Matrosen ja wenig mit anfangen. Ich war ja nun mit meinem Kollegen Adolf Salomon aus Oldenburg sehr freudig darüber, dass wir das Ding gut verkaufen konnten.
Eines Abends nahm ich das Ding unter den Arm, und mit mir kam mein Kollege, wir wollten damit zu Kropp, um die Orgel zu verkaufen. Wir waren aber noch keine hundert Schritte vom Schiff entfernt, als uns 10 bis 12 schwarze Jungen umzingelten, die uns in ein Gefängnis brachten. Ich sagte zu meinem Kollegen: „Was werden die Schwarzen wohl jetzt mit uns machen?“ Da die Menschen kein Englisch verstanden, konnten wir ja kein Wort mit ihnen sprechen. Wir malten uns schon das Schrecklichste aus, von wegen Menschenfresser oder Ähnliches.
Als wir in diesem Gefängnis ungefähr eine Stunde gesessen hatten, wurden wir vor einen europäischen Herrn geführt, der zu gleicher Zeit die Orgel auf seinem Tisch stehen hatte, die die Schwarzen uns weggenommen hatten. Der Europäer fragte uns nun, wo wir her kämen und was für Landsleute wir seien. Als er nun hörte, dass wir von einem Bremer Schiff seien und auch zugleich Deutsche, da fing er an zu lächeln. Jetzt fiel uns beiden schon ein Stein vom Herzen. Er fragte uns nun, wo wir denn mit der Orgel hinwollten. Wir sagten, die Orgel sollte ein Bremer Gastwirt mit Namen Kropp haben. Ja, meine lieben Landsleute, meinte er da, das ist ja mein Bruder, dann könnten Sie ruhig weiter gehen. Er erzählte uns nun den ganzen Sachverhalt, dass er der Chef der Polizei sei, und dass die Schwarzen die Orgel für eine Dynamitkiste gehalten hätten, und er meinte noch, wenn er da nicht zwischen gekommen wäre, sie uns wohl fortgeschleppt hätten.
Wir gingen nun vergnügt weiter und trafen glücklich mit unserer Orgel beim Gastwirt Kropp ein. Wir erzählten ihm die ganze Angelegenheit, worüber er dann lachen musste. Es wurde sofort ein Stück aufgespielt, wobei sich gleich eine so große Menschenmenge einfand, dass kein Platz mehr in und vor dem Hause war. Nun fragte er mich, was ich denn haben müsste für die Orgel. Ich fragte meinen Kollegen: „Ja was meinst du, was soll ich fordern?“ Wir sprachen viel hin und her, dass schon mehrere Stimmen mitspielen würden u.s.w. Zuletzt sage ich zu Adolf, ich will mal 25 Dollar fordern. Als ich nun dem Kropp meine Forderung von 25 Dollar nannte, warf er mir, ohne sich zu besinnen, 40 Dollar auf den Tisch.
Nach späteren Erfahrungen hätte ich dafür mit Leichtigkeit 100 Dollar bekommen können. Auf jeden Fall, wir hatten beide Geld, so dass wir uns ein paar schöne Abende dafür leisten konnten, und unser Leben war ja auch gerettet.
Unsere Ladung, die wir dort löschten, bestand aus Kohle und Stückgut. Die Kohlen lagerten im unteren Raum und im Zwischendeck hatten wir verschiedene Sorten Stückgut. Das Löschen mussten wir mit unserer eigenen Mannschaft besorgen. So arbeiteten der zweite Steuermann und die Mannschaft im Stauraum. Ich hatte den Posten an Deck, um die Ladung beim Aufhieven an Land zu setzen. Ein kleiner Donken, den wir uns von England mitgenommen hatten, wurde an Land gestellt und wir hievten damit die Ladung rüber. Der erste Zimmermann bediente diesen Donken. Da derselbe nur einen Zylinder mit einem Schwungrad hatte, blieb er bei etwas zu schwerem Gewicht stehen, dann musste man von Hand das Schwungrad wieder in Gange bringen.
Der Zimmermann passte nun nicht auf und kriegte seine Hand zwischen die Kolbenstange, so dass ihm die sämtlichen Finger von der Hand gerissen wurden. Er drehte dann das Dampfventil zu, fiel in Ohnmacht und wurde sofort ins Krankenhaus transportiert.
Nun fragte mich der Kapitän, ob ich den Donken betreiben könne. Obwohl ich noch nie was mit Dampfmaschinen zu tun gehabt hatte, bejahte ich. Ich goss einige Eimer voll Wasser auf den Kessel, hatte ja mein Wasserstandsglas und fertig war der Maschinist. Ich habe den Donken die ganze Löschzeit zur vollen Zufriedenheit des Kapitäns und der Mannschaft betrieben.
Drei Tage danach, will der zweite Zimmermann mit zwei Geneverflaschen, die er sich aus einer Kiste geklaut hatte, die Leiter raufgehen an Deck. Er kriegt das Rutschen, fällt von der Leiter in den Stauraum und bricht sich einen Arm. Seine Kollegen nahmen ihm schnell die beiden Flaschen ab, damit der Kapitän es nicht gewahr wurde, und er wurde an Deck transportiert. Auch er kam ins Krankenhaus.
Die Insel, auf welcher Honolulu liegt, gleicht einem Paradies. Alle Sorten Früchte, die wohl auf dem Erdboden wachsen, sind dort zu finden. Alles, was man sieht ist herrlich und schön. In den Palmen und sonstigen seltenen Fruchtbäumen sieht man die Affen springen, die Kakadus kreischen, ebenso Papageien und sonstige bunte Vögel. Auch wurde uns das Grab von dem verstorbenen König Kallakaua gezeigt. Das einzige Übel für uns waren die Moskitos, denn wenn es abends etwas kühl wurde, fingen die Dinger schrecklich an zu stechen, so dass wir uns vollständig mit ganz feinen Netzen einhüllen mussten.
Nach einer Liegezeit von 6 Wochen segelten wir mit einer Ladung Sandzucker nach San Francisco. In dieser mir altbekannten Stadt, wo ich schon zweimal vorher gewesen war, wurde ich gerade wieder so freundlich von meinen Landsleuten aufgenommen wie vorher. In San Francisco wurde eine Ladung Weizen genommen und nach einer Liegezeit von vier Wochen segelten wir ab nach Queenstown vor Anker.
Die Stadt Queenstown auf Irland erreichten wir nach 148 Segeltagen. Ein Ankerhafen war immer ein aufgeregter Ankunftsplatz für Seeleute. Denn die ganze Heimreise wusste keiner von der ganzen Mannschaft wohin es ging. Nun waren wir gespannt, als der Kapitän von seinem Makler (Vertreter der Reederei) wieder kam. Die ersten Worte, als er an Bord kam, waren: „Hiev Anker, app na Middlesbrough“, eine Stadt an der Ostküste von England. Nach sieben Segeltagen trafen wir dort ein.
In Middlesbrough musterte die gesamte Mannschaft am 25. März 1894 ab und musste auf eigene Kosten nach Hause reisen. Da ich mir nun fest vorgenommen hatte, die Steuermannsschule zu besuchen, trennte ich mich von der übrigen Besatzung, denn die trieb sich noch in den Wirtschaften herum. Als ich gerade in den Zug steigen wollte, um nach Hause zu fahren und von dort mit einem Dampfer nach Bremen, rief mich mein Freund Salomon und fuhr mit mir.
Als wir in Bremen ankamen musste ich feststellen, das mein Adolf keinen Pfennig Geld mehr hatte. Er erklärte mir nun, und das hatte er mir auch schon oft auf der Reise erzählt, dass sein Onkel Oberamtsrichter in Oldenburg sei und sein Vermögen von 30.000 Mark verwalte (sein Vater war tot). Nun bat er mich, ich möchte doch einen neuen Anzug und Schuhe für ihn kaufen, damit er sich seinem Onkel anständig vorstellen könne. Ich sage zu ihm: „Adolf, ich will jetzt, wenn ich nach Hause komme auf Schule gehen, sei du so gut und leihe deinem Freund 1.000 Mark, du sollst es auf Heller und Pfennig wieder haben.“ Mein Freund Adolf sagte: „Du sollst ganz bestimmt die 1.000 M. haben.“ Ich kleidete ihn nun vollständig ein: Er bekam einen Anzug, einen Überzieher, ein paar Schuhe, weiße Wäsche. Auch das Zuggeld von Bremen nach Oldenburg gab ich ihm noch.
Navigationsschule in Elsfleth
Als ich nun zu Hause kam, nahm ich zuerst Extrastunden bei einem Dorflehrer, um Bruchrechnung zu lernen, um an dem Kursus in der Navigationsschule teilnehmen zu können.
Am 1. Juni 1894 reiste ich nach Elsfleth und ging bei Frau Witwe Grape in der Steinstraße in Pension. Hier logierten wir mit fünf Schülern in einem Zimmer, an der Straßenfront wohnten drei und ich mit meinem Kollegen zu zweit in dem Hinterzimmer. Wir bezahlten monatlich 60 Mark für volle Pension.
Die 1.000 Mark, die mein Freund Adolf mir versprochen hatte, bekam ich ja lange nicht, auch mein Geld, was ich für ihn ausgelegt hatte, erhielt ich nicht zurück. Adolf hatte von seinem Vermögen einen guten Teil verzecht (zirka 6.000 M) und war dann wieder nach See gegangen. Mir blieb nichts anderes übrig, als seinem Onkel diese Angelegenheit schriftlich zu unterbreiten. Es war ja ein schwerer Schmerz für einen Verwandten, aber er kannte seinen Neffen ja zur Genüge. Allenthalben in Oldenburg hatte er Schulden gemacht und so erhielt ich auch in ein paar Tagen mein Geld zurück. Als mein Freund Adolf die nächste Reise wieder kam, wurde er nach New Jork geschickt. Mich jammerte sein ganzes Vermögen, zumal ich dann auch nichts mehr von ihm gehört habe.
Meinen Kursus in Elsfleth machte ich mit Vergnügen und da ich sehr reges Interesse an diesem nautischen Lernstoff hatte, war ich einer von den besten der 13 Schüler in der Klasse. Als gegen Weihnachten die Examenszeit heran kam, fragte mein Bruder meinen Lehrer, was er wohl von mir denke, ob ich mein Examen wohl bestehen würde. Mein Lehrer sagt zu ihm: „Ihr Bruder ist einer von meinen besten Schülern, da habe ich keine Bange, das er durchfallen könnte“. Nun hatten wir auch einige Gymnasiasten in unserer Klasse und vor diesen Herren wollte ich in Bezug auf Lernen nicht zurückstehen. Es ist nun im Examen üblich, dass sich einige aufspielen wollen, indem sie im Schriftlichen schnell fertig werden, und dies war mein Ruin. Als zwei von den Gymnasiasten ihre schriftlichen Arbeiten erledigt hatten und die Klasse verließen, wurde ich aufgeregt, haute meine Aufgaben schnell hin und verließ als dritter von den 13 Schülern die Klasse. Als ich nach Hause kam, sagte ich schon zu meiner lieben Frau Grape: „Ich bin durchgefallen.“ Ihr standen die Tränen in den Augen und sie meinte: „Herr Otte, sie können es noch nicht wissen“. Ich sagte: „Ja, Frau Grape, ich habe drei Bedingungsaufgaben falsch und da falle ich ganz sicher auf durch“.
Am dritten Tag im Examen war die mündliche Prüfung. Es war schon Usus, die dort nicht zugelassen wurden, waren erledigt. So ging es auch mir. Ich wurde in das Konferenzzimmer gerufen und der Prüfungsinspektor teilte mir so ganz höflich mit, das ich leider mein Examen nicht bestanden hätte. Ich hätte drei Bedingungsaufgaben falsch, und nach dem Gesetz dürfe von den Bedingungsaufgaben überhaupt keine falsch sein, das habe zur Folge, den Kursus zu wiederholen, also viele Monate nachzulernen. Aber, meinte er, weil ich so ein tüchtiger Schüler gewesen sei, könnten meine Fehler nur aus Flüchtigkeit entstanden sein, und er würde es daher verantworten können, mich nach drei Monaten Lernzeit im nächsten Kursus wieder ins Examen zu nehmen.
Ich nahm meinen Hut und die Bücher untern Arm und ging zuerst zu Frau Grape. Sie weinte bitterlich, aber ich redete ihr gut zu, guten Muts zu sein, gab ihr die Hand und reiste nach Berne zu meinen Eltern. Nun aber war guter Rat teuer, mein Geld zum Weiterlernen war alle. Meine Eltern waren arm und mein Bruder hatte für sich selbst zu sorgen.
Es wäre ja alles nicht so schlimm gewesen, wenn meine böse Militärzeit mir nicht auf den Fersen gesessen hätte. Mit 20 Jahren mussten wir damals beim Militär eintreten und man konnte im höchsten Falle zum Besuch der Navigationsschule bis zum 25sten Jahr Ausstand bekommen. Da ich nun schon in mein 23stes Lebensjahr hineinging, war an einen Ausstand nicht mehr zu denken, und so blieb mir nichts anderes übrig, als erst meine drei Jahre abzureißen. An ein Freikommen vom Militär war nicht zu denken, denn ich war natürlich gesund. So riskierte ich dann noch schnell ein paar Reisen auf einem Tankdampfer, um doch etwas Geld beim Militär zu haben.
Drei Jahre Militärzeit bei der Kaiserlichen Marine
Am 9. Mai 1895 reiste ich nach Wilhelmshaven zur Musterung. Hier bekam ich gleich den Bescheid, mich zu stellen bei der II. Matrosendivision, 3. Kompanie Wilhelmshaven. Ich wurde noch gefragt, ob ich ein paar Tage Urlaub haben wollte, was ich verneinte. Denn Berne, sowie Elsfleth wollte ich für eine ganze Zeitlang nicht mehr sehen, was auch leicht zu verstehen ist, weil mir für mein Ziel, was ich mir gesteckt hatte, kein Mensch helfen konnte.
In Wilhelmshaven nun wurde ich in eine schmucke Marineuniform gesteckt, worauf ich sehr Stolz war. Der Dienst gefiel mir sehr gut, aber ich bekam die ersten Tage schon Bescheid, fünf Tage gelinden Arrest abzumachen. Diese fünf Tage stammten noch von meiner Schulzeit aus Elsfleth, ich hatte nämlich mit einem guten Freund die beiden Nachtwächter beleidigt. Der gelinde Arrest war beim Militär eine leichte Wache.
Nach der Beendigung meiner Rekrutenzeit machte ich noch einen Spielmannkursus. Mein größter Stolz war, als ich zum erstenmal auf Wache zog. Das Signal zum Wecken am Morgen, sowie am Abend für die Beurlaubten war nicht so einfach, denn die Trompetentöne schallten über das ganze Wilhelmshavener Gebiet.
Die Kompaniezeit war im allgemeinen gemütlicher als an Bord, nur die Löhnung (den Tag 22 Pfennig) war zu wenig und auch das Essen war sehr knapp. Warmes Essen gab es nur mittags und morgens nur dünnen Kaffee und trocken Brot.
Nach fünf Monaten Kompaniezeit wurde ich als Spielmann auf das große Panzerschlachtschiff „L.M.L. BRANDENBURG“ kommandiert. Hier fing für mich aber ein ganz anderes Leben an. Als Spielmann brauchte ich überhaupt kein Arbeitszeug zu tragen, denn jeden Tag hatte ich Wache. Ich wurde auch sofort gefragt, ob ich Lust hätte, bei der Musikkapelle einzutreten. Da ich nun die Trompete schon blasen konnte, so war für mich das Notenlernen nicht so schwer und da ich ein großes Interesse für Musik hatte, bildete der Kapellmeister mich zum ersten Trompeter aus, so dass ich ihn nach einer Lernzeit von einem Jahr schon vollständig vertreten konnte.
An einem schönen Sonntagnachmittag wurde gepfiffen: „Die Musik zum Spielen auf das Aufbaudeck!“ Da der Kapellmeister nun beurlaubt war, mußte ich ihn vertreten. Der wachhabende Offizier fragte mich, ob es ohne den Kapellmeister ginge. Ich sagte: „Wenn die Leute mir gehorchen, dann geht es ebenso gut.“ Ich stellte nun meine Kapelle, etwa 14 Mann, auf dem Aufbaudeck auf und befahl den Armeemarsch zu spielen. Da zeitweise ein leichter Windzug vorbeifegte, sagte ich zu ihnen, sie sollten die Noten auf dem Tisch gut befestigen. Da unsere Kapelle bezüglich Lehrlinge viel Wechsel hatte, waren nun immer ein paar Mann dazwischen, die die Stücke aus dem Kopf spielen konnten. Ich setzte den Takt an und los ging das Geschmetter. Aber, oh, noch als wir den ersten Teil halb durch hatten, kam ein Windstoß und sämtliche Noten flogen von dem Tisch. Alles fing an zu greifen, um die Noten wieder zu holen. Die einzigen die munter weiter spielten waren der Tubabläser und ich, dazwischen hauten dann noch die Pauke und Trommel. Diese Musik gab dann natürlich so ein Kauderwelsch ab, dass die ganze Mannschaft an zu lachen anfing und der Offizier uns zum Teufel jagte. Ich mußte als stellvertretender Kapellmeister danach zum wachhabenden Offizier kommen. Natürlich erklärte ich ihm den Tatbestand, worauf er die anderen Musiker zum Rapport bestellen wollte. Vor der Mannschaft hatten wir uns ganz schrecklich blamiert. Diesen Specktakel bekam dann den anderen Tag auch unser Kapellmeister zu hören und bestellte dann die ganze Kapelle zum Rapport. Der erste Offizier konnte sich doch das Lachen nicht verbeißen, er mußte aber bestrafen und so bekamen meine Untertanen jeder vier Stunden Strafübungen.
So gingen dann die militärischen Tage auf der „BRANDENBURG“ weiter. Arrest auf einem Kriegsschiff ist eine Schande, d.h. so lange wie er ehrenhaft ist. Es war am 29.1.1896, also einen Tag nach Kaisers Geburtstag, als mein Freund Heini Gärdes von Großensiel zu mir sagte (es war in Wilhelmshafen): „Willst du mit an Land?“ „Mensch, sagte ich zu ihm, ich habe kein Geld und keinen Urlaub.“ „Oh“, antwortete er mir, „ich pumpe mir eben drei Mark vom Zahlmeister Heise und du bist mein Begleiter, dann brauchen wir keinen Urlaubsschein, es ist ja auch gestern Kaisers Geburtstag gewesen, es ist nicht so scharf heute Abend, die sind alle noch nicht ausgemustert.“ Wir beide hauten ab, amüsierten uns für die drei Mark so gut es ging und kamen dann so recht lustig, als alles in den Hängematten schlief, gegen 11 Uhr an Bord. Mein Heini wollte nun noch Tee trinken, dazu benutzte er den großen Mannschaftskessel. Als er nun hiermit fertig war, stand er vor mir, wie ein Waschlappen. Ich nahm den Kessel und goss ihm den Tee vorne in das offene Hemd, so das es unten aus der Hose wieder herauslief. Diese Komödie hatte sich der wachhabende Maat, welcher im Dunkeln stand, angesehen. Er hätte uns auch nichts gesagt, wenn der Tee nicht in die Batterie an Deck gelaufen wäre. Nun sagte er zu mir: „Otte schwabern (das heißt auftrocknen) sie das wieder auf.“ Ich sagte zu dem Unteroffizier: „Das fällt mir gar nicht ein.“ Er wiederholte seinen Befehl noch dreimal, aber ich war zu starrköpfig und tat es nicht. Er wollte dann mit mir zum wachhabenden Offizier, wo er dann zu mir sagte, der wachhabende Offizier ist nicht zu finden, melden sie sich morgen früh beim Frühstück. Dieser Unteroffizier hatte noch keine Soldaten zur Bestrafung gemeldet und es war auch nicht seine Absicht mich zu melden, aber ich war ja zu starrköpfig. Den anderen Morgen, bei Backen und Banken, ging er immer an unserer Deckschaft hin und her. Meine Kollegen sagten zu mir, gehe doch hin und melde dich, sonst holst du dir 14 Tage strengen Arrest weg. Er wollte nur haben, ich sollte mich entschuldigen und das wollte ich nicht. Zuletzt rief er mich heraus und meldete mich beim wachhabenden Offizier, der mich natürlich sofort in Rapport stellte. Gegen Mittag in der Rapportzeit standen wir mit mindestens 10 Mann, der eine hatte dies der andere das ausgefressen. Neben mir wurde ein Rekrut mit 8 Tagen mittelschwer verknackt, weil er einem Unteroffizier den Gehorsam verweigert hatte. Nun kam ich an der Reihe, ein ganzes abgefasstes Protokoll wurde mir erst vorgelesen, in dem mir direkte Gehorsamsverweigerung vorgeworfen wurde. Unser Kommandant, Kapitän zur See Eichstätt, ein langer hagerer älterer Mann, meinte zwar zu mir: „Wie kommen Sie dazu, mit einem direkten „Nein“ zu antworten?“ Ich sagte: „Herr Kapitän, den Tag vor Kaisers Geburtstag habe ich so gefeiert, dass ich den anderen Tag glaubte, es käme nicht so genau drauf an.“ Der Kapitän meinte: „Ich kann Sie eigentlich nicht mit unter 14 Tagen strengem Arrest bestrafen, aber weil Kaisers Geburtstag gewesen ist, erhalten Sie, gerade wie die Rekruten, 8 Tage Mittelarrest.“
Ich nahm dann am Nachmittag mein Kommisbrot und den Utensilienkasten untern Arm und marschierte unter Bewachung nach der Hökerstraße und riss hier meine 8 Tage Militärpension ab.
So liefen die Tage lustig weiter. Alljährlich gab es eine Kieler Woche, das war so richtig die Vergnügungswoche für die Marine. Fast sämtliche Kriegsschiffe wurden zu dieser Woche nach Kiel kommandiert. Hier gab es in der Kieler Bucht Segelregatten, Wettrudern und allen möglichen Wassersport, wobei auch natürlich die Mitglieder der kaiserlichen Familie nicht fehlten. An Land fanden ein großer Jahrmarkttrubel und andere Vergnügungen statt.
dieser Gelegenheit waren meine Kollegen aber schon weiter gegangen, so dass ich allein da stand. Diese Drei nahmen die Sache krumm und schlugen auf mich ein, wobei einer derselben ein Messer nahm und mir einen Stich übers Auge versetzte. Mein Glück war nun, dass ich noch laut „BRANDENBURG“ rufen konnte. Diesen Ruf haben meine Kollegen gehört und haben mich dann an Bord transportiert, wo ich nicht eher wieder zu Verstand kam, als bis die Ärzte mich in den Fingern hatten. Der Matrose Mielke, welcher den Ärzten bei der Operation behilflich sein sollte, wurde ohnmächtig. Die Ärzte sagten zu ihm: „Der Matrose Otte ist bei klarem Verstand und Sie machen schlapp.“ Der Oberstabsarzt hatte großes Interesse an meiner Wunde. Der Messerstich war nämlich tief eingedrungen bis auf einen Millimeter vor dem Sehnerv, und so freute er sich, dass ich mein Augenlicht behielt und die Wunde Tag für Tag besser zuheilte. Nach einigen Wochen Lazarettzeit konnte ich dann wieder als geheilt entlassen werden.
Eines Abends gingen wir mit unseren Kollegen an Land. Als wir uns ausgetobt hatten, rief uns das Ende der Urlaubszeit wieder an Bord. An der Brücke stand ein Mann, der heiße Wurst verkaufte. Vor dem Tisch des Wurstmanns standen drei Soldaten mit dem Namen „SMS Pelikan“ an der Mütze (es war Soldatenmode, gleich nach der Mütze zu sehen). Diese drei Soldaten hatten den Wurstmann zum Gespött gemacht, indem sie ihm Senf an die Nase geschmiert hatten. Ich sagte nun aus Spaß zu diesen Dreien, sie sollten doch den Mann nicht zum Narren halten. Bei
Im Winter 1896 lagen wir mit unserer „BRANDENBURG“ in der Werft in Wilhelmshaven zur Reparatur. Da das Schiff nun nicht außer Dienst gestellt wurde, ging der ganze Borddienst vorschriftsmäßig weiter. An einem Vormittag wurde die Wache rausgepfiffen. Der Kaiser von Russland besichtigte die Kriegswerft und musste dabei an unserem Schiff vorbei. Er war in Begleitung unseres deutschen Kaisers. Wir hatten uns befehlsgemäß quer über den vorderen Teil des Schiffes zu stellen, so dass wir vier Spielleute am ersten Flügel standen, ich als erster rechter Flügelmann. Bei dem Kommando „Achtung, präsentiert das Gewehr“ hatten wir unsere Flöte an den Mund zu setzen und den Präsentiermarsch zu spielen. Hierbei hatte ich nun das Unglück, dass mir das eine Ende der Flöte über Bord flog. Mein Kollege, der andere Hornist, ebenso die beiden Trommler, merkten dies und selbstverständlich taten die ihr Bestes, damit niemand etwas merkte. Unser Offizier stand ja mit dem Rücken zu uns und so merkte der auch nichts. Als es nun hieß: „Die Wache wegtreten!“, fiel mir ein Stein vom Herzen und wir vier Spielleute haben uns nur angeguckt. Hätten wir uns beim Spielen des Präsentiermarsches wegen meiner Flöte blamiert, dann hätte ich mindestens vier Wochen Arrest, wenn nicht sogar strengen, aufgebrummt bekommen. Ich ging denselben Abend schnell an Land und kaufte mir für zwei Mark eine neue Flöte.
Die schönste Freude für uns Soldaten war der Urlaub, und den gab es vor und nach Weihnachten. Den ersten Urlaubstörn gab es vom 15. bis 31. Dezember, den zweiten vom 1. Januar bis 24. Januar. Unsere Uniform saß schnucke, zu unserer Galauniform gehörte ein weißes Paradehemd, darüber die hübsche Jacke mit 6 goldenen Knöpfen, dann der schöne Marinekragen, zusammengezogen mit einem schönen seidenen Tuch. Ich hatte als Spielmann auf beiden Armen unten zwei schöne gelbe Winkel. So waren wir dann auf Urlaub sehr beliebt bei jung und alt und wurden allenthalben freundlich aufgenommen.
Im Jahre 1897 holte ich mir noch so gelegentlich vier Tage Mittelarrest wegen Urlaubsüberschreitung weg, und das konnte den Besten passieren. Wir hatten uns in Kiel amüsiert und unser Urlaub ging bis 12 Uhr nachts. In Kiel lagen wir mit unserem Schiff auf Reede an Bojen festgemacht. Die beurlaubte Mannschaft wurde mit Dampfpinassen weggebracht und auch wiedergeholt. Als ich nun aus der Stadt an die Bellevuebrücke kam, war das Urlaubsboot schon weg. Es war Sommertag, ich setzte mich in einen Rosenbusch und schlief ein. Den anderen Morgen um 6 Uhr fanden mich die Decksoffiziere, die bis dahin Urlaub hatten, dort schlafen und nahmen mich natürlich mit an Bord. Mittags zum Rapport erhielt ich vier Tage Mittelarrest wegen Urlaubsüberschreitung von 6 Stunden.
So lief dann mein Dienstjahr 1897 auch so recht fidel dahin, aber die Tage der Entlassung rückten näher, und so zählte ich schon die Tage und Stunden. Am 1. April 1898 war mein Entlassungstermin. Da ich nun außerterminlich einberufen worden war, war ich der Einzige von der ganzen Besatzung von 610 Mann, der entlassen wurde.
Wir lagen mit unserer „Brandenburg“ in Kiel und sollten am 22. März, einem Montagmorgen, nach der Eckernförder Bucht zum Torpedoschießen dampfen. Dieses Schießen dauerte mehrere Tage und darum wurde ich eher entlassen. Den Sonntag bekam ich meine Entlassungspapiere und sollte dann am Montagmorgen, ehe das Schiff in See ging, abreisen.
Den Sonntagnachmittag wurde Abschied gefeiert. Ich ging zum ersten Offizier Bäcker und erklärte ihm, dass ich entlassen würde, und fragte ihn, ob ich nicht die Erlaubnis bekommen könnte, ein Fass Bier anzulegen. „Was“, sagte der erste Offizier, „Sie wollen uns verlassen. Das geht nicht, Sie müssen hier bleiben.“ Er sah aber wohl ein, dass alles nichts half und meinte: „Holen Sie sich man zwei Fass Bier und feiern Sie ihren Abschied man tüchtig.“ Er drückte mir recht kräftig die Hand, aber ich konnte es nicht unterdrücken, dass mir eine Träne aus dem Auge rollte, ebenso schien er sich bedrückt umzudrehen.
Den Sonntagnachmittag wurde dann in der Batterie auch tüchtig gefeiert. Meine Kollegen, die Musiker, waren zuletzt so hin, dass sie anders nichts spielten als: „Muss ich denn, muss ich denn zum Städtele hinaus.“
Den Montagmorgen wurde ich früh geweckt und mit einer Pinasse an Land gesetzt. Meinen Zeugsack expedierte ich nach Berne zu meinen Eltern. Um 4.15 Uhr früh fuhr ich von Kiel ab mit dem Ziel nach Bremen. Hier besuchte ich zuerst meine Cousine Katarine Maier, sie war schon verheiratet mit Willy Behrens. Als ich sie begrüßte, meinte sie zu mir: „Du hast ja gar nicht so ein langes Mützenband wie die anderen Mariner, wenn die entlassen werden.“ „Ja“, sagte ich, „Katarine, das habe ich auch ganz vergessen.“ Wir gingen in ein Putzgeschäft und kauften drei Meter Band, das Meter zu 50 Pfg. Katarine machte es mir um die Mütze, und fertig war der Reservist.
In Bremen bin ich dann ein paar Tage bei Behrens gewesen und reiste dann nach Berne. Hier wurde nun natürlich noch tüchtig nachgefeiert. Alle Verwandten und Bekannten wurden besucht und alle freuten sich über meine schmucke Uniform. Dann hieß es wieder in das alltägliche Zivilleben einzutreten.
Wieder Matrose auf Dampfern
Ich reiste zuerst nach Bremen und bekam auch sofort einen Platz auf dem kleinen Argodampfer „Richer“. So fuhr ich denn von 1898 bis 1901 auf verschiedenen Dampfern der Argo- und Neptunreederei.
Eine Ausnahme-Reise wurde in dieser Zeit gemacht, die nicht unerwähnt bleiben soll. Die Matrosenheuer betrug in diesen Jahren 55 Mark. Eines Tages bot mir der Heuerbaas Möhlenbrock eine Chance auf einem englischen Dampfer mit Namen „LABUAN“ an. Da die Heuer auf englischen Schiffen 3 Pfund 15 = 75 Mark betrug, lockte mich diese Chance ja furchtbar an. Der Kapitän dieses Dampfers und der Heuerbaas wollten aber ihr Geschäft machen, indem sie sagten, die Reederei wolle nicht mehr als 70 Mark geben. Diese ganze Unterredung zwischen mir und dem Heuerbaas (auch der Kapitän war zugegen) war in der Morgenzeit. Ich gab den beiden nun zu verstehen, dass wir nicht unter der regulären englischen Heuer mustern würden, ich mir weitere andere 5 Kollegen suchen würde, und wir kämen den Nachmittag um 3 Uhr wieder.
Ich logierte seinerzeit in der Gröblingstraße bei Gastwirt Pförtner. Es dauerte auch nicht lange, so hatte ich 5 Kollegen gefunden, die gerne Lust dazu hätten. In der Gage waren wir uns einig wie Pech und Teer. Wir hatten uns fest verabredet, gäben sie uns keine 75 Mark, dann gehen wir geschlossen wieder weg.
Als wir nun um 3 Uhr beim Heuerbaas kamen, saß auch der Kapitän da. Der Heuerbaas Möhlenbrock fragte uns nun, ob wir für 3 Pfund, also 70 Mark fahren wollten. Wir gaben ihn eine strikte Antwort, in dem wir sagten, wenn wir die reguläre Gage von 75 Mark nicht bekommen, dann gehen wir alle wieder raus. Der Kapitän klappte bei und sagte zum Heuerbaas: „Nehmen sie die Leute man so.“ Also wir hatten unser Fell auf einen englischen Dampfer verkauft.
Den anderen Morgen mussten wir nun alle an Bord. Der zweite Steuermann verteilte die Arbeit. Das Kommando war englisch, und da meine Kollegen kein Englisch konnten, verstanden sie auch nicht, was er sagte. Das erste Kommando hieß auf englisch: „Clean the rooms“. „Watt“, sagte mein Kollege, „kriegt wie een lüttjen Rum?“ „Nee“, sagte ich zu ihm, „wie schält dee Laderums saubermaken.“ So gab es in dieser Beziehung noch manche zu belachende Episode. Da ich nun der englische Sprache ziemlich mächtig war, musste ich dauernd den Dolmetscher spielen, oder wenn ich nicht zur Stelle war, ging es gar per Fingersprache.
Den ersten Mittag war uns schon die Petersilie verhagelt, es gab nämlich frische Suppe mit Pellkartoffeln und diesen Fraß waren wir auf deutschen Schiffen nicht gewohnt. So ging es in Streitigkeiten gegenüber dem Kommando von der Ausreise bis nach Bombay (Ostindien), wohin wir eine Ladung Kohlen brachten. Da ich nun am besten englisch sprechen konnte, sollte ich den Kapitän, beim Konsul verklagen. Die Klage lautete auf Beschäftigung außerhalb der Mahlzeit.
Als ich nun mit meinen Klagen beim Konsul ankam (natürlich in englisch) meinte der zu mir: „Sie haben das noch viel zu gut an Bord gehabt.“ Dies empörte mich nun ganz furchtbar. Ich suchte die nächste Behörde auf, und das war der englische Magistrat. Ich hatte nun auch glücklich das Gebäude gefunden und ging hinein, um stolz und kühn für mich und meine Kollegen unser Recht zu suchen. Aber, meine Herren, was machte ich für Augen, als ich, anstatt den Magistrat zu sehen, in einen großen Saal trat, wo wohl tausend schwarze Eingeborene zur Aburteilung, teils in Ketten gelegt, teils in Käfigen eingesperrt waren. Bei diesen Aburteilungen war es den Europäern erlaubt, dieses Schauspiel anzusehen. Auf der Richtertribüne saßen nur zwei Personen. Der eine erteilte die Strafen und der schrieb sie in ein Buch. Jeder Sträfling wurde von einem (weißen) englischen Schutzmann vor die Richtertribüne geführt. Der Schutzmann erzählte, was der Angeklagte ausgefressen haben sollte, und nach einem Zeitraum von 2 bis 3 Minuten fiel schon das Urteil. Der Eingeborene kam überhaupt nicht zu Wort. Ich konnte leider nicht viel verstehen, denn ich war zu weit weg vom Richtertisch. So viel habe ich aber gehört, einige bekamen als Strafe verschiedene Schläge über den Rücken. Das heißt, dafür gab es extra ein Zimmer, wo sie sofort hinein geführt wurden. Diejenigen, die nun schwere Strafen erhalten hatten, kamen in die Arbeitsverbannung, wo sie dann wohl zu Tode gequält worden sind.
Als ich dies nun alles gesehen hatte, hatte ich die Nase voll. Ich machte mich schleunigst auf den Weg und ging an Bord zurück. Hier empfingen mich meine Kameraden in der Hoffnung, dem Kapitän einen tüchtigen Denkzettel gegeben zu haben. Als ich ihnen nun mein ganzes Abenteuer erzählt hatte, waren sie natürlich bedrückt. Sie schworen nun Stein und Bein, ihm in Hamburg (die Reise ging zurück nach Hamburg) eins auszuwischen.
Als wir nun in Hamburg ankamen, gingen wir sofort zum Kapitän und verlangten alle Mann, vor den englischen Konsul geführt zu werden. Unsere Gedanken waren nun: „Jetzt sind wir in Deutschland und nun wollen wir dich schon kriegen!“ Der Kapitän gab uns die Order, ein Mann kann zum Konsul gehen und die anderen müssen an Bord bleiben. Wir waren aber ja nicht zu halten. Ein jeder warf sich in seinen Sonntagsanzug, und alle gingen zum Konsul. Als wir dort ankamen, war unsere Abrechnung schon fertig gemacht, natürlich mit einem Abzug von einem halben Monat wegen Strafe für unerlaubte Entfernung von Bord. Wir waren nun alle kuriert und fuhren niemals wieder auf einem englischen Schiff.
Lloyd-Salondampfer „GLÜCKAUF“
Im Jahre 1901 musterte ich am 1. Juni als Matrose auf den Salondampfer „GLÜCKAUF“. Dieser Lloyd-Salondampfer war neu gebaut und trat seine erste Reise an. Im Allgemeinen war auf diesem Salondampfer ein schönes Fahren. Unser Kapitän hieß Hofers, der Steuermann Heidmüller. Die Besatzung bestand aus 17 Mann: Kapitän, Steuermann, 4 Matrosen, 1 Junge, 2 Maschinisten, 1 Oberheizer, 4 Heizer, 1 Koch und 2 Stewards. Im Allgemeinen war es ja für uns Mannschaft am besten, wenn wir bei den Lustfahrten schönes ruhiges Wetter hatten. Dieses ja ist auch leicht zu verstehen, weil bei schlechtem Wetter der größte Teil der Passagiere seekrank war, und wir hatten dann viel Arbeit davon.
Wie ich schon erwähnte, war die „GLÜCKAUF“ ein Salondampfer und kein normaler Seedampfer, vielmehr er konnte mit vielen Passagieren keinen schweren Sturm durchstehen. Somit hatten wir auch Gelegenheit, mit unseren Passagieren in Streit zu kommen. Eine gediegene Reise will ich schildern. Im Jahre 1906 wurde ich im Oktober Steuermann, und so trug ich die Verantwortung ja sozusagen für alles mit. An einem schönen Sommertag im Monat Juli im Jahre 1907 sollten wir eine Lustfahrt von Bremerhaven nach Helgoland machen. Der Zug von Bremen lief 8.30 Uhr morgens an der Lloydhalle ein. Die Passagiere, die wir nun mitnehmen sollten, gehörten zu einem Bremer Verein und man hatte unter anderem auch viele Leute von Hannover eingeladen. Der Wind kam kräftig aus West, und es war schöner Sonnenschein. Schon bei der Abfahrt meinte der Kapitän zu mir: „Datt is ne harte Brise, wenn wie dor man henkamt.“ Als wir den Hoheweg-Leuchtturm quer hatten, zeigte es vom Turm Windstärke 9. Diese Windstärke war für einen Salondampfer auf offener See zu viel. Der hohe Seegang war bei Hoheweg noch nicht zu merken, weil wir unter dem Schutz der Oldenburger Küste und Wangerooge fuhren. Der Kapitän sagte zu mir: „Wir wollen halbwegs nach Rotersand fahren, und dann drehen wir um und fahren wieder nach Bremerhaven.“ Ich wusste ja nun Bescheid, sagte den Passagieren aber nichts. Als wir nun im schönsten Drehen waren, fragten sie mich: „Warum drehen wir eigentlich um?“ Ich musste ja nun mit der Sprache heraus und erklärte ihnen, dass das Wetter zu schlecht sei und es auf offener See sehr gefährlich sei umzudrehen. Nun ging das Spektakel los. Am schlimmsten waren die Damen, die hätten mich am liebsten aufgefressen. Feigling und alle solche Titel bekam ich zu hören. Ich erklärte ihnen dann, sie möchten sich doch beim Kapitän beschweren, der hätte doch die Verantwortung für das Schiff. Es nahm aber ja kein Ende mit dem Krawall. „Da kommt man von Hannover her, um Helgoland zu sehen, und sie fahren einen auf der Weser spazieren“, bekam ich zu hören. Endlich kam der Vorstand an mich heran und fragte mich, aber in einem anständigen Ton. Ich erklärte den Herren die Sache ganz genau und meinte dann zu ihnen: „Meine Herren, gehen sie doch mal auf die Kommandobrücke und sprechen mit dem Kapitän.“ Unser Kapitän, wie immer ein barscher Mann, gab dann dem Vorstand eine sehr parate Antwort, indem er meinte, das wolle er wohl wissen, ob er umdrehen müsse oder nicht. Diese grobe Entgegnung gegenüber den Vorstand konnte selbstverständlich von den Leuten nicht hingenommen werden. Der Vorstand beschwerte sich bei der Reederei über ihn. Wenn nun auch das Umdrehen voll in Kapitän Hofers Kompetenz stand, er durfte aber dem Vorstand nicht so grob kommen. Er erhielt dafür 4 Wochen Strafurlaub, wovon ihm dann anschließend 14 Tage geschenkt wurden.
Auch sonst erlebten wir auf unserem Salon- und Passagierdampfer gediegene Dinger. Wie sich leicht denken lässt, waren die Toiletten bei uns immer ein Schmerzenskind. Es ist ja auch leicht zu verstehen, dass bei einem mit über 1.000 Menschen voll besetzten Schiff die Toiletten oft nicht ausreichten. Zu diesem Übel kam dann auch noch, dass Seekranke dieser Örtlichkeiten aufsuchten und in die Urin- und Waschbecken hineinkotzten, so dass es in den Toiletten oft ganz übel aussah und stank. Es wurde ja nun alles aufgeboten, um möglichst Ordnung zu halten, und es wurde deswegen auch bei jeder Fahrt extra ein Arbeitsmann mitgenommen, der nur die Toiletten zu bewachen hatte. Wir an Bord hatten dafür den alten Arbeiter Hinnerk Sterblock. Er stand immer treu seinen Posten im Gang bei den Toiletten. Musste mal einer ein Handtuch gebrauchen, schon sprang er schnell zur Halle, um ein kleines Trinkgeld zu ergattern.
In einem unbewachten Augenblick hatte sich eine Dame in der Toilette eingeriegelt. Es standen nun mehrere Damen vor der Tür und wollten in die Toilette, aber die Tür war ja zugeriegelt. Die Damen beschwerten sich bei Hinnerk. Was sollte der Mensch nun machen? Er schlug mit beiden Fäusten gegen die Tür und brüllte wie ein Löwe, die Dame, die da drin war, solle aufmachen. Die Tür jedoch war zu und blieb zu. Hinnerk kam zu mir und erzählte mir die ganze Sache. Als ich nun bei der Damentoilette ankam, sah ich schon, wie die Damen hin und her wackelten. Ich wusste mir nun anders keinen Rat und sagte zu Hinnerk, er solle sie auf das Mannschaftsklosett, Offizier- und Herrenklosett schicken, aber gut aufpassen, dass die Sache nicht durcheinander geht. Ich musste ja nun Ordnung schaffen. In dieser Damentoilette war durch das Schlüsselloch nichts zu sehen. Es war die Lage nun nur von Außenbord her zu klären. Hier guckte ich durch ein Bullauge und sah, wie die Dame wie Tod vor der Tür lag. Zu allem Glück war das Bullauge auf. Ich rief in die Toilette hinein, erhielt aber keine Antwort von der Dame. Hineinkriechen konnte ich nicht, denn das Bullauge war zu klein für mich. Man hat aber meistens noch immer Glück im Unglück. Ich holte mir unseren Decksjungen, und da der klein und dünn war, musste er dieses Theaterstück ausführen. Ich schob ihn zuerst mit dem Kopf hinein, und die Beine kamen dann ja von selbst durch. Er schob den Riegel zurück und als ich die Tür öffnete, lag die Dame langgestreckt auf dem Boden. Ich fragte sie, was ihr fehle. Sie gab mir keine Antwort. Wir haben sie dann in den Damensalon gebracht und die Tür abgeschlossen. Die Toilette war wieder frei und alles ging seinen Weg so weiter. Nach einem guten Zeitraum kam Hinnerk wieder bei mir an und sagte: „Die eine Toilette ist ganz und gar verstopft.“ Ich sagte zu ihm: „Du musst mal einen Reitstock nehmen und damit durchstaken.“ „Ja“, sagte Hinnerk, „ich habe all mit dem Besenstiel darin rumgestochert, aber darin steht immer noch so watt Ekeliges.“ Ich musste nun wohl oder übel die Arbeit selbst in die Hände nehmen. Ich dirigierte die Damen wieder auf die andere Toilette und schloss die Tür hinter mir von innen zu. Die Jacke wurde ausgezogen und los ging die Arbeit. Das heißt, eine Ahnung hatte ich schon, was es wohl ungefähr war, als Hinnerk mir sagte, er hätte mit dem Besenstiel auf was Weiches gestoßen. Ich krempelte meine Arme auf und hinein in die Mördergrube. Ich brauchte auch nicht lange zu suchen, denn ich fühlte, dass hier ein kleines Wesen drin war. Es blieb mir nun ja nichts anderes über, die Tür wieder zu verschließen und dem Kapitän Bericht hierüber zu erstatten. Er meinte nun zu mir: „Wenn wir in Bremerhaven ankommen, müssen wir der Polizei hiervon Meldung machen, denn“, meinte er, „diese Dame hat doch das Kind gemordet.“ Als wir in Bremerhaven landeten, stand der Zug für Bremen schon abfahrbereit. Die Passagiere gingen von Bord und gleich wieder in den Zug hinein. Zur gleichen Zeit ließ sich auch ein Schutzmann sehen. Diesem wurde die Sache unterbreitet, worauf er meinte: „Dann müssen wir sie ja festnehmen.“ Wir schritten mit dem Schutzmann zum Damensalon und als wir ihn öffneten, war der Vogel bereits ausgeflogen, und da der Zug schon abgefahren war, war nichts mehr zu wollen. Wir erhielten vom Schutzmann die strenge Order, die Toiletten scharf zu bewachen, damit da niemand hinein käme. Den anderen Tag kamen zwei Polizeibeamte und zwei Arbeitsleute (Jauchleute). Das ganze Porzellanbecken wurde abgeschraubt und mit einem Hammer zerschlagen, so dass sich das neugeborene männliche Wesen vor unseren Augen zeigte. Es war voll und ganz ausgewachsen, nur die Stellen waren zu sehen, wo Hinnerk mit dem Besenstiel hineingestoßen hatte. Das Kind wurde von Bord geholt und kam nach der Quarantäneanstalt. Wie die weiteren polizeilichen und gerichtliche Ermittlungen liefen, sind wir nicht gewahr geworden.
Familiengründung
Nach meinen Erlebnissen vom Jahr 1907 muss ich zurückgreifen auf mein Familienleben. Nach einem Verkehr von zwei Jahren beschloss ich mit meiner lieben Braut, Johanne Büsing, eine Familie zu gründen. Meine Braut war bei Käufer Blome am Siegesplatz in Stellung. Am 8.1.1905 hatten wir uns verlobt und am 6. Mai 1906 war die Hochzeit. Wir hatten es uns in unserem Ehestand zum Ziel gesetzt, sparsam zu wirtschaften, hiernach hatten wir auch schon die Hochzeit eingerichtet. Es war ja auch leicht zu machen, denn wir waren vollständig fremd im Dorfe.
Die Hochzeit wurde so recht gemütlich gefeiert unter uns beiden und mit unseren Müttern. Um möglichst billig zu wohnen (120 Mark jährlich), zogen wir in ein altes Strohdachhaus (Besitzer Brog). Kaum hatten wir ein Jahr gewohnt, wurde uns das Haus unter den Füßen verkauft. Wir zogen dann nach Buchholz, wieder in ein Strohdachhaus. Da wir immer sparsam lebten, hatten wir uns schon verschiedene Möbel angeschafft.
Als wir dort zirka 6 Monate gewohnt hatten, klagte meine Anni mir, das es so furchtbar räuchern würde. Sie meinte auch, in unserer Stube sei es zuweilen voller Rauch. Aber es war gediegen, immer wenn ich zu Hause war, war alles bestens in Ordnung. Eines Tages, als Anni auf dem Kartoffelacker war, kam ich nachmittags nach Hause. Nun offenbarte sich mir ein Schreckensbild. Die Stube war voller Qualm. Es war so schlimm, dass ich nicht einen einzigen Gegenstand sehen konnte. Ich sprang zuerst nach den Fenstern und warf diese auf. Hiernach suchte ich dann nach Buchholz, der war nicht zu finden. Aber ich traf Frau Buchholz, zeige ihr die Rauchgeschichte und sage ihr: „Frau Buchholz, ich ziehe sofort aus ohne zu kündigen, das ist keine bewohnbare Wohnung.
Nun war guter Rat teuer. Als Anni nach Hause kam, erzähle ich ihr die Angelegenheit und die meinte zu mir: „Ick sech di datt jo all ümmer, aber du wullst mie datt ja nich soo globen.“ Ich sagte zu ihr: „Ja liebe Deern, wie fangt mit schönen Pech an.“ Aber es waren ja Wohnungen mit Kusshand zu kriegen. Wir zogen dann sofort wieder in Borgs neues Haus. Oben Stube, Kammer und Küche. Hier war nun eigentlich ein schönes Wohnen, denn wir hatten die Front nach der Straße. Aber bei allem ist ein Haken. Der Besitzer des Hauses Borg war ein verheirateter Mann und hielt sich eine geschiedene Frau als Haushälterin (Frau Hinrichs). Diese Frau tat aber, als wenn sie Eigentümerin wäre. Es kam zuletzt so weit, dass meine Anni sie ungefähr mit einem Schrubber über den Kopf gehauen hätte. Es wäre mit der Zeit auch nicht klargegangen, und warum sollte sich meine Anni denn immer über dieses Miststück ärgern, zumal meine Anni auch in gesegneten Umständen war.
Am 8. April 1908 wurde uns ein kleines Töchterchen geschenkt. Wir gaben ihr den Namen unserer Mütter, von meiner Seite Margarete und von Annis Seite Sophie. Den folgenden Tag ging ich morgens besorgt an Bord. Als ich aber wieder nach Hause kam, rief Sperling (die wohnten in dem selben Haus im Parterre) mir schon zu: „Arnd, du häst een lütjen Jung kreegen.“ Ich konnte die Treppen nicht schnell genug raufkommen und zu meinem Erstaunen hatte meine Anni ihr kleines Baby im Arm, freute sich und war guten Mutes.
Mein Verdienst war in diesen zwei Jahren ja allerhand gestiegen, und so entschlossen wir uns (ich und Sperling) uns selber ein Haus bauen zu lassen. Wir kauften von dem alten Ohmstädt (Leonhard Lührs’ Schwiegervater) zirka 4.000 qm Land auf dem Blink, zwischen Kirchhof und Hollwegs und ließen uns jeder ein Einfamilienhaus hierauf setzen, wo wir im Herbst einzogen. Nun konnte meine Anni schalten und walten wie sie Lust hatte. Wer ihr zu nahe kam, kriegte welche mit dem Besenstiel. Hier lebten wir nun so recht gemütlich, aber Arbeit in Hülle und Fülle.
| Am Sonntag, dem 9. November 1952, entschlief nach schwerer Krankheit im 81. Lebensjahr mein lieber Mann, unser lieber
Vater, Schwiegervater, Großvater, Urgroßvater, Bruder und Schwager, der Schiffsführer des NDL i.R.
Arnold Otte
In stiller Trauer:
Johanne Otte, geb. Büsing,
Friedrich Bösentahl und Frau Grete, geb. Otte,
Paul Richters und Frau Amanda, geb. Otte,
Enkelkinder und Urenkel
Spaden, den 9. November 1952
Die Beerdigung findet am Mittwoch, dem 12. November um 15 Uhr von der Spadener Friedhofskapelle aus statt.
(Mitglied des Vereins der Oldenburger, Lehe)
|
Weitere maritime Texte mit Erlebnissen von See werden gesucht! - Kontakt
Schiffsbilder
maritime Buchreihe
Seeleute
Seefahrtserinnerungen - Seefahrtserinnerungen - Maritimbuch
Informationen zu den maritimen Büchern des Webmasters finden Sie hier:
zur gelben Zeitzeugen-Bücher-Reihe des Webmasters:
© Jürgen Ruszkowski

zur gelben Zeitzeugen-Bücher-Reihe des Webmasters:
© Jürgen Ruszkowski
Maritime books in German language: fates of international sailors
Los libros marítimos en el idioma alemán: los destinos de marineros internacionales:
zu meiner maritimen Bücher-Seite
navigare necesse est!
Maritime books in German language: fates of international sailors
Los libros marítimos en el idioma alemán: los destinos de marineros internacionales:
Diese Bücher können Sie direkt bei mir gegen Rechnung bestellen: Kontakt:
Zahlung nach Erhalt der der Ware per Überweisung.
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
Zahlung nach Erhalt der der Ware per Überweisung.
Bücher in der gelben Buchreihe" Zeitzeugen des Alltags" von Jürgen Ruszkowski:
|
Seemannsschicksale
Band 1 - Band 1 - Band 1 - Band 1
Begegnungen im Seemannsheim
ca. 60 Lebensläufe und Erlebnisberichte
von Fahrensleuten aus aller Welt

http://www.libreka.de/9783000230301/FC
libreka.de: unter Ruszkowski suchen!
13,90 € - Bestellung -
|
Seemannsschicksale
Band 2 - Band 2
Lebensläufe und Erlebnisberichte

Lebensläufe und Erlebnisberichte von Fahrensleuten, als Rentner-Hobby aufgezeichnet bzw. gesammelt und herausgegeben von Jürgen Ruszkowski
http://www.libreka.de/9783000220470/FC
libreka.de: unter Ruszkowski suchen!
13,90 € - Bestellungen -
|
Seemannsschicksale
Band_3
Lebensläufe und Erlebnisberichte

Lebensläufe und Erlebnisberichte von Fahrensleuten
http://www.libreka.de/9783000235740/FC
libreka.de: unter Ruszkowski suchen!
13,90 € - Bestellungen -
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
|
|
Edition 2004 - Band 4
Seemannsschicksale unter Segeln

Die Seefahrt unserer Urgroßväter
im 19. Jahrhundert und am Anfang des 20. Jahrhunderts
13,90 €
- Bestellungen -
|
Band 5
Capt. E. Feith's Memoiren:

Ein Leben auf See
amüsant und spannend wird über das Leben an Bord vom Moses bis zum Matrosen vor dem Mast in den 1950/60er Jahren, als Nautiker hinter dem Mast in den 1970/90er Jahren berichtet
http://www.libreka.de/9783000214929/FC
libreka.de: unter Ruszkowski suchen!
13,90 € - Bestellungen -
|
Band 6 ist geplant
Leseproben und Bücher online
Seemannsschicksale
maritimbuch
Schiffsbild - Schiffsbild
Schiffsbild
erwähnte Personen
- erwähnte Schiffe -
erwähnte Schiffe E - J
erwähnte Schiffe S-Z
|
|
Band 7
in der Reihe Seemannsschicksale:
Dirk Dietrich:
Auf See
ISBN 3-9808105-4-2
Dietrich's Verlag
Band 7
Bestellungen
Band 8:
Maritta & Peter Noak
auf Schiffen der DSR
ISBN 3-937413-04-9
Dietrich's Verlag
Bestellungen
|
Band 9
Die abenteuerliche Karriere eines einfachen Seemannes
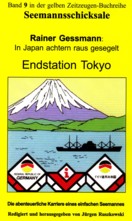
Endstation Tokyo
12 € - Bestellungen
|
Band 10 - Band 10
Autobiographie des Webmasters
Himmelslotse
Rückblicke: 27 Jahre Himmelslotse im Seemannsheim - ganz persönliche Erinnerungen an das Werden und Wirken eines Diakons

13,90 € - Bestellungen -
|
|
- Band 11 -
Genossen der Barmherzigkeit

Diakone des Rauhen Hauses
Diakonenportraits
13,90 € - Bestellungen -
|
Band 12 - Band 12
Autobiographie:
Diakon Karlheinz Franke

12 € - Bestellungen -
|
Band 13 - Band 13

Autobiographie:
Diakon Hugo Wietholz
13,90 € - Bestellungen -
|
|
Band 14
Conrad H. v. Sengbusch

Jahrgang '36
Werft, Schiffe, Seeleute, Funkbuden
Jugend in den "goldenen 1959er Jahren"

Lehre als Schiffselektriker in Cuxhaven
13,90 € - Bestellungen -
|
Band 15
Wir zahlten für Hitlers Hybris
mit Zeitzeugenberichten aus 1945 über Bombenkrieg, Flucht, Vertreibung, Zwangsarbeit und Gefangenschaft

Ixlibris-Rezension
http://www.libreka.de/9783000234385/FC
libreka.de: unter Ruszkowski suchen!
13,90 € - Bestellungen -
|
Band 16
Lothar Stephan
Ein bewegtes Leben - in den Diensten der DDR - - zuletzt als Oberst der NVA
ISBN 3-9808105-8-5
Dietrich's Verlag
Bestellungen
Schiffsbild
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
|
|
Band 17
Als Schiffskoch weltweit unterwegs


Schiffskoch Ernst Richter
http://www.libreka.de/9783000224713/FC
13,90 € - Bestellungen -
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seit
|
Band 18
Seemannsschicksale
aus Emden und Ostfriesland

und Fortsetzung Schiffskoch Ernst Richter auf Schleppern

http://www.libreka.de/9783000230141/FC
libreka.de: unter Ruszkowski suchen!
13,90 € - Bestellungen -
|
Band 19
ein Seemannsschicksal:
Uwe Heins

Das bunte Leben eines einfachen Seemanns
13,90 € - Bestellungen -
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
|
|
Band 20
ein Seemannsschicksal im 2. Weltkrieg

Kurt Krüger
Matrose im 2. Weltkrieg
Soldat an der Front
- Bestellungen -
|
Band 21
Ein Seemannsschicksal:
Gregor Schock

Der harte Weg zum Schiffsingenieur
Beginn als Reiniger auf SS "RIO MACAREO"
13,90 € - Bestellungen -
|
Band 22
Weltweite Reisen eines früheren Seemanns als Passagier auf Fähren,
Frachtschiffen
und Oldtimern
Anregungen und Tipps für maritime Reisefans

- Bestellungen -
|
|
Band 23
Ein Seemannsschicksal:
Jochen Müller

Geschichten aus der Backskiste
Ein ehemaliger DSR-Seemann erinnert sich
12 € - Bestellungen -
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
|
Band 24
Ein Seemannsschicksal:
Der maritime Liedermacher
Mario Covi: -1-
Traumtripps und Rattendampfer

Ein Schiffsfunker erzählt
über das Leben auf See und im Hafen
http://www.libreka.de/9783000221460/FC
libreka.de: unter Ruszkowski suchen!
13,90 € - Bestellungen -
|
Band 25
Ein Seemannsschicksal:
Der maritime Liedermacher
Mario Covi: -2-
Landgangsfieber und grobe See

Ein Schiffsfunker erzählt
über das Leben auf See und im Hafen
http://www.libreka.de/9783000223624/FC
libreka.de: unter Ruszkowski suchen!
13,90 € - Bestellungen -
|
|
Band 26
Monica Maria Mieck:


Liebe findet immer einen Weg
Mutmachgeschichten für heute
Besinnliche Kurzgeschichten
auch zum Vorlesen
- Bestellungen -
|
- Band 27 -
Monica Maria Mieck


Verschenke kleine
Sonnenstrahlen
Heitere und besinnliche Kurzgeschichten
auch zum Vorlesen
- Bestellungen -
|
- Band 28 -
Monica Maria Mieck:


Durch alle Nebel hindurch
erweiterte Neuauflage
Texte der Hoffnung
besinnliche Kurzgeschichten und lyrische Texte
ISBN 978-3-00-019762-8
- Bestellungen -
|
|
Band 29

Logbuch
einer Ausbildungsreise
und andere
Seemannsschicksale
Seefahrerportraits
und Erlebnisberichte
ISBN 978-3-00-019471-9
http://www.libreka.de/9783000194719/FC
13,90 € - Bestellungen -
|
Band 30
Günter Elsässer

Schiffe, Häfen, Mädchen
Seefahrt vor 50 Jahren
http://www.libreka.de/9783000211539/FC
- Bestellungen -
13,90 €
- Bestellungen -
|
Band 31
Thomas Illés d.Ä.
Sonne, Brot und Wein

ANEKIs lange Reise zur Schönheit
Wohnsitz Segelboot
Reise ohne Kofferschleppen
Fortsetzung in Band 32
13,90 €
- Bestellungen -
|
|
Band 32
Thomas Illés d.Ä.
Sonne, Brot und Wein
Teil 2

Reise ohne Kofferschleppen
Fortsetzung von Band 31 - Band 31
13,90 € - Bestellungen -
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
|
Band 33
Jörn Hinrich Laue:
Die große Hafenrundfahrt in Hamburg
reich bebildert mit vielen Informationen auch über die Speicherstadt, maritime Museen und Museumsschiffe

184 Seiten mit vielen Fotos, Schiffsrissen, Daten
ISBN 978-3-00-022046-3
http://www.libreka.de/9783000220463/FC
- Bestellungen -
|
Band 34
Peter Bening
Nimm ihm die Blumen mit

Roman einer Seemannsliebe
mit autobiographischem Hintergrund
http://www.libreka.de/9783000231209/FC
- Bestellungen -
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
|
|
Band 35
Günter George

Junge, komm bald wieder...
Ein Junge aus der Seestadt Bremerhaven träumt von der großen weiten Welt
http://www.libreka.de/9783000226441/FC
13,90 € - Bestellungen -
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
|
Band 36
Rolf Geurink:

In den 1960er Jahren als
seemaschinist
weltweit unterwegs
http://www.libreka.de/9783000243004/FC
13,90 €
- Bestellungen -
libreka.de: unter Ruszkowski suchen!
meine google-Bildgalerien
realhomepage/seamanstory
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
|
Band 37
Schiffsfunker Hans Patschke:


Frequenzwechsel
Ein Leben in Krieg und Frieden als Funker auf See
auf Bergungsschiffen und in Großer Linienfahrt im 20. Jahrhundert
http://www.libreka.de/9783000257766/FC
13,90 € - Bestellungen -
|
|
Band 38 - Band 38
Monica Maria Mieck:

Zauber der Erinnerung
heitere und besinnliche Kurzgeschichten
und lyrische Texte
reich sw bebildert
12 € - Bestellungen -
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
|
Band 39
Hein Bruns:


In Bilgen, Bars und Betten
Roman eines Seefahrers aus den 1960er Jahren
in dieser gelben maritimen Reihe neu aufgelegt
kartoniert
Preis: 13,90 €
Bestellungen
|
Band 40
Heinz Rehn:


von Klütenewern und Kanalsteurern
Hoch- und plattdeutsche maritime Texte
Neuauflage
13,90 € - Bestellungen -
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
|
|
Band 41
Klaus Perschke - 1 -
Vor dem Mast
1951 - 1956
nach Skandinavien und Afrika

Ein Nautiker erzählt vom Beginn seiner Seefahrt
Preis: 13,90 € - Bestellungen
|
Band 42
Klaus Perschke - 2 -
Seefahrt 1956-58

Asienreisen vor dem Mast - Seefahrtschule Bremerhaven - Nautischer Wachoffizier - Reisen in die Karibik und nach Afrika
Ein Nautiker erzählt von seiner Seefahrt
Fortsetzung des Bandes 41
13,90 € - Bestellungen
|
Band 43
Monica Maria Mieck:

Winterwunder

weihnachtliche Kurzgeschichten
und lyrische Texte
reich sw bebildert
10 € - Bestellungen -
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
|
|
Band 44
Lothar Rüdiger:

Flarrow, der Chief 1
Ein Schiffsingenieur erzählt
Maschinen-Assi auf DDR-Logger und Ing-Assi auf MS BERLIN
13,90 € - Bestellungen
Band 47
Seefahrtserinnerungen

Ehemalige Seeleute erzählen
13,90 € - Bestellungen
Band 50
Jürgen Coprian:
Salzwasserfahrten 2
Trampfahrt worldwide
mit
FRIEDERIKE TEN DOORNKAAT

- - -
Band 53:
Jürgen Coprian:
MS COBURG

Salzwasserfahrten 5
weitere Bände sind geplant
13,90 € - Bestellungen
|
Band 45
Lothar Rüdiger:

Flarrow, der Chief 2
Ein Schiffsingenieur erzählt
Fortsetzung des Bandes 44
Flarrow als Wachingenieur
13,90 € - Bestellungen
Band 48:
Peter Sternke:
Erinnerungen eines Nautikers

13,90 € - Bestellungen
Band 51
Jürgen Coprian:
Salzwasserfahrten 3

- - -
Jürgen Coprian:
Salzwasserfahrten 6
weitere Bände sind geplant
alle Bücher ansehen!
hier könnte Ihr Buch stehen
13,90 € - Bestellungen
|
Band 46
Lothar Rüdiger:

Flarrow, der Chief 3
Ein Schiffsingenieur erzählt
Fortsetzung des Bandes 44 + 45
Flarrow als Chief
13,90 € - Bestellungen
Band 49:
Jürgen Coprian:
Salzwasserfahrten 1

Ostasienreisen mit der Hapag
13,90 € - Bestellungen
- - -
Band 52 - Band 52
Jürgen Coprian:
Salzwasserfahrten 4
MS "VIRGILIA"
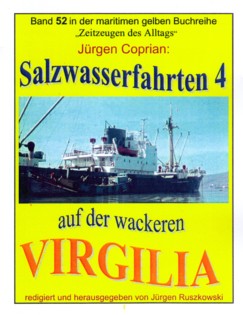
---
Band 56
Immanuel Hülsen
Schiffsingenieur, Bergungstaucher

Leserreaktionen
- - -
Band 57
Harald Kittner:

zeitgeschichtlicher Roman-Thriller
- - -
Band 58

Seefahrt um 1960
unter dem Hanseatenkreuz
weitere Bände sind in Arbeit!
|
Diese Bücher können Sie für direkt bei mir gegen Rechnung bestellen: Kontakt:
Zahlung nach Erhalt der der Ware per Überweisung.
|
Meine Postadresse / my adress / Los orden-dirección y la información extensa:
Jürgen Ruszkowski, Nagelshof 25,
D-22559 Hamburg-Rissen,
Telefon: 040-18 09 09 48 - Anrufbeantworter nach 30 Sekunden -
Fax: 040 - 18 09 09 54
Bestellungen am einfachsten unter Angabe Ihrer Anschrift per e-mail: Kontakt
|

|
Bücher in der gelben Buchreihe" Zeitzeugen des Alltags" von Jürgen Ruszkowski:
Wenn Sie an dem Thema "Seeleute" interessiert sind, gönnen Sie sich die Lektüre dieser Bücher und bestellen per Telefon, Fax oder am besten per e-mail: Kontakt:
Meine Bücher der gelben Buchreihe "Zeitzeugen des Alltags" über Seeleute und Diakone sind über den Buchhandel oder besser direkt bei mir als dem Herausgeber zu beziehen, bei mir in Deutschland portofrei (Auslandsporto: ab 3,00 € )
Bestellungen am einfachsten unter Angabe Ihrer Anschrift per e-mail: Kontakt
Sie zahlen nach Erhalt der Bücher per Überweisung.
Maritime books in German language: fates of international sailors
Los libros marítimos en el idioma alemán: los destinos de marineros internacionales:
Los libros en el idioma alemán lo enlatan también, ( + el extranjero-estampilla: 2,70 €), directamente con la editor Buy de.
Bestellungen und Nachfragen am einfachsten über e-mail: Kontakt
Wenn ich nicht verreist bin, sehe ich jeden Tag in den email-Briefkasten. Dann Lieferung innerhalb von 3 Werktagen.
Ab und an werde ich für zwei bis drei Wochen verreist und dann, wenn überhaupt, nur per eMail: Kontakt via InternetCafé erreichbar sein!
Einige maritime Buchhandlungen in Hamburg in Hafennähe haben die Titel auch vorrätig:
HanseNautic GmbH, Schifffahrtsbuchhandlung, ex Eckardt & Messtorff, Herrengraben 31, 20459 Hamburg, Tel.: 040-374842-0 www.HanseNautic.de
WEDE-Fachbuchhandlung, Hansepassage, Große Bleichen 36, Tel.: 040-343240
Schifffahrtsbuchhandlung Wolfgang Fuchs, Rödingsmarkt 29, 20459 Hamburg, Tel: 3193542, www.hafenfuchs.de
Ansonsten, auch über ISDN über Buchhandlungen, in der Regel nur über mich bestellbar.
Für einen Eintrag in mein Gästebuch bin ich immer dankbar.
Alle meine Seiten haben ein gemeinsames Gästebuch. Daher bitte bei Kommentaren Bezug zum Thema der jeweiligen Seite nehmen!
Please register in my guestbook
Una entrada en el libro de mis visitantes yo agradezco siempre.
Za wpis do mej ksiegi gosci zawsze serdecznie dziekuje.
erwähnte Personen
Leseproben und Bücher online

meine websites bei freenet-homepage.de/seamanstory liefen leider Ende März 2010 aus! Weiterleitung!
Diese website existiert seit 2003 - last update - Letzte Änderung 16.02.2012
Jürgen Ruszkowski © Jürgen Ruszkowski © Jürgen Ruszkowski
|

