 |
|

|
Ein Beitrag im Band 4
der Reihe "Seemannsschicksale"
Kapitän Alfred Tetens - Teil 2
|

Zugriffszähler seit 17.07.2003
Viele Bände sind jetzt auch als amazon-Direktdruck-Printbücher zu erhalten:
Band 1 - Band 2 - Band 4-1 Alfred Tetens - Band 4-b Anthologie 2015 - Band 5 - Band 6 - Band 13 - Band 15 - Band 17 - Band 18 - Band 19 - Band 20 - Band 21 - Band 22 - Band 26 - Band 27 - Band 30 - Band 31 - Band 32 - Band 33 - Band 37 - Band 39 - Band 40 - Band 41 - Band 42 - Band 44 - Band 45 - Band 46 - Band 48 - Band 58 - Band 59 - Band 60 - Band 64 - Band 65 - Band 68 - Band 69 - Band 70 - Band 71 - Band 73 - Band 76 - Band 78 - Band 79 -
Beitrag in der gelben Buchreihe "Zeitzeugen des Alltags" von Jürgen Ruszkowski
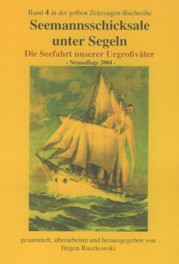
Band 4 "Seemannsschicksale" können Sie direkt bei mir bestellen - siehe unten!
Alfred Tetens
fuhr als Hamburger Kapitän jahrelang weltweit auf Segelschiffen zur See und bekleidete später das Amt des Wasserschouts eines hohen Senats der Freien und Hansestadt Hamburg und war Mitbegründer der Seemannsmission in Hamburg..
Der bei uns in Vergessenheit geratene Name des Kapitäns Alfred Tetens taucht heute noch in mehreren englischsprachigen Internetseitenspanischen im Zusammenhang mit der Geschichte der mikronesischen Inselwelt auf. und auch in einer
Diese wesentlichen Teile des Buches sind in dem Band 4 "Seemannsschicksale unter Segeln" enhalten, der in der maritimen Buchreihe "Seemannsschicksale" erschienen ist.
Alfred Tetens,
am 1.7.1835 in Wilster als „Sprössling Nummer Sieben eines in dänischen Diensten stehenden Justizrates und Senators geboren, fuhr als Schiffjunge, Matrose, Steuermann und Kapitän in britischen, dänischen, peruanischen, bremischen und hamburgischen Diensten jahrelang weltweit auf Segelschiffen zur See, „entdeckte“ und erschloss Mitte der 1860er Jahre etliche pazifische Inselgruppen im Auftrage des „Königs der Südsee“, des Hamburger Handelshauses J. C. Godeffroy & Sohn für den Handel mit Deutschland und bekleidete später das Amt des Wasserschouts eines hohen Senats der Freien und Hansestadt Hamburg.
Er war 1891 auch Mitbegründer der noch heute für Seeleute aus aller Welt gemeinnützig arbeitenden Deutschen Seemannsmission in Hamburg R.V.
Alfred Tetens starb am 13.01.1903.
In seinen 1889 in Hamburg beim Verlag G. W. Niemeyer Nachfolger (G. Wolfhagen) erschienenen und von S. Steinberg bearbeiteten „Erinnerungen aus dem Leben eines Capitäns – Vom Schiffsjungen zum Wasserschout“, die ich zufällig in einem antiquarischen Flohmarkt-Bücherkarton fand und die es im Handel nicht mehr gibt, seien hier einige wesentliche Passagen aus der großen Zeit der Segelschifffahrt zitiert. Die gesetzte und pathetische Sprache des 19. Jahrhunderts ist zunächst etwas gewöhnungsbedürftig. Die Schilderungen dieses energischen, weitgereisten Mannes geben aber einen sehr guten Einblick in die Seefahrt und Arbeitswelt der Segelschiffszeit unserer mehrere Generationen vor uns lebender Vorfahren. Nach einigen Rechtschreibreformen wirkt die Orthographie des Originalbuches heute auf uns recht eigenthümlich: begehrenswerth, Brod, Coje, complicirt, Cours, gerathen, giebt, Heimath, Hülfe, Noth, Radicalcur, Rehder, Thätigkeit, Thier, Thränen, ect. - Alfred Tetens berichtet über seine Seefahrtzeit:
* * *
Teil 1 der Lebensgeschichte des Alfred Tetens
* * *
...Auch über mich persönlich traf das Schicksal eine wichtige Verfügung. Mein Lebensschiff erhielt einen neuen Kurs und trieb nunmehr mit vollen Segeln in das selbständige Fahrwasser hinein. Während unserer letzten Vorbereitungen zur Abreise von Manila hatte ich die zufällige Bekanntschaft eines älteren, schifffahrtsmüden, englischen Kapitäns, A. Cheyne, gemacht, der mir nach kurzer Unterhaltung sein wertvolles Schiff zur Ausbeute eines geplanten gemeinsamen Unternehmens unter sehr günstigen Bedingungen zur Verfügung stellte.
Mit einer hoch zu schätzenden Bereitwilligkeit willigte der jetzige Führer der NORWOOD, Kapitän Bristow, in meine sofortige Entlassung.
„Sie haben uns,“ meinte der vortreffliche Seemann freundschaftlichst auf mein Ersuchen, „so hervorragende Dienste geleistet, dass ich mich aufrichtig freue, Ihnen diese selbstverständliche Gefälligkeit im Namen meiner Regierung erweisen zu können. Wir alle trennen uns nur schwer von Ihnen, aber Ihrer glücklichen Zukunft und Selbständigkeit müssen wir dieses Opfer bringen. Leben Sie wohl, Kapitän!“
Mit diesen herzlichen Worte war mein kontraktliches Verhältnis zur NORWOOD gelöst, ich erreichte noch am selben Tage die lang ersehnte Position eines selbständigen Schiffsführers.
An Bord des nunmehr meiner alleinigen Führung anvertrauten Schiffes „ACIS“ wurde ich erst vollends in die umfangreichen Pläne meines englischen Freundes eingeweiht. Im Grunde meines Herzens war mir der verheißene finanzielle Gewinn von nebensächlicher Bedeutung. Ich war der einfachen Frachtbeförderung müde geworden, ich sehnte mich darnach, noch mehr Völker und Länder kennen zu lernen, wollte der eignen Kraft vertrauend, Abenteuer suchen und meine erworbenen Erfahrungen im Dienste einer höheren Bestrebung zu verwerten suchen. Kurz und gut, ich wurde von einer Empfindung geleitet, die ich noch heute nicht präzise bestimmen kann, von der ich nur weiß, dass sie sich in einer unstillbaren Sehnsucht nach Fremdem, Ungekanntem äußerte, alles Gefahrlose ängstlich vermied und ein kampfvolles Dasein erstrebte. Von dieser echt jugendlichen Schwärmerei bin ich nach einem anderthalbjährigen Aufenthalte in der Südsee gründlich geheilt; aber ich darf auch erfreulicherweise hinzufügen, dass gleichzeitig meine Abenteuerlust vollauf Befriedigung fand und meine Erlebnisse eine Vielseitigkeit erreichten, welche dem größten Teil der Seefahrern gezogenen Grenzen vermutlich überschreiten dürfte...
* * *
Mein neuer Schiffseigner, Kapitän Cheyne , dessen Charakter ich erst später genauer kennen lernen sollte, hat einen so hervorragenden Anteil an der Erschließung jener pazifischen Inselgruppe der Karolinen, dass es wohl gerechtfertigt erscheint, ein volles Bild von dem Manne und seiner Tätigkeit hier folgen zu lassen.
Ende der 1850er Jahre stritten die zwei englischen Kapitäne, Woodin und Cheyne, um die Herrschaft des Handels mit den Eingeborenen. Woodin, ein offener, wahrheitsliebender, braver Mann, aber von geringer geistiger Befähigung, musste schließlich gegen den scharfblickenden, sehr klugen, herz- und charakterlosen Cheyne unterliegen. Allein Woodin war bei den Eingeborenen sehr beliebt, so dass er auf die gewöhnliche Art nicht zu verdrängen war. Unter der Maske der Freundschaft unterminiert nun sein Gegner Schritt für Schritt das gemeinsame Terrain. Nur in einem Punkte gab es eine seither von allen Engländern beobachtete, stillschweigende Übereinkunft: Niemandem den Handel auf den Karolinen-Inseln zu gestatten.
Die Inseln wurden von keiner andren Nation beachtet, und wen es gelüstete, den Schlupfwinkel der beiden englischen Kapitäne zu betreten, der durfte nur mit deren Erlaubnis Handel treiben. Traf aber doch einmal ein selbständiges Schiff ein, so wurden ihm so viele versteckte Schwierigkeiten bereitet, dass ein materieller Erfolg überhaupt ausgeschlossen war und der Führer Gott dankte, mit heiler Haut davongekommen zu sein; denn nicht selten wurden diese Schiffe von den Eingeborenen zerstört, ohne dass die Engländer auch nur ein Wort deshalb verloren. Auf diese Weise entstand unter den unternehmungslustigen Reedern die irrige Ansicht, dass die Inselgruppe für den Handel sehr gefahrvoll und auch nicht ergiebig sei.
Woodin sowohl als auch Cheyne befestigten diese Annahme in den betreffenden Kreisen, so oft sich eine Gelegenheit darbot. Das war auch vom kaufmännischen Standpunkte aus gewiss nicht verwerflich. Nachdem nun der ränkelustige, habgierige Cheyne erkannt, dass seine Kraft zur Vernichtung des Gegners nicht ausreichte, wusste er die Leidenschaft der ihm befreundeten Stämme so geschickt zu leiten, dass diese einen offenen Krieg gegen die Anhänger Woodins entbrannten. Der seit langer Zeit zwischen den Völkern des Südens und des Nordens beendete Kampf begann in Folge der teuflischen Intrige Cheynes aufs Neue zu wüten. Allein Woodin war zu jener Zeit noch Besitzer mehrerer schöner Schiffe und widerstandsfähig genug, um sich des Gegners ausreichend erwehren zu können. Dörfer wurden verwüstet, zahlreiche Menschen geopfert, ohne dass eine Entscheidung zwischen den streitenden Parteien herbeigeführt werden konnte.
Jetzt zeigte Cheyne seine ganze Verschmitztheit. Anscheinend des Streites müde, wusste er den ahnungslosen Woodin zu einer gemeinsamen Geschäftsverbindung zu bestimmen, und zwar derart, dass Cheyne für seine Tauschwaren nur Biche la mar, Woodin nur Öl und Schildpatt einhandeln durfte. Tatsächlich verwies Woodin seit diesem Tage alle Verkäufer von Trepang an Cheyne. Mit diesem augenscheinlichen Vorteil beruhigte sich derselbe indessen nicht, sondern er entwarf seinen ferneren Vertrag, in welchem er den charakteristischen Schlussparagraphen bestimmte, dass Woodin die Palau-Inseln verlassen müsse und nur Cheyne dort Handel treiben dürfe. Woodin, der inzwischen sein Vermögen verloren hatte und nur noch einen kleinen Schoner besaß, war doch klug genug einzusehen, dass ihm in diesem Falle alle Möglichkeit genommen war, ein neues Schiff zu erwerben, mit welchem er seine Handelsreisen und nachhaltige Konkurrenz wieder aufnehmen könne. Aber das war eben der Schachzug des ehrenwerten Cheyne, um seinen Kompagnon für immer wehrlos zu machen.
Blieb Cheyne alleiniger Handelsherr der Palau-Inseln, welche am günstigsten für den Trepang-Handel lagen, so war Woodin gezwungen, den wenig ergiebigen Verkehr mit den entfernteren weit roheren Insulanern zu unterhalten. Woodin lehnte ab und beschloss, den weiter nördlich gelegenen Ort Aibukit, mit dessen Einwohnern er schon früher Handel getrieben, aufzusuchen, um der Belästigung Cheynes und der Fürsten von Korror zu entgehen. Dieser Entschluss war den beiden letztgenannten Parteien höchst unliebsam. Sie fürchteten, dass jene Gruppe unter Leitung des Kapitäns Woodin den Handel mit den nördlichen Staaten an sich reißen und das kleinere aber gut regierte Korror seinen Einfluss verlieren würde.
Von allen Königen der Karolinen-Inseln waren es die von Korror gewesen, welche am frühesten den Verkehr mit Europäern, insbesondere mit Engländern eröffnet hatten und durch deren mannigfache Hilfsmittel die anderen weit mächtigeren Staaten in ein abhängiges, tributpflichtiges Verhältnis geraten waren.
Cheyne hatte also ein sehr leichtes Spiel; er brauchte nur beim Könige Abba Thule auf die ihm von Woodin und seinen Anhängern drohende Gefahr hinzuweisen, um diesen für einen Doppelzweck zu gewinnen. Cheyne wusste die Eifersucht zwischen Nord und Süd so geschickt zu schüren, dass Korror beschloss, einen Feldzug gegen die nördlichen Rivalen zu eröffnen. Zunächst sollte Woodin auf die von ihnen oft angewandte Weise vertrieben werden, die in der Zerstörung und Beraubung des Schiffes, dem sogenannten cut off (Abschneiden) bestand.
Der schlaue Cheyne gab nun seinem Gegner in einem Schreiben kund, dass er erfahren habe, die Leute von Aibukit würden Woodins Schiff am Tage seiner Ankunft zerstören. Es war der letzte Versuch der Einschüchterung, der natürlich keine Beachtung fand. Woodin erreichte den Hafen von Aibukit und fand auch die freundlichste Aufnahme. Noch einmal erhob Cheyne seine warnende Stimme und berichtete von neuen Angriffen; da diese aber nicht erfolgten, das freundschaftliche Verhältnis nirgends gestört wurde, so fühlte sich Woodin in seiner Position um so sicherer. Die anscheinende Teilnahme und Offenheit Cheynes erreichte die entgegengesetzten Wirkung. Darauf hatte der schlaue Cheyne gerechnet.
Nach vielen vergeblichen Versuchen beschloss nun der Süden den offenen Angriff auf die Nordstaaten. Seine zahlreichen Kriegskanus eilten in die feindlichen Gewässer, aber sie fanden ihre von Woodin geführten Gegner zum Kampfe bereit. Nun wurde ein friedlicher Ausweg gewählt. Die Häuptlinge von Korror gingen an Bord des Woodin’schen Schiffes und teilten dem Besitzer mit, dass es für ihn geraten sei, vor Beginn der Züchtigung den Norden zu verlassen, er solle aber im Süden so reichlich entschädigt werden, dass er diesen Entschluss gewiss nicht bereuen würde. Traute Woodin diesen Versprechungen nicht, oder wollte er seine Leute in diesem Augenblicke nicht verlassen, genug er wies das Anerbieten zurück und blieb pflichtgetreu auf seinem Posten. Erfolglos verließen die Häuptlinge das Schiff. Inzwischen waren auch die Kriegskanus von Aibukit in Schlachtordnung herbeigeeilt und eröffneten ein lebhaftes Feuer auf die gegnerische Flottille.
Der Kampf vermittelst Feuersteingewehre und der kleinen Schiffskanonen ist sehr harmloser Art. Auf Tausende von Schritten werden Flinten und Kanonen gegenseitig abgefeuert, deren Geschosse über eine Entfernung von 300 Schritten nicht zu dringen vermögen. Es ist also nur ein glücklicher oder auch ein unglücklicher Zufall, wenn eines dieser Geschosse Schaden anrichtet. Bei solcher stundenlangen Pulver- und Munitionsverschwendung bleibt eine Entscheidung ausgeschlossen, wenn nicht ein außergewöhnliches Ereignis den Kampf beendet. Das geschah auch jetzt. Ein von einem tapferen Häuptling befehligtes Kanu der Flottille Aibukit verließ plötzlich seine Stellung und drang pfeilschnell gegen die im Halbkreis liegende feindliche Macht vor.
Als der entschlossene Führer in die Nähe der anzugreifenden Kanus gelangt war, eröffnete seine Mannschaft das Feuer. Dieser Kühnheit war ein großer Erfolg beschieden. Ein Geschoss hatte ein feindliches Kanu getroffen und sofort zum Sinken gebracht. Sobald die Krieger von Korror den Untergang des Fahrzeuges bemerkten, war ihr Mut dahin. Innerhalb weniger Minuten war die ganze Flotte vom Schauplatz verschwunden. Woodin und seine Anhänger haten glänzend gesiegt. Der Jubel war groß; Feste wurden gehalten und Lieder zu Ehren des tapferen Mannes gedichtet. Aibukit hatte mit einem Schlage, nachdem sich noch einige kleine Staaten unter seine Oberherrschaft gestellt, eine achtunggebietende Stellung errungen. Cheynes Versuch blieb vorläufig erfolglos, aber er hatte doch den unheilvollen Bruch zwischen den Palau-Staaten herbeigeführt. Natürlich begannen jetzt auf beiden Seiten kleine Reibereien, man zerstörte sich gegenseitig die Kanus und ermordete bei passender Gelegenheit einzelne Gegner. Dieser von dem „zivilisierten“ Weißen geschaffene höchst verwerfliche Zustand währte fast zwei Jahre. Während dieser Zeit war Cheyne nicht untätig gewesen und sollte auch die Erfüllung seines teuflischen Verlangens leider erreichen.
Unter der offiziellen Angabe, verschollene englische Matrosen zu suchen, erschien das englische Kriegsschiff SPINX, Kapitän Brown, im Hafen von Korror. Waren die Intrigen Cheynes so fein gesponnen, dass sie dem Kapitän Brown irre führen mussten, oder dienten sie nur dazu, ihm den Schein des Rechts zu verleihen, genug, drei Bote des Kriegsschiffes, mit schweren Geschützen ausgerichtet, drangen gegen die nördlich gelegenen Dörfer vor und eröffneten ohne irgend eine Erklärung oder Aufforderung ein mörderisches Feuer.
Mit der Zerstörung der Dörfer und der sämtlichen Habe Woodins war der Sieg Cheynes definitiv entschieden. Die Inselgruppe wurde von ihm jetzt tatsächlich beherrscht, aber auch damit war der ruhelose geld- und ehrsüchtige Mensch noch immer nicht zufrieden.
So lagen die nur flüchtig angedeuteten Verhältnisse auf den Karolinen-Inseln, als ich vom Kapitän Cheyne während meines Aufenthalts in Manila zum Führer der ACIS ernannt wurde und den Auftrag erhielt, das sehr lohnende Geschäft auf den Karolinen weiterzuführen...
* * *
Wie bereits bemerkt, führte mich der Zufall in Manila in die Gesellschaft des Kapitäns Cheyne. Natürlich fanden wir beim Austausch unserer vielbewegten Fahrten Gelegenheit zu einer eingehenden Unterhaltung, die unsere Wünsche und Hoffnungen für die Zukunft in großen Zügen berührte. Bei der Offenheit des „liebenswürdigen“ Kapitäns Cheyne hatte ich ihm meine geheimsten, übrigens recht harmlosen Neigungen bald verraten. Einem so scharfen Beobachter, wie Cheyne, wäre es auch selbst bei vorsichtigen Mitteilungen eine Kleinigkeit gewesen, alles Wünschenswerte zu erfahren. Ich vertraute dem erfahrungsreichen Manne, glaubte seinen freundschaftlichen Versicherungen und unterzeichnete mit Freuden den entworfenen Kontrakt. Die ACIS, ein schön gebauter Schoner mit einer geringen Besatzung, war danach seinem Befehle unterstellt. Sobald Kapitän Cheyne, mein umsichtiger Reeder, Teilhaber und Freund, seine geschäftlichen Angelegenheiten in Manila beendet, wurden die Anker gelichtet. Die wunderbare Pracht, welche sich dem Auge, namentlich beim Passieren der Straße St. Bernardino darbietet, konnte ich nur wenige Augenblicke in ungestörter Freude betrachten. Kapitän Cheyne hatte entweder kein Verständnis für Naturschönheiten oder glaube seine Zeit praktischer verwerten zu können, indem er mich unausgesetzt mit meiner neuen Aufgabe vertraut zu machen suchte.
Bei unserer Ankunft auf den Palau-Inseln wurde ich von Cheyne dem König Abba Thule vorgestellt, fand eine freundliche Aufnahme und benutzte jede Gelegenheit, alles, namentlich die Sprache, Sitten und Gewohnheiten der Eingeborenen kennen zu lernen.
Wenngleich ich jetzt unter ein zwar friedliebendes, aber doch halbwildes Völkchen geraten, so war ich doch mit meiner Lage nicht unzufrieden. Ich sah doch einmal Menschen, die mit dem zufrieden, was ihnen die Natur verliehen, die den Kampf ums Dasein nicht kannten, auch nicht für den nächsten Tag sorgten. Fern von jeder Zivilisation, wurde mir eines Tages eine interessante Überraschung bereitet. Im Hause des Königs traf ich einen englisch sprechenden Europäer! Sobald ich die Gesichtsbildung dieses Herrn genau betrachtete, auch die fremdländische Aussprache aufmerksam verfolgte, durfte ich mit einiger Gewissheit annehmen, dass ich keinen Angehörigen der englischen Nation vor mir hatte.
Offenbar war der Gast des Königs durch meinen Eintritt in seiner Unterhaltung gestört, er hielt noch ein ziemlich umfangreiches Buch in der Hand, sein Anzug verriet bereits eine große Ähnlichkeit mit dem der Eingeborenen, wenigstens konnte ich keine Beinkleider bei dem Unbekannten bemerken...
„Mit wem habe ich die Ehre?“, fragte der Fremde höflich.
„Mein Name ist Tetens, ich bin Führer der ACIS und Teilhaber des Kapitäns Cheyne.“
„Sehr erfreut, Herr Tetens, ich bin Dr. Semper.“
„Darf ich mir eine Frage gestatten, Herr Doktor?“
„Bitte sehr.“
„Sind Sie Engländer?“
„Nein, nein, ich bin Deutscher.“
Bis jetzt war die Unterhaltung in englischer Sprache geführt, als ich nun aber deutsch antwortete und meine holsteinische Heimat nannte, da sprang Dr. Semper freudig erregt empor.
„Das ist ja famos, dann sind Sie ja nicht nur mein Landsmann im allgemeinen, sondern auch im engeren Sinne, ich bin aus Altona.
Es waren angenehme Stunden, die ich in Gesellschaft des Gelehrten verlebte. Nicht nur die Erinnerung an die ferne Heimat war geweckt, es füllte mich auch mit Bewunderung, wie der deutsche Forscher im Dienste der Wissenschaft alle Strapazen, jedes Ungemach ertrug und mit welcher unermüdlichen Ausdauer er seine wissenschaftliche Aufgabe zu erfüllen suchte.
Im Allgemeinen ist unter dem Volke die Ansicht vorherrschend, dass der deutsche Professor nur Auge und Sinn für das streng Wissenschaftliche habe, dass er alles, was seinem eigentlichen Gebiete ferner liegt, nicht beachte und mit den einfachsten Dingen weit unpraktischer verfahre wie der Mann aus dem Volke. Hat diese Meinung eine gewisse Berechtigung, so machte Dr. Semper eine glänzende Ausnahme. Ihm war auch nichts entgangen, selbst die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse der Inselgruppe hatte er mit einer seltenen Klarheit erfasst und er wusste die geringfügigsten Vorkommnisse wissenschaftlich zu erläutern.
Von allen Einwohnern geachtet, hatte der deutsche Gelehrte in einer verhältnismäßig kurzen Zeit nicht nur alles Wissenswerte erfahren, sondern auch, vom Zufall begünstigt, Cheynes selbstsüchtige Pläne entdeckt und höchst geschickt vereitelt.
König Abba Thule war im Besitze eines Buches: „An Account of the Pelew-Islands“, dessen Verfasser Wilson im Jahre 1780 auf den Palau-Inseln gescheitert und der somit wohl die erste eingehende Schilderung von diesem Volke geliefert hat. Der König betrachtete dieses Buch als ein Heiligtum, erzählte es doch von einem jungen Königssohn, der einst die Insel verlassen, um in England europäische Sitten zu erlernen, dort im fernen Lande von einem frühzeitigen Tod ereilt worden, und der nie wieder in seine Heimat zurückgekehrt war. Dr. Semper empfing dieses Buch zur Durchsicht aus den Händen des Königs, fand auch manche wissenschaftlichen Aufschlüsse, aber weit mehr als der Inhalt, fesselten den aufmerksamen Forscher zwei zufällig zwischen die Blätter des Buches geratene Abschriften eines geheimen Vertrags zwischen dem Könige und dem Kapitän Cheyne, sowie einer Konstitution von Palau.
Die Originale dieser interessanten Schriftstücke befanden sich im englischen Konsulate in Manila. Wurden die Bestimmungen ausgeführt, so war Kapitän Cheyne tatsächlich König von ganz Palau. Dr. Semper hatte Abschrift von den Dokumenten genommen und sowohl diese, wie auch die mutwillige Zerstörung von Korror-Dörfern durch das englische Kriegschiff SPHINX in der in Manila erscheinenden Zeitung Diario de Manila veröffentlichen lassen.
Spanien, das angeblich vor 150 Jahren die Palau-Inseln als Eigentum erworben haben will, schenkte diesem Vorkommnis zwar nicht die erwünschte Beachtung, aber der deutsche Gelehrte erreichte wenigstens den moralischen Erfolg, dass Cheynes Handlungsweise in weiten Kreisen zur Kenntnis kam und seine Pläne wie von unsichtbarer Macht durchkreuzt wurden.
Für mich waren die freimütigen Eröffnungen meines gelehrten Landsmannes von höchster Wichtigkeit; wenn ich mich auch nicht um Politik kümmerte, so hatte ich doch den wahren Charakter meines Reeders kennen gelernt und konnte demnach meine Maßregeln treffen.
Nachdem Dr. Semper die Palau-Inseln verlassen, eröffnete mir Cheyne den überraschenden Plan, die nördlich gelegene Insel Yap aufzusuchen und dort den gewinnreicheren Handel mit den Eingeborenen zu beginnen. Das selbständige Wirken unter einem unbekannten Stamme war für mich verlockend genug, um Cheynes Anerbieten anzunehmen. Bald waren die Vorbereitungen zur Reise beendet. Zu meinem Begleiter wurde ein alter Engländer, Mr. Davis, ernannt, der seit seiner Kindheit auf den Palau-Inseln gelebt, als jungen Mann ein eheliches Verhältnis mit einer Eingeborenen geschlossen und die Lebensweise der Insulaner so genau angenommen hatte, dass er allgemein als Eingeborener betrachtet wurde.
Mr. Davis fühlte sich mit seiner zahlreichen Familie ungemein wohl unter seinen Leuten; aus seinem Gedächtnis waren ja die Erinnerungen an seine eigentliche Heimat, wie auch die Grundzüge der europäischen Kultur vollständig verwischt. Nur noch ein höchst mangelhaftes Englisch hatte sich der sonderbare Mann bewahrt. In der ersten Zeit unserer Bekanntschaft hatte ich oft Veranlassung gesucht, von Mr. Davis Aufklärung über sein befremdendes Gebaren zu erhalten, aber Wochen vergingen, bevor ich mein Ziel erreichte.
„Will nichts von England wissen, Herr“, versetzte er mürrisch, „lebe hier glücklich und zufrieden, Fische im Wasser, Tarro in der Erde, Kokos auf den Bäumen – warme Sonne und blauer Himmel, genug für einen Menschen.“
Seit dieser Erklärung unterließ ich jede derartige Frage. Weshalb sollte ich das Glück dieses für die Zivilisation verlorenen Mannes stören? Davis wurde mir als Dolmetscher zugewiesen; für meine persönliche Sicherheit sollten zwei Palauer Häuptlinge auf Befehl des Königs Sorge tragen. Sobald meine drei Gefährten an Bord kamen, wurden die Anker gelichtet. Nach viertägiger Fahrt gegen den Nord-Ost-Monsum kreuzend, erreichte ich den geräumigen Hafen von Rul, der Hauptstadt von Yap.
Die Eingeborenen von Yap sind hinterlistig, falsch und weit grausamer als die von Palau, vor denen sie jedoch große Furcht haben. Davis wusste viele Schiffe zu nennen, die auf Yap zerstört und von deren Besatzung auf die grausamste Art ermordet worden waren. Bevor Davis die Erlaubnis des Königs eingeholt, landen zu dürfen, ließ ich die Enternetze befestigen, um einen zu befürchtenden Angriff auf mein Schiff zu vereiteln. Davis kehrte nach wenigen Stunden in Begleitung eines Abgesandten vom König Karalok mit der Meldung zurück, dass er mich empfangen werde und keine Feindschaft gegen uns hege.
Auf dem Wege zur königlichen Wohnung kam uns eine Schar von 20 Männern in ihrem kriegerischen Kostüm entgegen. Davis übernahm auch jetzt die Verantwortung ihrer Anrede. Der scheue, unruhige Blick dieser Männer verwischte den günstigen Eindruck, welchen ihre imposanten Gestalten im ersten Augenblicke hervorgerufen hatten.
Von allen Bewohnern der Karolinen besitzen die Yapleute nicht nur eine hellere Hautfarbe, sondern auch eine regelmäßigere, schönere Gesichtsbildung. Bei ihren nur wenig aufgeworfenen Lippen und kaum bemerkbar hervortretenden Bakenknochen liegt die Annahme nahe, die Bewohner Yaps als eine Verschmelzung von Malayen und Papuas, somit als die eigentlichen Mikronesier zu betrachten.
Im Hause des Königs war bereits ein aus den hervorragendsten Häuptlingen nebst ihren Frauen und Töchtern bestehender Hofstaat versammelt. Zahlreiche Diener waren eifrig beschäftigt, die Wünsche des Königs zu erfüllen. Keine leichte Aufgabe! Ähnlich wie die Könige der südlicheren Inseln beschäftigt sich Seine Majestät fortwährend mit der Pflege seines schlank gebauten Körpers. Er raucht entweder die von den Eingeborenen angefertigten Zigaretten, kaut junge, mit gestoßenem Kalk bestreute Betelnüsse oder schlürft frische Kokosmilch und gegorene Getränke. Der König trug nur einen Lendengürtel, die sogenannte Tapa. Einige auffallend schöne Tätowierungen korrekt gezeichneter Tierköpfe, Bäume und sonstiger hübscher Muster schmückten seinen ganzen Körper. König Karakok gab nun mir das Zeichen, an seiner Seite Platz zu nehmen und begann dann mit Davis eine mir unverständliche Unterredung.
Während dieser Zeit beobachtete ich meine sehr interessante Umgebung. Zu meiner Rechten standen die schlanken, muskulösen Männer, ihre mannigfachen Tätowierungen glichen einer wandelnden Bildersammlung; die Haltung der sehr sauberen Gestalten bekundete Energie und Gewandtheit.
In noch höherem Grade fesselten mich meine Nachbarn zur Linken. Es waren die Weiber des Königs und der Häuptlinge nebst ihren Töchtern. Ihr zarter Glieder- und Körperbau zeigt tadellose, üppige Formen. Sinnliche Glut, hochgradige Neugierde spricht aus den Blicken der sich hin- und herbewegenden Gestalten. Außer der gewöhnlichen Bekleidung eines aus grünem und rotem wohlriechenden Bast angefertigten Rockes zeigen die Kleider der Frauen nur geringe Abweichungen von denen der Mädchen.
Während sich erstere mit schwarzen, von Bastfasern gefertigten Halsbinden schmücken, tragen die jungen Mädchen eine Halskette von kleinen Muscheln. Als ein sichtbares Zeichen ehelicher Würde sind die Zähne der Frauen schwarz gefärbt, auf diesen vermeintlichen Schmuck muss jedes Mädchen bis zu ihrer Verheiratung verzichten.
Die Eingeborenen von Yap, ohne Unterschied des Geschlechts, sind leidenschaftliche Raucher. Fast scheint es, als ob der weibliche Teil und namentlich die jungen Mädchen in noch höherem Maße von dieser den Europäern entlehnten Angewohnheit beherrscht werden. Die Zigarette verschwindet nur selten von den Lippen der schönen und sehr grazilen Raucherin.
Von allen Damen meiner Gesellschaft schenkte mir die jüngste Tochter des Königs eine außergewöhnliche Aufmerksamkeit und Beobachtung. So oft ich meine Umgebung betrachtete, begegnete ich den sprechenden Blicken des schönen, kaum fünfzehnjährigen Mädchens. Dieser unbewusste Gedankenaustausch bereitete meiner jugendlichen Verehrerin viel Vergnügen, ein reizendes Lächeln umspielte ihren kleinen Mund.
Davis’ geschäftliche Erklärungen unterbrachen leider das bestrickende Spiel der Prinzessin.
„König Karakok“, begann mein Dolmetsch erläuternd, „ist bereit, Ihnen den Aufenthalt und die Gewinnung von Trepang auf Yap zu gestatten, vorausgesetzt, dass Sie aus keiner anderen Absicht diese Insel besuchen. Sobald Sie das Vertrauen des Königs täuschen, sind Sie dem Tode verfallen. Noch nie ist einem Weißen der Aufenthalt auf Yap erlaubt worden. Wohl habe es schon fremdländische Schiffer versucht, sich gewaltsam hier einzunisten, aber sie haben die Insel nie lebend verlassen.“
Von großer Wichtigkeit war mir meine Freundschaft mit Abba Thule; denn obgleich Yap gegen Palau feindlich gesinnt ist, muss es doch zur Anfertigung seiner als Geldmünze dienenden großen ausgehauenen Steine die letztgenannten Inseln aufsuchen und die Erlaubnis, jene Steine fortführen zu dürfen, beim Könige einholen. Wenngleich Karakok niemals mit europäischen Völkern verkehrte, so weiß er doch ziemlich genau, wie nachteilig Cheynes Ansiedlung für Palau geworden ist und kennt auch die von den Weißen geschürten Kriege zwischen den Völkern der Inseln; selbst die von dem englischen Kriegsschiffe auf Korror verursachte Zerstörung ist ihm berichtet worden. Davis fuhr in seiner Erklärung fort.
„Nur die von mir verbürgte Tatsache, dass Sie kein Engländer sind, auch bei den Eingeborenen von Palau als Era Alleman gelten, hat den König bestimmt, Sie freundlichst aufzunehmen. Nach einer Stunde soll der Kontrakt zwischen uns und dem Könige mit seinen Häuptlingen in großer Versammlung geschlossen werden; es werden dann die Geschenke ausgewechselt und unmittelbar darauf wird ein großes Fest nebst Tanz stattfinden. Reichen Sie jetzt dem Könige zum Einverständnis die Hand, aber verweigern Sie die Annahme der von ihm bereiteten Betelnuss, so verlangt es die Landessitte.“ - Ich tat, wie mir empfohlen und durfte mich nunmehr des Königs Gunst erfreuen. Nach dieser ersten offiziellen Sitzung löste sich die Versammlung unter lebhaftem Gespräch auf, niemand war jetzt in seinen Neigungen beschränkt.
Diese eine Stunde gab mir Gelegenheit, manche eigentümlichen Gewohnheiten dieser Inselbewohner kennen zu lernen. Die Frauen lösten ihr tiefschwarzes bis zum Knie reichendes Haar, das bislang am Hinterkopfe zu einem Knoten geschürzt war. Für gewöhnlich wird das etwas kürzere Haupthaar der Männer in derselben Weise geknotet und mit einem oft sehr zierreichen Kamm festgehalten. Nur im Kriege, auf dem Fischfang oder bei erregendem Kampfe mit dem Meere wird der Knoten gelöst.
Ein großer Teil der Männer entfernt sogar recht ungeniert seinen schmalen Hüftgürtel, um sich desto bequemer den Lieblingsneigungen hinzugeben. Während Davis meine Geschenke vom Schiffe holte, blieb ich in der rauchenden, trinkenden und essenden Gesellschaft zurück. Wieder waren es die zutraulichen Weiber, denen meine Wenigkeit zu ihrer, wie es schien, recht belustigenden Unterhaltung diente. Dass ich die Fragen der übermütigen Schönen nicht beantworten konnte, erweckte eine ungeheure Heiterkeit. Jedenfalls war mir klar, dass sich einige der wortführenden Damen recht verfängliche Bemerkungen erlaubten, die zwar meinen Gleichmut nicht störten, aber doch schließlich, von unbeschreibbaren Liebesbezeugungen begleitet wurden, eine sehr unerquickliche Situation herbeiführten.
In meiner Bedrängnis kam mir die Tochter des Königs, deren Teilnahme mir schon während der Vorstellung aufgefallen, zu Hilfe. Sie machte mir ihr Verlangen nach Tabak leicht verständlich. Bereitwillig reichte ich dem schönen Kinde das begehrliche Lieblingskraut. Bei diesem Anblick geriet der ganze Damenflor in eine freudige Erregung; in wenigen Minuten war der Tabak unter den Frauen verteilt.
Die augenscheinliche List meiner liebenswürdigen Retterin war gelungen, ich war von jeder Belästigung befreit. Während sämtliche Frauen den empfangenen Tabak zu Zigaretten verwandten, stand die Prinzessin regungslos vor mir. Aus ihren dunklen Augen sprach eine rührende Teilnahme, herzinnige Freude verklärte das schöne Gesicht des seltenen Naturkindes.
Mit aufrichtiger Bewunderung betrachtete ich die rätselhafte Gestalt. Wie war das empfindungsvolle, zartsinnige Geschöpf unter die wilden Menschen geraten, wie war es möglich, dass es sich ein so auffallendes Zartgefühl und weibliches Empfinden unter seinen rohen Genossinnen hatte bewahren können? Ich stand vor einem lebenden Rätsel. Nichts war natürlicher, als dem geheimnisvollen Mädchen meinen Dank zu beweisen. Zufällig führte ich ein aus blauen Glasperlen gefertigtes Halsband bei mir, das ich ursprünglich für die Lieblingsfrau des Königs bestimmt, nun in die Hand der schönen Prinzessin legte.
Die grenzenlose Freude des überraschten Mädchens lässt sich nicht beschreiben... Ein gellender Jubelschrei entfuhr den Lippen der wie im Fieberschauer sich gebärdenden Prinzessin. Sekundenlang lag sie zusammengekauert zu meinen Füßen, dann schnellte sie empor, drehte sich, die zartgegliederten Arme empor streckend, in wiegender Bewegung stets meinen Körper berührend, im Kreise herum. Die ganze Umgebung geriet bei diesem geheimnisvollen Gebaren in Wallung, die Weiber sprangen wie besessen umher und die Männer brüllten so entsetzlich, dass ich einen Augenblick sehr besorgt wurde.
Glücklicherweise kehrte endlich Davis mit den Geschenken zurück; der betäubende Lärm verstummte und ich erhielt, sobald ich den Vorfall geschildert, die sehnsüchtig erwartete Erklärung, dass die Versammlung mir ihre namenlose Überraschung über meine Freigiebigkeit ausdrückte.
„Für jede einzelne Perle“. Berichtete der Dolmetscher mürrisch, „hätten Sie soviel Yams, Kokos und Fische geliefert erhalten, dass wir tagelang davon hätten leben können.“
Meine augenscheinliche Verschwendung machte mir weniger Verdruss als dem treuen Davis; die Freude des jungen Mädchens war nicht zu teuer erkauft, allein das wertlose Geschenk hatte ein Nachspiel im Gefolge, das mir, mit den Sitten des Volkes noch wenig vertraut, große Besorgnis einflößte.
Davis hatte, wie schon früher bemerkt, jede europäische Kultur abgestreift, es durfte mich also auch nicht überraschen, dass er mir jetzt mit der größten Gleichgültigkeit berichtete, durch die Annahme der Glasperlen wäre die Prinzessin mein ausschließliches Eigentum geworden.
„Unterlassen Sie in diesem Augenblicke jeden unliebsamen Scherz, Davis“, rief ich, nur mühsam meine Überraschung bekämpfend, „sollte ich aus Unkenntnis der Sitten der Eingeborenen wirklich ein Versehen begangen haben, dann berichten Sie sofort dem Könige meinen Irrtum.“
„Damit Ihnen in der nächsten Stunde der Kopf vom Rumpfe getrennt wird. Ja gewiss, Herr, dem Tode würden Sie nicht entrinnen, so wahr ich an Gott glaube, König Karakok würde es als die kränkendste Beleidigung betrachten, wenn Sie seine Tochter zurückweisen, vorausgesetzt, dass diese ihrem Vater jene wertvoll scheinende Halskette einhändigt und damit ausspricht, Ihnen anzugehören.“
Es war also noch Hoffnung vorhanden, dieser heiklen Landesbestimmung zu entgehen; dass sich die Prinzessin von dem Geschenke trennen würde, war bei ihrer Freude kaum anzunehmen. Außerdem prangten die Zähne der Königstochter noch in blendender Weiße, ein sicheres Zeichen, dass sie im jugendlichen unreifen Alter stand und mindestens einige Monate vergehen mussten, bevor ihre Zähne schwarz gefärbt, die letzte Verpflichtung des erwachenden Weibes erfüllt war. Bis dahin hoffte ich Mittel und Wege zu finden, meinen Irrtum selbst aufzuklären. Während Davis meine für den König bestimmten Geschenke vorschriftsmäßig ordnete, wurden die aus Hühnern, Kokosnüssen, Yams und allerlei schönen Früchten bestehenden Gegengeschenke herbeigeschafft.
Eine besondere Freude war bei Könige nicht bemerkbar; wohl zeigte er sich mit den eisernen Meißeln, die den Eingeborenen als das einzigste Handwerkszeug dienten, mit denen sie alles Erforderliche angefertigten, recht zufrieden; auch die Fischangel und grellfarbene Tücher fanden seinen Beifall, allein der Haupterfolg war schon durch die bunte Glaskette zum größten Bedauern Davis vorweggenommen.
Um auch jetzt bei der geschäftlichen Verhandlung einen durchschlagenden Erfolg zu erzielen, fehlte uns eine sogenannte Glanznummer. Cheyne hatte mich nur mit den notwendigsten und dabei recht mangelhaften Tauschartikeln versehen, die wohl kaum die Summe von dreihundert Mark repräsentierten, wofür ich im Laufe von sechs Monaten eine Schiffsladung Schildpatt und Trepang erhielt, die nahezu 18.000 Mark ergab.
Wollte ich also den König noch einmal in freudige Aufregung versetzen, so konnte das nur mit privaten Mitteln geschehen. In meiner Tasche befand sich noch eine hölzerne Streichholzdose und ein schönes Taschenmesser. Dieses Mal kam mir Davis mit seiner Erfahrung rechtzeitig zu Hilfe.
„Nur nicht das Taschenmesser, Herr, das wollen wir für später bewahren, wenn wir etwas Besonderes erreichen sollen“, berichtete der Geschäftsträger verständnisvoll, „außerdem würde Ihnen der König sein jüngstes Weib schenken.“
Diese Angabe genügte, um mein Messer sofort so gut wie möglich zu verbergen, die Freigiebigkeit erfüllte mich mit Schrecken. Schildpatt, Perlmutter und Trepang war ich jederzeit bereit entgegenzunehmen, allein einen weiblichen Hofstaat zu errichten, dafür lag kein Bedürfnis vor.
Davis verkündigte also dem Könige, dass er jetzt aus meinen Händen ein Geschenk von unermesslichem Werte zum Beweise unserer besonderen Freundschaft empfangen würde. Bei dieser Erklärung wurde es mäuschenstill im Raume, jedes Auge ruhte gespannt auf meinen mir von Davis vorgeschriebenen Bewegungen. Ich hatte demnach die kleine Schachtel geöffnet, hielt ein Streichholz in der Hand und da sich kein passender Gegenstand fand, so entzündete ich das Hölzchen mit einer raschen Handbewegung nach Seemannsart an meinem Beinkleide.
Sobald die Flamme sichtbar wurde, begann abermals ein minutenlanger, sinnbetäubender Überraschungssturm, der den ersten durch die Glasperlen hervorgerufenen an Stärke übertraf. Sobald der König das Geschenk besaß, wollte er auch selbst die Entzündung des Hölzchens bewerkstelligen. Zunächst gab mir derselbe Gelegenheit, seine Vortreffliche Nachahmung bewundern zu können.
Leider war dem ersten königlichen Versuche kein günstiger Erfolg beschieden. Zwar fuhr die das Streichholz haltende Hand des Königs mit einer bewunderungswürdigen Kraft und Raschheit über den majestätischen Oberschenkel, allein da dieser jeder Hülle entbehrte, so versagte das Hölzchen naturgemäß den erwünschten Dienst und hinterließ nicht nur auf der Streichfläche, sondern auch auf dem schmerzbewegten Antlitz des Königs die sichtbaren Spuren einer wenig erfreulichen Überraschung.
Davis ergriff nunmehr das widerspenstige Hölzchen und entzündete es an dem Baströckchen einer der nächststehenden Häuptlingsfrauen. Bevor der König diese bequeme Art wiederholte, glitt seine Rechte wiederholt besänftigend über die schmerzhafte Partie; dieses Mal wurde seine Geschicklichkeit belohnt, das Hölzchen stand zur Freude Seiner Majestät in hellen Flammen.
Wiederholt vollbrachte der König dieses Wunder, allein einen praktischen Erfolg hat ihm diese europäische Erfindung nicht gewährt. Im Gegenteil führte sie später recht oft Verzögerungen herbei, weil nach Ansicht des Königs das Streichholz nur unter Mitwirkung des zuerst benutzten Baströckchens entflammte. Die Trägerin kam dadurch zwar zu großem Ansehen, musste aber zu jeder Zeit gewärtig sein, vor Seiner Majestät als Streichfläche zu erscheinen, wodurch ihre und ihres Gemahls häusliche Ruhe sehr oft gestört wurde. Die Benutzung des Streichholzes blieb ausschließliches Recht des Königs, das Volk musste bei seiner altgewohnten Feuerbereitung bleiben. Ein holunderartiges, mit einem Einschnitt versehenes Stück Holz wird auf den Boden gelegt, mit den Füßen festgehalten, alsdann wird ein anderes hartes Stöckchen mit dem einen Ende senkrecht auf die Höhlung gestellt und zwischen beiden Handflächen so lange rasch hin- und herbewegt, bis sich ein feiner brauner Holzstaub bildet. Dieser Holzstaub erhitzt sich durch die fortgesetzte Reibung so sehr, dass sich darin ein Funken zeigt, der sich rasch über das pulverisierte Holz verbreitet. Diesen Moment benutzt der Eingeborene, nimmt aus seinem Korbe ein Stück weiche, trockene Kokosnussfaser, legt diese in Teelöffelform zusammen, schiebt vorsichtig das glimmende Holzpulver darauf und entzündet nunmehr durch Blasen seine Lunte. - Der Bewohner von Yap hält es unter seiner Würde, das Feuer seines Nachbarn zu benutzen, obwohl er leidenschaftlicher Raucher ist, verzichtet er so lange auf den Genuss, bis er sich die glimmende Kokoslunte selbst verschafft hat.
Nunmehr ließ auch der König seine Paradenummer vorführen. Zwei fette Schweine, die sich recht ungeniert in der Versammlung benahmen, fast jeden Teilnehmer mit einer rührenden Vertraulichkeit begrüßten, sollten die besondere Freude des königlichen Gebers beweisen. Nun war auch Mr. Davis zufrieden; mit Hilfe einiger Diener geleitete er unsere grunzenden Errungenschaften an Bord. Aus den Blicken des verwilderten Europäers sprach eine so ausdrucksvolle, glückselige Empfindung, wie ich sie noch nie bei ihm bemerkt hatte. Ein recht prosaischer Gedanke stieg in mir auf. Hatten die grunzenden Vierfüßler die Erinnerung an die Heimat meines Dolmetschers geweckt? Gedachte er beim Anblicke seiner umfangreichen Schutzbefohlenen des teuren Vaterhauses, der längst entschwundenen Zeit, in welcher frische Wurst auf den elterlichen Schüsseln prangte, der berauschende Duft der Wurstbrühe ihm durch die Nase zog? Soweit ich Davis kennen gelernt, durfte ich diese Frage ruhig bejahen und behaupten, dass ihn nichts lebhafter an die ferne Heimat erinnerte, als das bevorstehende Schweineschlachten.
Inzwischen waren die Vorbereitungen zum Tanz beendet; zahlreiche Zuschauer, nach Rang und Alter gruppiert, lagerten bereits auf dem von Palmen beschatteten Platze, tranken, rauchten und plauderten nach Herzenslust. Mir wurde der Platz an der Seite des Königs angewiesen; acht Reihen vor mir war die junge Welt versammelt, welche dem bevorstehenden Schauspiel das lebhafteste Interesse entgegentrug, und deren Gesellschaft mir sicher eine größere Unterhaltung gewährt hätte, als der nur hin und wieder elektrisierte Kreis älterer Leute.
Die nach der Größe geordnete Schar zog im Gänsemarsch heran, kleine Knaben und Mädchen, die vielleicht erst seit kurzer Zeit das Gehen erlernt, eröffneten den Zug, ihnen folgten die eigentümlich geschmückten Tänzer und Tänzerinnen, aus deren aufgelöstem Haupthaar frische Blumenkränze und wohlriechende Pflanzenzweige bis zu den Schultern herabhingen.
Die Brust der Männer ist zinnoberrot bemalt, sorgsam gewählte Baststreifen bedecken Beine und Fußgelenke, während an den Armen der gewöhnliche Schmuck, Schildpattringe und geschliffene Muscheln, getragen wird. Besonders bemerkenswert ist die dunkle Tätowierung, die sich vom Hellgelb der Hautfarbe scharf abhebt und dem ganzen Bilde ein lebhaftes Kolorit gibt.
Frauen und Mädchen tragen über den Hüften kurze Baststreifen, statt jeder weiteren Bedeckung erglänzt der Körper in feuerrotem Farbenschmuck. Während des Sonnenlichts gelangt diese bescheidene Toilette nicht zur vollen Wirkung, erst wenn der magische Schimmer des Mondes durch die lichten Zweige dringt und die grellen Farben wesentlich mildert, erscheinen die biegsamen, schöngeformten Gestalten in ihrem ganzen, zauberischen Reiz. Ein unheimlich wüstes Geschrei bezeichnet den Anfang des Tanzes.
Auf ein gegebenes Zeichen drängen gleichzeitig von zwei Seiten waffenschwingende, wutentbrannt scheinende Weiber bis auf wenige Schritte gegeneinander vor, bleiben sekundenlang wie angewurzelt stehen und formieren sich dann zu einer den Schluss des Kampes darstellenden Gruppe. Als die beiden Parteien gegeneinander zu prallen drohten, hätte wohl kein Uneingeweihter an eine Schaustellung geglaubt, so geschickt wurde der Angriff im Kriege dargestellt.
Mit durchdringender Stimme wird jetzt von dem Ältesten ein nicht unmelodischer Gesang angestimmt. Die Tänzer bewegen sich nicht von der Stelle, aber während sie alle im genau abgemessenen Tempo die Hüften in eine Schwingung bringen, verursachen sie durch das Aneinanderschlagen ihrer Blätterkleider ein starkes Rauschen, welches den Rhythmus des Gesanges angibt. Eine Vorsängerin eröffnet den Vortrag in eigenen Dichtungen, erst zum Schluss fällt der Chor, die letzten Worte wiederholend, kräftig ein.
Beim Schlusse dieses eigentümlichen Spiels senken sich die bislang hoch erhobenen, zitternden Hände der Tänzer, ein furchtbares Geschrei erschallt, bis die Rechte mit einem kräftigen Schlag auf den Brustkasten niedersinkt. Nun beginnt erst der eigentliche Tanz, die eigenartigen Bewegungen der Knie und Unterschenkel gleichen nur noch einer langsamen Wellenbewegung. Betrachtet man den ernsten Gesichtsausdruck, die gesenkten Blicke der Tänzer, so wird man diese Schaustellung kaum noch als Tanz bezeichnen dürfen.
In Wahrheit ist es eine religiöse Handlung, welche die meisten Eingeborenen in der Südsee verrichten, um die von ihnen angebeteten Geister zu bitten, ihnen nicht nur alle erforderlichen Nahrungsmittel, sondern auch einen zahlreichen Nachwuchs zu bescheren. Nach dieser Richtung stützt sich der Glaube der Yap-Bewohner auf den Willen der Geister. Darum bringt auch jedes weibliche Geschöpf, welches jener Freude teilhaftig zu werden wünscht, dem großen „Zauberer“ allerlei Geschenke an Naturalien und Perlmutterschalen dar.
Wenige Minuten nach Sonnenuntergang ist die eigentümliche Schaustellung beendet, die Gruppen lösen sich auf und jeder Teilnehmer huldigt seiner durch nichts beschränkten Neigung. –
Sobald ich in Gesellschaft des Königs das reichhaltige Mahl eingenommen, verabschiedete ich mich nach der Anweisung meines alten Davis von meinen neuen Freunden, froh, die erregende Einführung ohne weitere Störung beendet zu sehen.
Obwohl körperlich erschöpft, saß ich noch stundenlang auf Deck, um von Davis über alles, was mein Auge gesehen, Aufklärung zu erhalten. Eine Fülle sinnberückender Eindrücke des Tages hatte meinen Schlaf verscheucht. Traumversunken ruhte mein Blick auf dem wunderbaren, vom Mondenglanz erhellten Nachtbilde. In leisem, geheimnisvollem Säuseln neigen die Kokospalmen ihre Wipfel, über die silberschillernde Meeresfläche gleitet es wie ein wonnigliches Erzittern. Ein weihevoller, majestätischer Zauber ruht auf Land und Meer, der Himmel ist so klar und sternenhell, wie man ihn nur in den Tropen erblickt. Nur die im Wasser plätschernden, in kurzen Zwischenräumen empor springenden Fische unterbrechen die geheimnisvolle Ruhe.
So sehr auch mein ermüdeter Begleiter zur Nachtruhe mahnte und bereits seinen Schlafraum aufsuchte, so vermochte ich mich doch nicht von dem entzückenden Anblicke zu trennen, eine unerklärliche Sehnsucht hatte sich meiner bemächtigt. Inmitten dieser bestrickenden Stimmung vernahm ich ein eigenartiges, vom fernen Ufer herübertönendes Geräusch. Unwillkürlich richtete ich den Blick nach der stärker bewegten Oberfläche, vermochte aber die Ursache jener Wellenbewegung nicht zu erkennen.
War es ein nach Beute haschender Meeresbewohner, der mich aus meinen Träumen geweckt? Konnte es etwas anderes sein? Schon wollte ich mich mit dieser naheliegenden Annahme begnügen, da wiederholte sich plötzlich in geringerer Entfernung von meinem Schiffe dasselbe Plätschern. In gerader Linie tauchte das unerkennbare Etwas aus dem Wasser empor und versank dann mit Blitzesschnelle in die Tiefe. Zweimal hatte sich das rätselhafte Schauspiel in regelmäßigen Pausen wiederholt, nach jedesmaligem Emportauchen verminderte sich die Entfernung zwischen mir und dem geheimnisvollen Wesen wohl um dreißig Schritte.
Mit begreiflicher Spannung richtete sich mein Blick sekundenlang auf den Punkt, wo ein ferneres plätscherndes Geräusch, nach den zweimaligen Wiederholungen zu urteilen, stattfinden würde. Eine Minute mochte wohl in diesem erregenden Erwarten verstrichen sein; die wenigen Augenblicke erschienen mir wie Stunden, spiegelglatt erglänzte die weite Wasserfläche, kein Lüftchen rührte sich, und nirgends wurde die feierliche Ruhe gestört. Trieb meine erregte Phantasie ihr neckisches Spiel, oder hatte mein ermüdetes Auge wirklich einige Male empor spritzende Wasserstrahlen bemerkt?
Gewiss war jener Vorgang in dem fischreichen Gewässer ein sich stets wiederholender, der auch nur beim Betrachten der stimmungsvollen Szenerie meine unverdiente Aufmerksamkeit gefunden. Ein kurzer menschlicher Aufschrei beendete jede Erwägung. Noch einmal erschallte der Klageruf durch die Nacht. Da – da - zwanzig Fuß vom Schiffe entfernt, tauchte abermals jene rätselhafte Gestalt empor, ein Zweifel war bei dieser geringen Entfernung nicht mehr möglich, in den klaren vom Mondlicht übergossenen Fluten schwamm ein menschliches Wesen.
Regungslos stand ich auf meinem Platze und blickte klopfenden Herzens auf die jetzt nur noch wenige Schritte vom Schiffe entfernte Gestalt. Was sollte ich in diesem kritischen Augenblicke beginnen? Ohne mir selbst Rechenschaft von meinem Tun geben zu können, warf ich das zunächst liegende Tau über Bord. Nach wenigen Sekunden zuckte es in meinen das Tauende umklammernden Händen; gleichzeitig ertönte abermals jener unerklärliche Ruf, als wolle man mir das Zeichen geben, dass das hilfreiche Tau erfasst sei. Zitternd zog ich das Tau ohne jede Anstrengung langsam empor. Nach dem Umfange des emporgezogen Seiles zu schließen, musste jeden Moment die menschliche Gestalt in der Höhe der Brüstung erscheinen. Bei meinem einige Fuß niedriger gelegenen Standorte war es mir nicht möglich, die nahende Gestalt früher zu erblicken, bis sie jenen Höhepunkt erreichte. Die letzten Augenblicke steigerten meine fieberhafte Spannung!
Noch einmal zog ich kräftig an, eine menschliche Stimme erscholl dicht unter der Brüstung, jetzt wurden die Hände - der Kopf sichtbar – sogleich darauf schwingt sich eine zarte Gestalt über die Brüstung – in meinen zitternden Armen ruht wonnetrunken Kierko, die liebliche Königstochter. Ein glückseliges Lächeln strahlt aus den seelenvollen Augen des schönen Mädchens; leises Beben durchzuckt ihren von glitzernden Wassertropfen übersäten Körper. Mechanisch hielt ich die regungslose Gestalt umschlungen. Eine fieberhafte Erregung hatte sich meiner bemächtigt, wie ließ sich das rätselhafte Erscheinen des schönen Mädchens erklären? Welcher Beweggrund hatte es zu seiner gefahrvollen Wanderung bestimmt? In der Hoffnung, der in der Kajüte schlafende Davis würde erwachen und mir alles erklären, rief ich den Namen des zauberischen Mädchens. In diesem Moment fühlte ich den stärkeren Druck ihrer Hände, deutlicher vernahm ich die Schläge ihres Herzens. Kierkos fieberhaft erglühte Antlitz ruhte an meiner Brust. –
Ein frischer, fast eisiger Wind strich über das Schiff und weckte mich gewaltsam aus meinem traumähnlichen Sinnen. Trotz der empfindsamen Kälte war das dem Wasser entstiegene Mädchen bald entschlummert; die außergewöhnliche Aufregung beim Emporziehen wie nicht minder das andauernde Schwimmen und Tauchen mussten die Kräfte dieses rätselhaften Naturkindes erschöpft haben.
Behutsam trug ich die Schlafende in die Kajüte, bedeckte sie mit schützenden Tüchern und eilte dann zur Schlafstätte des alten Davis. Es währte eine geraume, mir eine Ewigkeit scheinende Zeit, bevor ich die erhoffte Erklärung des gleichgültig dreinschauenden Mannes erhielt.
„Darum brauchen Sie meinen Schlaf nicht zu stören“, brummte der Alte verdrießlich, „habe Ihnen ja gesagt, dass sich das Mädchen als Ihr Eigentum betrachtet.“
„Aber weshalb musste es den gefahrvollen Weg wählen?“
„Gefahrvoll, Herr? Jedes sechsjährige Kind bringt das fertig, ist das Ufer doch kaum vierzig Minuten entfernt?“
„Und wenn ich nicht zufällig die Schwimmerin bemerkt oder kein Tau zur Stelle gehabt?“
„Dann wäre Kierko so oft gekommen, bis Sie ihren Ruf vernommen hätten. Nun lasst mich aber schlafen, Herr.“
„Nicht früher, bis Du mir versprichst, das Mädchen bei Tagesanbruch ins Dorf zu geleiten.“
„Werde mich hüten, Herr, wenn Kierko nicht freiwillig zurückkehrt, bleibt sie bei uns an Bord. Sie ist ein kluges Kind, Herr, wird alles rasch erlernen und kann uns Speise und Trank bereiten, während wir unser Geschäft betreiben; gute Nacht, Herr.“
Mein längeres Bemühen, den richtigen Ausweg zu finden, war vergeblich. Schon dämmerte das neue Tageslicht am fernen Horizont und noch immer fand ich die ersehnte Ruhe nicht.
Die raue Stimme meines Dolmetschers weckte mich aus meinem Schlummer. Um mir den Beweis seiner Behauptungen zu liefern, hatte er bereits dem jungen Mädchen Unterweisung in der Bereitung des Morgengetränkes gegeben. Lächelnd überreichte mir Kierko das Gefäß. So hatte ich also nicht geträumt, konnte das liebliche Traumbild mit meinen Blicken erfassen; mein Widerstand war zu Ende. Aber soviel in meiner Macht stand, wollte ich die allzu klar erkennbare Absicht des unbewussten Naturkindes vereiteln. Zunächst wurde aus meinem Tüchervorrat eine ausreichende Umhüllung geschaffen. Kierko war zwar hocherfreut, fühlte sich aber in ihrer neuen Toilette augenscheinlich sehr beengt. Nach wenigen Minuten unternahm meine bekleidete Prinzessin den begreiflichen Versuch, sich der schützenden Hülle zu entledigen. Davis eröffnete ihr indessen meinen bestimmten Befehl, dass sie sofort mein Schiff verlassen müsse, wenn die Tücher entfernt würden.
„O lokoi, lokoi (Welche Überraschung)“, begann das zarte Geschöpfchen traurig, was hat denn Kierko verschuldet, dass man sie gewaltsam einzwängt?“
„Clow Rupack, mein weißer Herr wünscht es“, entgegnete mein Dolmetscher verdrießlich, „gib ihm deine letzte Erklärung.“
„Ich will die Tücher tragen“, erwiderte die bezähmte Widerspenstige leise, den tränenfeuchten Blick auf mich gerichtet, als ob sie noch eine Zurücknahme meines Befehls erwarte. Wurde auch die schöne Haltung, die elastischen Bewegungen des graziösen Mädchens wesentlich beeinträchtigt, so blieb es doch bei meiner Bestimmung. Kierko hat ihr Versprechen getreulich erfüllt.
Nun konnte ich endlich meine geschäftliche Tätigkeit beginnen. Am Strande wurden Schuppen mit drei übereinander abgeteilten Schichten aus Bambus, sowie mehrere große eiserne Kessel aufgestellt; damit war die Einrichtung zum Bereiten des Biche la mar beendet.
Sobald die vom König beorderten Männer, Weiber und Kinder mit ihren zahlreichen Kanus erschienen, begann das Einfangen der wurmartigen Holothurien. Dieses eigentümliche, dunkelfarbige Tier nistet vorzugsweise in der Nähe der Korallenriffe und liegt bewegungslos auf nicht allzu tiefem Meeresgrunde. Behutsam streicht das Kanu über die klare Wasserfläche. Sobald das scharfe Auge des Eingeborenen die bewegungslose Beute erblickt, schnellt er wie ein Fisch in die Tiefe hinab, ergreift mit beiden Händen das einem Riesenschwamm gleichende Tier und kehrt, rasch nach oben schwimmend und seinen Fang ins Kanu werfend, ohne geringste Erschöpfung zurück. Diese Arbeit wird solange fortgesetzt, bis die Taucher ein ansehnliches Quantum gesammelt haben.
Das Tauchen der Yap-Bewohner, ohne Unterschied des Geschlechts und Alters, ist wahrhaft bewunderungswürdig. Es erscheint ihnen eine Lust, den Meeresgrund zu erreichen und die verschiedensten Tiere als Nahrungsmittel zu erhaschen. Sobald die Taucher mit ihrer Ladung zurückkehren, wird dem Führer des Kanus der vereinbarte Preis, meist eiserne Behälter, Feuersteine und dergleichen am Landungsplatz ausgesucht. Die eingelieferten Holothurien werden zunächst gereinigt, insbesondere vom Sand befreit, dann mittelst scharfer Messer am Bauche aufgeschlitzt, um die wertlosen Eingeweide zu entfernen. In dieser Beschaffenheit werden sie in großen, mit Seewasser angefüllten eisernen Kesseln bis an den Rand derselben geschichtet, mit Blättern des Kukau bedeckt und dann das Feuer unter den großen Behältern angezündet. Unter der Einwirkung des kochenden Wasserdampfes schrumpfen die Tiere immer mehr zusammen und erreichen nach drei bis vier Stunden den ersten Härtegrad. Dieses Kochen und Dämpfen wird einige Male, nur mit dem Unterschiede, dass statt Seewasser nun Süßwasser benutzt wird, wiederholt... Sind die wesentlich eingeschrumpften Holothurien genügend gedämpft, so beginnt die letzte am längsten währende Arbeit des Trocknens und Dörrens... Sowohl das gleichmäßige Härten des Trepangs..., wie die genaue Farbbestimmung bilden die wesentlichen Bedingungen für die Bereitung dieser in China sehr beliebten Delikatesse. Dort oder auch in Städten, wie beispielsweise in Manila, wo zahlreiche Chinesen ansässig sind, besitzt Trepang, auch Biche la mar genannt, die selbe Bedeutung, wie in Europa die Austern... Natürlich können sich nur reiche Chinesen diesen Luxus gestatten. Übrigens ist es nicht ausschließlich der Wohlgeschmack, welcher den körperlich erschlafften Sohn des himmlischen Reiches bestimmt, für diese eigenartige Kostbarkeit hohe Preise zu zahlen. Nach chinesischem Dafürhalten soll auch der leicht zu verdauenden Gallerte ein Reizmittel inne wohnen, welches die zerrüttete Lebenskraft wieder neu belebt...
Die Gewässer der Yap-Inseln erwiesen sich für meinen Trepangfang als sehr ergiebig. Ich hatte demnach genügend Zeit, mich mit den Sitten und Gewohnheiten der Eingeborenen sehr rasch vertraut zu machen.
Dank der aufopfernden Hingabe der klugen Königstochter wie nicht minder des erfahrungsreichen Dolmetschers erlernte ich die schwierige Sprache dieses Volkes zum Erstauen des Königs sehr rasch und konnte wenigstens bald eine selbständige Unterhaltung führen...
Während Davis den geschäftlichen Teil versah, Kierko als Mädchen für alles die häuslichen Obliegenheiten mit einer anerkennenswerten Geschicklichkeit und Freudigkeit verrichtete, wandelte ich oft stundenlang in die reizende, ziemlich hügelige, von dichtem Wald begrenzte Landschaft. Hier rangt sich an hohen Stangen eine Schlingpflanze hinauf, deren Knollen, Yams genannt, oft sechzig Pfund schwer werden und die einen ähnlichen Geschmack wie unsere Kartoffeln besitzen...
Nach einem achtmonatigen Aufenthalt wurden die Anker gelichtet. Ein günstiger Wind blähte die Segel meines vollbeladenen Schiffes. Bald lag das offene Meer wieder vor mir...
Kapitän Cheyne, der während dieser Zeit auf Malaccan die Geschäfte betrieb, war über meinen außergewöhnlichen Erfolg sehr erfreut, konnte sich aber von einer mir unerklärlichen Besorgnis nicht befreien. „Gut, dass Sie jetzt eintreffen“, begann Cheyne, nachdem ich die wichtigsten Geschäftsvorfälle gemeldet, „mein Haus wurde seit Wochen von den Eingeborenen belagert, sie trachten mir nach dem Leben und haben jeden geschäftlichen Verkehr eingestellt. Unter diesen Umständen habe ich den Entschluss gefasst, alle Wertsachen an Bord zu nehmen und die Insel sofort zu verlassen. In Manila werde ich Ihnen den auf Ihren Anteil entfallenden Gewinn auszahlen. Vielleicht können wir dort ein sicheres Unternehmen beginnen!“
Zunächst schien mir dieser wohlwollende Vorschlag als eine List, erst nach längerer Auseinandersetzung erkannte ich jedoch zur Genüge, dass mein Teilhaber tatsächlich für seine persönliche Sicherheit fürchtete und nur aus diesem Grunde das ergiebige Geschäft aufzulösen beabsichtigte. Ich teilte daher dem furchtsamen Manne mit, dass ich entschlossen sei, allein zurück zu bleiben und den Verkehr mit den Eingeborenen von Palau wieder zu eröffnen wage, wenn ich die Hälfte des Gewinns erhalten würde.
Cheyne war für mein Leben keineswegs besorgt. Mit vieler Freude willigte er in jede meiner Bedingungen ein; die wenigen wertlosen Tauschwaren, die mir zum Handel überwiesen wurden, waren ja kaum ein Einsatz zu nennen, außerdem hätte Cheyne ein ziemlich solides Haus unter allen Umständen preisgeben müssen, er riskierte eigentlich nur meinen Kopf; - freilich nur ein bescheidenes Anlagekapital!
Alle auf dem Schiffe befindlichen Gegenstände, die mir nützlich erschienen, namentlich sämtliche Geschütze und überflüssiges Tauwerk wurden nunmehr ins Haus geschafft. Sobald Cheyne seine ganzen Vorräte an Trepang, Schildpatt und Kopra gesammelt, wollte er seine Abreise antreten. Wäre nicht bereits die für das Auslaufen höchst gefahrvolle Dunkelheit eingetreten, er hätte noch an demselben Abend das Weite gesucht.
Die vielleicht berechtigte Furcht meines Teilhabers konnte meine Zuversicht nicht gerade erhöhen, aber jetzt noch zurückzutreten war mir unmöglich...
Am frühen Morgen verließ Cheyne mit seinen Getreuen den Hafen von Korror. Gedankenvoll betrachtete ich das enteilende Schiff am fernen Horizont. Die letzte Brücke zwischen mir und der zivilisierten Welt war verschwunden. Nun galt es, einen bestimmten Plan zu verfolgen. Zunächst entfernte ich alle Gegenstände, welche als Schutzgatter des Hauses gedient, ging ohne Waffen zur Fischjagd, holte Früchte aus den fernen Wäldern und bewegte mich so sorglos wie möglich.
Anfänglich hielten sich die Abgesandten des Königs zwischen Pflanzen und Bäumen sorgfältig verborgen und schenkten meinem Tun und Treiben die größte Aufmerksamkeit. Absichtlich durfte ich keinen der königlichen Berichterstatter bemerken; wollte man mit mir unterhandeln, so mussten die Annäherungsversuche vom Könige ausgehen. Volle drei Tage wurde dieses gegenseitige Sondierungsspiel fortgesetzt. Endlich entschloss sich der König zu einer direkten Einladung, der ich anstandslos Folge leistete.
„Clow Rapack“, begann der König nach der ersten kühlen Begrüßung, „ist das ein Beweis deiner Freundschaft, wenn du unsere Nähe meidest? Was veranlasst dich zu deiner Abschließung? Hat man dir Böses zugefügt, so sprich es aus und die Bestrafung soll erfolgen!“
Zunächst versicherte ich den König meiner Freundschaft, berichtete dann wahrheitsgetreu, in welcher wenig vertrauenerweckenden Lage ich Cheyne angetroffen habe und dass ich auch entschlossen sei, das Geschäft in Palau fortzusetzen, wenn der König mir die Erlaubnis dazu erteilen wolle.
„Es soll dir erlaubt sein, Clow Rupack, alles was du nur wünschest, werden dir meine Leute verkaufen; nur verhüte, dass der schlechte Mann zurückkehrt, wir glauben seinen falschen Worten nicht mehr. Jahrelang haben wir ihm eine Unmasse Trepang, Schildpatt und Kokosöl geliefert, alle Arbeiten für ihn verrichtet, weil er versprach, uns zum mächtigsten Stamme der Insel zu erheben. Dafür hatten wir ihm Malaccan als sein Eigentum übergeben, aber weißt du, wie er sein Versprechen hielt? Unseren Feinden hatte er dasselbe zugesichert, ihnen Schießwaffen geliefert, um uns zu verderben. Cabel Mul (Kapitän Woodin) und ganz besonders Era Tabatteldil (Doktor Karl Semper) haben mir die wahre Absicht des falschen Mannes schon lange vorher mitgeteilt. Era Tabatteldil hat auch den Kontrakt gelesen, der unser Land England ausliefern sollte; wir haben das Ding unterschrieben, ohne den Inhalt zu kennen, weil wir seinen Worten glaubten und ich ein schönes Gewehr erhielt. Sobald wir mit unseren Nachbarn in Frieden lebten, hat er mit Hilfe seiner Freunde falsche Nachricht verbreitet und uns in den unnützen Kampf getrieben. Nicht nur meine, auch die Frauen der ersten Häuptlinge, hat er durch schöne Geschenke in sein Haus gelockt und sie schlecht behandelt, wenn sie sich seinem Willen nicht unterwerfen wollten. Das alles hat uns der böse Mensch getan. Nun, Clow Rupack, sage mir, ob er wieder zurückkehren wird?“
Wenngleich der König ein zutreffendes Bild von seinem Gegner entworfen, Kapitän Cheyne ein hinterlistiger, brutaler Mensch war, der zur Durchführung seiner eigennützigen Pläne vor nichts zurückschreckte, so fürchtete doch der König vor allem das Eintreffen eines englischen Kriegsschiffes, mit welchem Cheyne immer erfolgreich gedroht hatte... „Cabel Schée (Kapitän Cheyne) wird zwar zurückkehren“, erklärte ich zum Schlusse unserer Verhandlung, „aber er wird das Land nicht betreten, weil ihr ihm keinen Trepang mehr liefern wollt. So lange wir befreundet bleiben, wird auch kein englisches Kriegsschiff eintreffen.“
„Nein, Clow Rupack, darum bist du auch unser Freund. Am nächsten Morgen sollen meine Leute für dich bereit sein...“
* * *
Kapitän Alfred Tetens verbrachte noch längere Zeit voller gefährlicher Abenteuer und Entbehrungen auf Palau, bis er durch Kapitän Cheyne mit dessen Brigantine ACIS wieder abgeholt und nach Manila gebracht wurde. Er setzt seinen Lebensbericht fort:
Ich verließ die ACIS und erreichte Hongkong in der Absicht, von hier aus meine Rückreise nach Europa anzutreten. Der Zufall widersetzte sich diesem Beschlusse. Statt als harmloser Passagier der Heimat zuzueilen und einmal die jahrelange berufliche Anstrengung auf angenehme Weise zu unterbrechen, sah ich mich zum verantwortungsvollen Führer eines großen amerikanischen Klipperschiffes, der „PERSEVERANCIA“, ernannt und sofort mit den mannigfachsten Arbeiten überhäuft. Mit der ganzen Kraft meiner wiedererwachten Energie ging ich an die zwar schwierige, aber auch lohnende Aufgabe und fand nach Beendigung der notwendigen Arbeiten noch ausreichende Zeit, zunächst die Wunderstadt Hongkong zu betrachten. Nachdem dieses geschehen, trieb mich das Verlangen, auch die Umgebung dieses chinesischen Babels kennen zu lernen...
Die unter peruanischer Flagge segelnde PERSEVERANCIA war zur Überführung von 600 chinesischen Auswanderern , sogenannten Kulis, von Macao, der portugiesischen Besitzung in China nach Peru bestimmt. Im Gegensatz zu dem ablehnenden Bewerber hatte mich die mit der Fahrt verbundene Gefahr zur Annahme dieses Kommandos bestimmt.
Ich hatte ja bei dem Verbrechertransport so viele Erfahrungen gesammelt, dass ich die stehenden Ausschreitungen der verschmitzten Chinesen nicht zu fürchten brauchte. Der einzelne Kuli ist meistens ein energieloses, feiges Menschenkind, das aber in großen Haufen zum blutdürstigen Mörder , zum wahren Raubtiere wird, solange es sich in der Nähe der Küste befindet. Es gehörte zu jener Zeit nicht zu den seltenen Begebenheiten, dass chinesische Auswanderer die Besatzung des Schiffes meuchlings ermordeten oder im offenen, sehr ungleichen Kampfe über Bord warfen und sich dann des Schiffes bemächtigten. Äußerste Vorsicht war demnach geboten. Ein glücklicher Zufall kam mir zustatten. In Hongkong, wo ich meine Besatzung anmusterte, befanden sich zur Zeit eine außergewöhnlich große Anzahl dienstsuchender deutscher Seeleute; da ich an eine bestimmte Anzahl nicht gebunden war, überhaupt die freieste Verfügung besaß, so war es mir ungemein lieb, meine ganze erforderliche Mannschaft aus Landsleuten zu wählen. Meine doppelte Besatzung bestand außer dem holländischen Obersteuermann aus 42 handfesten, kernigen, deutschen Matrosen, gewiss ein seltener Umstand, der meine Zuversicht noch mehr erhöhte. Meine Wahl war ja nicht ausschließlich mit Rücksicht auf meine persönliche Neigung, nur Landsleute an Bord zu haben, erfolgt, sie war auch nach gewissenhafter Erwägung für die Vorzüge des nüchternen, zuverlässigen und verträglichen deutschen Seemannes geschehen.
Fröhlichen Mutes begannen wir jetzt unsere Vorsichtsmaßregeln, die im großen Ganzen fast dieselben waren, welche wir seiner Zeit beim Verbrechertransport beachtet hatten. Hinter dem großen Mast, quer über das Verdeck wurde eine starke Barrikade errichtet, die Luken mit eisernen Gittern versehen, um unsere bezopften Passagiere während der Nacht oder bei etwaigen Revolten im sicheren Gewahrsam halten zu können. Hinten auf dem Quarterdeck waren vier scharf geladene Kanonen aufgepflanzt und so gerichtet, dass sie das Verdeck nach vorne vollständig beherrschen konnten. Für die Mannschaft wurde das Hinterteil des Zwischendecks mit einer starken Bretterwand abgeschlossen und zum geschützten Aufenthaltsraum hergerichtet. Außerdem wurden die unteren Schiffsräume gegen das zu erwartete Eindringen der Chinesen so gut gesichert, dass wir nach menschlicher Voraussicht unsere Fahrt getrost beginnen durften.
Wie die Unterhaltung, so wurden auch die gewöhnlichen Kommandos in dem deutschen Seefahrern sehr gebräuchlichen niederdeutschen Dialekt geführt. Jedenfalls war es für mich, dem dänisch geschulten, englisch erzogenen, auf amerikanischem Schiffe befindlichen, unter peruanischer Flagge segelndem, Chinesen befördernden Deutschen ein überaus anheimelnder Moment, ausschließlich die Sprache meiner engeren Heimat zu hören. Auf deutschen Schiffen dominiert naturgemäß das plattdeutsche Idiom; es sind ja vorzugsweise die Söhne unseres niederdeutschen Staatsgebietes, welche unserer Marine bislang das stärkste Pflichtteil stellten und vermöge ihrer angeborenen Neigung zum Wasser den guten deutschen Seemannsberuf erworben und erhalten haben. Wir können uns daher nur zu der im Volke herrschenden Ansicht bekennen, dass vorzugsweise das Niederdeutsche zur Seefahrt sich eignet. Die Söhne der mittel- und süddeutschen Stämme neigen ja selbstverständlich zum festländischen Beruf; entschließt sich aber der Binnenländer für die seemännische Laufbahn, dann wird er in manchen Fällen ein ganz vortrefflicher Seemann, der gegen seinen norddeutschen Bruder in nichts zurücksteht. Nur das herrschende Plattdeutsch macht dem „Hochdütschen“ viel Schwierigkeiten und gibt dem „an de Waterkant“ Geborenen vielfach Stoff zur belustigenden Unterhaltung. Verdeckfähig ist allein die Mundart des Holsteiners und Hamburgers; ihnen schließen sich an: die in Mecklenburg, Hannover, Schleswig, Oldenburg, Preußen, Bremen und Lübeck leicht hörbaren Abstufungen. Der Thüringer, Hesse, Württemberger, Bayer, Badenser beteiligt sich nur noch mit ganz bestimmten Wendungen an der Pflege des plattdeutschen Sprachgebrauchs. Sachsen aber wird von seinem im Inlande sehr beliebten und verbreiteten Dialekt so in Anspruch genommen, dass es nur einige niederdeutsche Worte und diese auch nur mit recht sächsischem Tonfall zum Ausdruck bringt.
Meine fast alle Staaten Deutschlands repräsentierende Mannschaft gab mir schon am ersten Tage ihres Dienstantritts die Gelegenheit, interessante Beobachtungen auf sprachlichem Gebiete zu machen. Ich hielt eine von einem älteren Matrosen empfohlene Vorsichtsmaßregel für nutzlos und würde dieselbe abgelehnt haben, wenn mich nicht ein vollberechtigter Einwand des in Erregung geratenen Fürsprechers daran gehindert hätte. Als ich die ersten im unverfälschten Dialekt gesprochenen Worte meines voraussichtlichen Bootsmannes vernommen, war mir zu Mute, als befände ich mich auf der Brühlschen Terrasse und tränke in der Gesellschaft gemütlicher Dresdener „mei Deppchen“ Bier.
Nur mit der größten Anstrengung konnte ich meine Heiterkeit verbergen, ich blickte zu Boden, als habe ich mich von der Zweckmäßigkeit jener Einrichtung vollkommen überzeugt, in Wahrheit verharrte ich in dieser Stellung nur, um das Zartgefühl des redseligen Landsmannes nicht zu verletzen und seinen verführerischen Heimatlauten noch ferner lauschen zu können.
„Weeß Knebbchen, Herr Kapitän, Sie därfen sich druf verlassen, ich mache Sie keen Gefitze nich, aber die Chinesen – gehen Se mer weg, die Bridersch hab’ ich Sie aber gründlich kennen gelernt. Damals, vor zwee Jahren hatten mer sone Schticker 700, die sollten mer ooch nach „Calchao“ bringen. Na, un uf’n Haar hätten se uns zu Aeppelmus gequetscht, ei ja! So lang die Chinesen noch Land wittern, sind se, weeß Gott, die reenen Ludersch.“
Meinem redegewandten Bootsmann in diesem Augenblicke zu widersprechen war mir unmöglich; ich willigte gern ein, noch eine weitere Sicherheitsmaßregel, die sich im Laufe unserer Reise auch wirklich sehr bewährte, anzuordnen. Manche Erfahrungen, die mein „heller Sachse“ auf seinem früheren Chinesentransport gewonnen, kamen jetzt unserer Einrichtung zur Beförderung der 600 Kulis ungemein zustatten. Die Vertreter der peruanischen Regierung hatten zu jener Zeit ihren Aufenthalt in Macao, dem zur Einschiffung der Chinesen am günstigsten gelegenen Hafen, genommen. In einem chinesischen Hafenplatze wäre die Anbordnahme zahlreicher Eingeborener, sobald sie zur Kenntnis der Behörde gekommen, mit dem Tode bestraft worden. Hatten die Söhne des himmlischen Reiches erst den Schlupfwinkel Macao erreicht, dann waren sie geborgen und mit ihrem ferneren, traurigen Schicksale, wie es sich auch gestalten würde, sehr zufrieden. Welche Arbeit man ihnen in fremden Landen auch auferlegte, welch’ winzigen Lohn man ihnen auch zusicherte, die unglücklichen Geschöpfe waren mit allem einverstanden. In dem übervölkerten China, wo unausgesetzt Hungersnot und Epidemien herrschten, täglich Massenhinrichtungen gänzlich unschuldiger Menschen stattfanden, hatte ja ihr Leben gar keinen Wert. Wohl keine Rasse der Erde besitzt so wenig Bedürfnisse wie die mongolische, ihr menschliches Empfinden steht auf einer so niedrigen Kulturstufe, wie ich sie niemals bei den unzivilisierten Bewohnern Australiens bemerkt habe. Der Jahrtausende eingepferchte Mongole repräsentiert seine einstmals entwickelt gewesene Rasse nur noch in seiner äußeren Gestalt; wo der Chinese sich einnistet, entzieht er jedem denkenden Menschen die Lebensbedingungen; für die Staaten aber, die sich seiner zu Kulturzwecken bedienen, ihm willig ihre Pforten öffnen, wird der bezopfte „Ameisenhaufen“ einstmals zur gefahrdrohenden Landplage werden.
Das kontraktliche Verhältnis der Kulis mit der peruanischen Regierung war auf acht Jahre geschlossen. Der für jede zu verrichtende Arbeit festgesetzte Preis war so gering, dass die peruanischen Vertreter sich wohl der festen Überzeugung hingeben durften, im Interesse ihres Landes gewirkt zu haben; - die Chinesen hatten noch niemals „solch fabelhafte“ Summen für ihre Arbeit erhalten, so stand also vor der Hand ein erträgliches Verhältnis in Aussicht. Ursprünglich hatte der Chinese wohl kaum die Absicht verfolgt, für immer der Heimat zu entsagen, er suchte ein bescheidenes Sümmchen im Auslande zu erwerben, um dann im himmlischen Reiche den Rest seiner Tage als Krösus zu verleben!
In allen Kontrakten hatten sie sich eine freie Rückfahrt nach Beendigung ihrer Dienstzeit bedungen, aber wie später die Regierung zu ihrem Bedauern einsah, haben die „gelben Heuschrecken“ von diesem Vorbehalt nur selten Gebrauch gemacht. Ausgerüstet mit einer kleinen Kiste, welche einen kompletten Anzug: blauen Kittel, chinesische Schuhe und Beinkleid enthielt, kamen die Kulis in Begleitung eines chinesischen Arztes und des Dolmetschers an Bord, wo schon nach wenigen Minuten ihre häusliche Einrichtung erfolgte. Auch der Reeder erschien noch einmal an Bord, um die letzten geschäftlichen Anordnungen zu treffen. Bei seinem Abschiede überlieferte er mir ein eigenartiges Geschenk, zum Zeichen seiner besonderen Zuneigung. Es bestand aus einem zehnjährigen allerliebsten chinesischen Knaben, namens Afoo, der mit diesem Wechsel sehr erfreut schien und sehr bald der erklärte Liebling der ganzen Mannschaft wurde. Afoo, den ich als Mandarin mit seidenem, gesticktem Gewand, Mandarin-Kappe usw. sehr luxuriös eingekleidet, verrichtete den Dienst eines Leibdieners in höchst zufriedenstellender Weise. Schon nach wenigen Wochen konnte sich der intelligente Knabe in der englischen Sprache genügend unterhalten.
Während der Einschiffung drängte eine große Anzahl chinesischer Weiber , kleine Kinder tragend, nach der Schiffbrücke. Hier in meiner unmittelbaren Nähe streckten mir die Mütter ihre schreienden Sprösslinge mit dem unaufhörlichen Ruf im sogenannten Pidjin-Englisch entgegen: „Want you buy, Mr. Captain? Three Dollers each.“ Trotz des billigen Preises lehnte ich das “liebevolle” Angebot dankend ab. Ob nur der Mangel an Dollars oder der Überfluss an Nachkommen dieses unheimliche Geschäft ins Leben gerufen, weiß ich nicht.
Je zehn Chinesen bildeten eine sogenannte Backgesellschaft, die in engerer Gemeinsamkeit ihre Speisen einnahm und alle erforderlichen Arbeiten wie eine Familie verrichtete. Das einmal festgesetzte Menü wurde niemals gestört, die Verpflegung während ihrer dreimonatlichen Reise war am letzten Tage genau dieselbe wie am ersten, ohne dass der chinesische Magen auch nur die geringste Ermüdung verspürte.
Eine größere heroische Leistung habe ich nie von Chinesen gesehen. Am Morgen und Abend wurde ihnen heißer Tee verabreicht; das eigentliche Hauptmahl „Tschau-Tschau“, Reis mit getrocknetem Fisch und Pickels, wurde zur Mittagszeit in einem überaus lebhaften Tempo eingenommen.
Es gab aber auch unter den Chinesen einige „Feinschmecker“, die sich eine Abwechslung der Speisekarte dadurch verschafften, dass sie sich während der Nacht an Bord Ratten fingen, diese nach chinesischer Art zubereiteten und mit großem Behagen verspeisten. Ich habe niemals tüchtigere „Rattenfänger“ an Bord gesehen. Auf Deck befanden sich mehrere oxhoftgroße, mit kaltem Tee gefüllte Fässer, welche den Chinesen vermittelst eines Saugrohres Gelegenheit gaben, ihre trockenen Kehlen während des Tages anzufeuchten. Auch nach dieser Richtung entwickelten die gelben Passagiere eine Rührigkeit, die unseren Schiffskoch samt seinen vier Assistenten fast zur Verzweiflung brachte.
Während der ersten Tage nach Beginn unserer Fahrt war nicht die geringste Veränderung im Wesen der Chinesen zu bemerken, trotzdem hielten wir unausgesetzt unsere Augen offen und achteten auf die unwesentlichsten Vorkommnisse. Durch Vermittlung eines Dolmetschers wurden außerdem vier ältere Chinesen gegen eine geringfügige Vergütung als Spione angestellt. Diese „Bevorzugung“ schmeichelte den Auserwählten ungemein; sie versicherte, jede unter ihren Genossen etwa verabredete Vereinbarung sofort zu melden. Ich versprach diesen wenig „gewissensängstlichen“ Chinesen nach treuer Pflichterfüllung eine besondere Belohnung mit dem Hinzufügen, dass Verrat und Nachlässigkeit mit dem Tode bestraft würde. Die Bedingung erwies sich, wie die späteren Ereignisse ergeben werden, als durchaus praktisch.
Ein überaus günstiger Wind schwellte unausgesetzt unsere Segel, wir machten eine so vorzügliche Fahrt, dass wir schon am neunten Tage nach unserem Auslaufen von Macao die Banka-Straße passierten. Hier aber schlug plötzlich das Wetter um, dem sicheren Anzeichen des Sturmes folgte auch sofort der Beginn. Schaumspritzende, windgepeitschte Wogen schlugen über Bord, grau und düster wie die undurchsichtige Luft erschien auch das empörte Meer. Die PERSERVERANCIA glitt unaufhaltsam über die sich wälzenden Wasserberge hinweg. Noch war keine Veränderung in der Segelstellung erforderlich, aber aufmerksam gespannt, jeden Moment die Befehle erwartend, standen meine deutschen Teerjacken wie Statuen bereit.
Während wir nun den eigentlichen Ausbruch des Sturmes erwarteten, befanden sich sämtliche Chinesen meinem Befehle gemäß im Zwischendeck; ihre lächerliche Furcht vor dem tobenden Wetter hätte nicht nur unsere Manövrierfähigkeit stören, sondern auch mancherlei Unordnung veranlassen können. Wir durften also wohl annehmen, dass unsere Passagiere, mit ihrer gewöhnlichen Unterhaltung beschäftigt, am allerwenigsten bei solchem Wetter Böses im Schilde führten. Laute Rufe, welche in kurzen Pausen erschallten, schienen unsere Voraussetzung zu bestätigen, um so überraschender musste die Nachricht des herbeistürzenden Dolmetschers auf uns wirken, welche er vom Spion erhalten und wonach sich sämtliche Chinesen im vollen Aufruhr befänden und im nächsten Augenblicke den Angriff auf die Besatzung unternehmen würden. Jetzt gab es keine Zeit zur langen Überlegung, nur ein rasches, energisches Vorgehen konnte das drohende Unheil abwenden. So schnell es Seestiefel und Ölzeug-Anzug gestatteten, stürzte ich ins Zwischendeck hinunter und stand nach wenigen Minuten dem tobenden, schreienden, gestikulierenden Haufen gegenüber.
Einen scheußlicheren, widerlicheren Anblick habe ich nie erlebt! Der ganze Raum glich einem brodelnden Riesenkessel, aus welchem immer mehr unterirdische Gestalten hervorquollen. Die nicht aus meiner Nähe gewichenen verwegensten Gestalten, welche mich mit Messern bedrohten, streckte mein englischer Polizeiknüppel mit einem Schlage nieder. Schreiend und heulend wich die Masse zurück. „Ruhe hier, in Eure Kojen!“ donnerte ich jetzt mit der ganzen Kraft meiner nicht unwesentlichen Stimme den betroffenen Chinesen entgegen; dieses übliche Kommando tat seine Wirkung, der sinnbetäubende Lärm wurde im nächsten Augenblick unterbrochen. „Wer sind die Anstifter?“ rief nach meiner Weisung der inzwischen herbeigeeilte Dolmetscher. Zahllose Hände bezeichneten zwei besonders markante Chinesen als die Leiter des Aufstandes.
Mit Blitzesschnelle, ehe diese in dem noch immer wogenden Knäuel verschwinden konnten, hatte ich sie ergriffen, umwickelte mit ihren langen Zöpfen meine Hände und konnte in dieser bequemen Weise meine Beute nach wenigen Minuten in sicheren Gewahrsam auf Deck befördern. Bedrückt von ihrer Schuld, in sehr richtiger Folgerung nichts Gutes erwartend, hatte es meine „chinesische Auslese“ mehrere Male mit Niederwerfen versucht, um sich von meinem unausgesetzten Zerren und Ziehen zu befreien, aber glücklicherweise waren ihre Zöpfe echte, noch nicht von europäischer Kunstfertigkeit angekränkelte Naturprodukte, die ehrlich aushielten und sich nicht bei der geringsten Veranlassung von ihren Besitzern trennten.
Die deutsche Zugkraft war, wie sich später ergab, nicht spurlos auf die chinesischen Zöpfe verwandt worden; die Breite des bezopften Kleinods hatte sich recht schmal gestaltet, aber es hatte mir nach Lage der Sache gewiss nicht auf ein paar Haare ankommen dürfen, vielmehr musste ich alles aufbieten, damit meinen unbesonnenen Chinesen die Lust zu ferneren Meutereiversuchen genommen wurde.
Während dieses Vorgangs hatte meine naturgemäß erregte Besatzung ihren Posten selbstverständlich nicht verlassen, als ich aber jetzt die Attentäter mit einer kurzen Erklärung auf Deck brachte, da war die Freude groß und ein kräftiger deutscher Hurrahruf hallte durch die dunkle Nacht. Kein Raum schien meinen Leuten zur Verwahrung sicher genug. Auf Vorschlag des recht ungemütlich gewordenen Sachsen blieben die beiden Chinesen bis zum Morgen an den Hauptmast gefesselt.
„Hab’ ich’s nich gleich gesagt, Herr Kapitän, das mer den Ludersch nicht trauen darf? Es wäre weeß Knebbchen das Gescheitste, mer ließe se e paar Schtunden an ihren eegenen Zöppen baumeln.“
„Dat sheelt nich genog,“ fiel ein Plattdeutscher heftig ein, „de verdreihten Kerls möt de fice Jack vull hebben.“ Von allen Seiten wurden jetzt die mannigfachsten Strafarten in Vorschlag gebracht, jeder Antragsteller trat energisch für seine warm empfohlene, wunderbar wirkende Methode ein. Immerhin war eine strenge Bestrafung im Interesse der Sicherheit durchaus geboten. Sämtliche Chinesen mussten am frühen Morgen, bevor sie ihren Tee eingenommen, auf Deck erscheinen, hier wurde ihnen vom Dolmetscher mitgeteilt, dass ihre „Brüder“ gegen Gesetzt und Ordnung verstoßen und nun in Aller Gegenwart ihre wohlverdiente Strafe empfangen würden.
Die beiden Anführer, augenscheinlich frühere Piraten, wurden auf eine schräge Leiter gebunden und ihnen verkündet, dass ihrem Rücken oder den angrenzenden Partien 27 Hiebe mit einem Tauende verabreicht würden; es läge aber in ihrer Wahl, ob sie die ganze Mahlzeit auf einmal oder in kleineren Portionen zu je neun Stück einnehmen wollten.
Unsere wenig standhaften Missetäter entschieden sich einstimmig für eine dreimalige Bedienung. Dagegen protestierten aber die übrigen Chinesen ganz entschieden, sie wünschten, dass eine einmalige Vollstreckung stattfände; wir hatten allen Grund, diesen Majoritätsbeschluss auszuführen, allein schon, um den Chinesen zu zeigen, dass wir gegen ihre vernünftigen Vorstellungen nicht taub seien.
Der geehrte Leser ist gewiss der Ansicht, dass die einmalige Exekution nur aus Rücksicht für die beiden Meuterer gewünscht wurde, damit der empfindliche Schmerz mit einem Male überstanden sei, oder auch, dass das Zartgefühl der himmlischen Söhne bei Wiederholung einer wenig ästhetischen Handlung sich verletzt fühlte. O nein! So feinfühlend waren unsere Chinesen nicht. Sie wollten nur – wie prosaisch! – nicht noch zweimal bei der Einnahme ihres Morgentees gestört werden. „Die Leute,“ meinte erklärend der Dolmetscher, „können am Morgen ihren Tee nicht lange entbehren, bei leerem Magen wirkt das Schreien der Meuterer viel stärker auf ihre Nerven und ihre Empfindung.“
...Ich ließ nach vollzogener Exekution sämtlichen Chinesen vom Dolmetscher verkünden, dass jedem, der gegen die Ordnung verstoße oder ähnliche Dummheiten wie die Bestraften mache, dasselbe Schicksal in bedeutend verbesserter Auflage bereitet werde, dass ich aber bei guter Aufführung und folgsamem Verhalten alle ihre berechtigten Wünsche erfüllen, überhaupt in der vorurteilsfreiesten Weise gegen sie verfahren würde. –
Ob nun das chinesische Ehrgefühl, die Furcht vor nüchternem Magen oder gar die Bekanntschaft mit dem Tauende die gewünschte Wirkung hervorgerufen, habe ich nicht genau feststellen können, mir genügte auch die Tatsache, dass während unserer ganzen Reise nie wieder eine ähnliche Ruhestörung stattfand. Selbst der Gemütszustand unserer Passagiere erfuhr in Folge unserer Exekution eine erfreuliche Veränderung; mit der Entlarvung der Aufrührer war die gewitterschwarze Luft gereinigt, das allgemeine Alpdrücken beseitigt. Eintöniger Gesang wechselte mit den mannigfachsten Spielen, Domino, Damespiel, Fan-Tan ect., denen fast jeder Chinese mit einer unstillbaren Leidenschaft ergeben ist; der gewinnsüchtige Sohn des himmlischen Reiches erträgt die Qualen des Lebens mit erstaunlichem Gleichmut, wenn ihm nur sein Fan-Tan-Spiel nicht genommen wird.
Seinen Zopf bewacht der Chinese mit einer ängstlichen Sorgfalt; ohne diese sonderbare, seit seiner frühesten Kindheit gepflegte Kopfzierde ist ihm entweder das himmlische Reich verschlossen, oder er wird nach seiner Rückkehr als Verbrecher behandelt. Der Chinese wird von dem Zopfkultus derart beherrscht, dass er sich meistens den Tod gibt, wenn ihm der teure Kopfputz durch irgend welchen Zufall verloren gegangen ist...
Mit dem Wetter durften wir noch immer zufrieden sein. Zwar hatte schon mancher wuchtige Sturm unsere Aufmerksamkeit geprüft und uns sehr zuvorkommend daran erinnert, dass wir uns in einem recht heimtückischen Fahrwasser befanden, doch hatte er uns sonst nicht allzu oft belästigt. Die Rücksicht hörte aber sehr bald auf. Am betreffenden Tage befanden wir uns vor dem Eingange der Sundastraße; es war am späten Nachmittage, klar und deutlich lag das ganze, interessante Bild einer ruhigen See vor uns. Innerhalb weniger Minuten war der malerische Anblick gleich einer Fata Morgana verschwunden. Tiefes Dunkel verhüllte das Sonnenlicht, donnerartiges Getöse erbrauste in der Luft; ein strömender Regen, von dem zuckenden Blitzstrahl prismenartig beleuchtet, vervollständigte diese plötzliche Verwandlung.
Der Sturm brach mit ungewöhnlicher Heftigkeit los. Trotz des günstigen Windes war ich gezwungen, die doppelt gerefften Marssegel bis auf die Kappe niederzulassen, dennoch flog mein Schiff pfeilgeschwind dahin. In jedem Augenblicke hoffte ich, das Feuer von Anje in Sicht zu bekommen, aber stundenlang harrte ich vergeblich auf dieses ersehnte Zeichen. Nicht der geringste Anhalt bot sich unseren spähenden Blicken, es war nicht mehr mit Bestimmtheit festzustellen, wo ich mich befand. Solche Situation ist wohl geeignet, eine nervöse Unruhe beim verantwortungsvollen Führer hervorzurufen. Auf weitem, freiem Meere vermag der stärkste Sturm die Ruhe des erfahrenen Seemannes nicht zu erschüttern, er empfindet sogar ein gewisses von Selbstbewusstsein getragenes Behagen, mit dem dräuenden Wetter ringen zu können, er weiß, dass ihm bei ruhigem Blute, klarer Besonnenheit und scharfem Ausguck der Sieg nicht fehlen kann. Ein unbeschreibliches Hochgefühl wölbt die Brust des Führers, wenn er nach überstandenem Kampfe mit dem Sturme sein Fahrzeug gerettet, wenn menschliche Geschicklichkeit über die elementaren Gewalten triumphiert.
Aber wir befanden uns leider nicht auf dem offenen Meere, wir hofften ja jeden Moment das Feuer von Anjer zu sichten, mussten uns also zweifellos in der Nähe der Küste befinden. Unsere Lage war durchaus ernst, zahllose Leben standen auf dem Spiele; was in der menschlichen Macht stand, um das drohende Unheil abzuwehren, war freilich geschehen. Seit mehreren Stunden hatten wir unausgesetzt auf unseren Posten, jeden Moment zum Eingriff bereit, verharrt und noch immer bot sich den scharf auslugenden Blicken nicht der geringste Anhalt, vergeblich rollte das Senkblei hinab, der erwünschte Meeresgrund war nicht zu finden! Endlich lichtete sich das tiefe Dunkel, in der grau schimmernden Ferne dämmerte der Erlösung bringende Tag. Aber noch ehe ein freudiges Gefühl unsere Brust durchzog, hatten wir die drohende Gefahr erkannt; wie eine graue Feldwand flimmerte es vor unseren Augen, die nächsten nervenerregenden Sekunden brachten Gewissheit. Das Donnergetöse der nahen Brandung schlug deutlich an mein Ohr. In dem selben Moment gab ich das Kommando; fürchtend, die Leute am Steuer könnten eine Sekunde mit der Ausführung zögern oder meinen Befehl nicht verstanden zu haben, sprang ich hinzu und drehte mit aller Macht das Steuer. Das Schiff flog mit einer ungemein scharfen Wendung herum.
Jetzt war das nahe Ufer klar zu erkennen; noch ein paar Schiffslängen – wir wären unrettbar verloren gewesen! Eine Zentnerlast war von mir genommen. Jetzt, wo ich die Situation genau erkannt, war wenigstens die größte Gefahr beseitigt; wir liefen noch einige Knoten in der bisherigen Richtung, um möglichst viel freies Fahrwasser zu gewinnen. Erst nachdem das unheimliche Getöse der nahen Brandung verstummt war, konnten wir die Ursache unserer Kursverwirrung feststellen. Ein überaus starker Gegenstrom hatte uns unbemerkt zurückgeschnellt. Diese gefahrvolle Täuschung, welche oft dem besten Seemanne den Untergang bereitet, wurde freilich durch eine regnerische, dunkle Sturmesnacht wesentlich unterstützt, aber welch’ ungeheure Macht musste der Gegenstrom in sich bergen, wenn er das vor dem Winde liegende Schiff mit einer Schnelligkeit zurücktrieb, dass wir nicht einmal die Rückwärtsbewegung trotz aller Aufmerksamkeit bemerken konnten. Der erfahrenste Seefahrer ist gegen diese rätselhafte Erscheinung niemals geschützt, leider ist es den zahlreichen Forschungen bis jetzt nicht gelungen, weder die Ursache, noch die Anzeichen dieser Strömungen wissenschaftlich festzustellen. Wie in so vielen unberechenbaren Fällen bleibt auch hier eine scharfe Wacht des Kapitäns der beste Schutz für Schiff und Ladung. Statt, wie ich wähnte, mit fliegender Fahrt in die Sundastraße hineinzusegeln, wie es auch, wenn man über Bord in das Wasser blickte, der Fall zu sein schien, war ich durch den Gegenstrom ganz nach St. Nicolas Point und weiter in die Javasee hinein zurückgetrieben, so dass ich den ganzen nächstfolgenden Tag gebrauchte, um die widerwillig zurückgelegte Entfernung wieder einzuholen und den Ankerplatz vor Anjer zu erreichen. Es ist dieses schon an und für sich eine schwierige Aufgabe, da man dicht unter Land fahren muss, um überhaupt Ankergrund finden zu können. Hier in Anjer wurden vorzugsweise neue Wasservorräte eingenommen, aber auch die frischen Gemüse und Geflügel, welche geschäftseifrige Händler für eine geringe Summe an Bord brachten, nicht verschmäht. Dann ging es unaufhaltsam weiter auf der offenen, freien Meeresbahn. An einem regnerischen Tage hatte ich die Antipoden-Insel zu passieren.
Nach meiner Berechnung musste ich genannte Insel 8 Uhr abends erreichen. Wenige Minuten vor dieser Zeit gab ich dem Obersteuermann die Weisung, gut aufzupassen, da wir in allerkürzester Zeit die Antipodeninsel gerade vor uns in Sicht bekommen würden. Kaum war ich in die Kajüte zurückgekehrt, um den Schiffsort auf der Karte genau abzusetzen, als der elektrisierende Ruf des Obersteuermannes an mein Ohr schlug: „Antipodes right ahead, Sir!“
Ja, wahrhaftig – da lag die grau schimmernde Felswand, trotz des strömenden Regens deutlich erkennbar, vor mir. Ich ließ das Schiff zwei Strich anluven und flog nun, alle Segel gesetzt, gleich einer eilenden Wolke an dem dräuenden Felsen vorüber. Die Zuverlässigkeit meines Chronometers bereitete mir eine unaussprechliche Freude und Genugtuung. Seit vielen Tagen kein Land gesehen, nur auf Chronometer und Monddistanz-Berechnung angewiesen – und dennoch hatte ich mit dem Glockenschlage den winzigen Punkt erreicht. Vielleicht wird der geehrte Leser meine seemännische Freude begreiflicher finden, wenn ich ein schwaches Gleichnis hinzufüge. Auf weiter unabsehbarer Ebene liegt ein kleines Steinchen; nach tagelangem, andauernden Marsche soll der Wanderer dieses Steinchen zu einer bestimmten Minute treffen. –
Deutlich hörte man das Brausen der brandenden Wogen, man wähnte so nahe dem Felsen zu sein, als könne man ihn mit der Hand berühren. In wenigen Minuten war das imposante Schauspiel meinen Blicken entschwunden. Der kräftige deutsche Hurraruf, mit welchem meine Leute unseren sicheren Kurs begrüßten, klang mir noch lange wie die herrlichste Melodie in den Ohren...
Am Abend des achtundneunzigsten Tages unserer Fahrt ankerten wir im Hafen von Callao, unser Ziel war erreicht. Hatte ich auch bei Beginn der Reise mehrere Chinesen durch den Tod verloren, so durfte ich doch auf eine glücklich vollendete Aufgabe zurückblicken.
Früh am Morgen, nachdem ich vom Reeder aufs Freundlichste begrüßt, begann an Bord ein interessantes Treiben, das in seinen Grundzügen lebhaft an den Weibermarkt zu Richmond erinnerte. Die Chinesen zeigten sich heute in großer Toilette, sie hatten nach meiner Weisung ihren besonderen Anzug angelegt und präsentierten sich so vorteilhaft wie nur möglich ihren neuen Brotherren.
Nachdem die Kulis eine paradeähnliche Aufstellung genommen, erschienen die Herren aus Callao, meist Plantagenbesitzer, Kaufleute sowie Angehörige der verschiedensten Berufsarten vor der Front der zur Ansicht ausgestellten Chinesen. Der Markt begann; der musternde Blick des Käufers überflog einen Augenblick die lange Reihe, dann aber musste er auch schon seine Auswahl treffen und den vom Reeder festgestellten Preis anerkennen. Viel Zeit zu Handeln war nicht vorhanden, wer den Preis nicht zahlen wollte, musste der Konkurrenz den Vorzug lassen oder sich mit geringwertiger Qualität begnügen.
Am höchsten im Preise standen die großen, jungen, kräftigen Kulis, welche eine größere Arbeitskraft repräsentierten; für diese wurden 700 Dollars per Stück bezahlt...
Die Hauptstadt der südamerikanischen Republik Peru ist nur annähernd 9 Kilometer von Callao entfernt... Ich habe in Lima recht vergnügte Tage verlebt und glaube wohl versichern zu dürfen, dass sich auch meine Mannschaft dort nicht sehr gelangweilt hat. Das Kommando der PERSEVERANCIA wurde mir vom Reeder Don José Canevaro, der auch gleichzeitig das Amt des italienischen Konsuls bekleidete, für fernerhin übertragen. In dieser Eigenschaft musste ich mich nach den Landesgesetzen einer Prüfung unterwerfen, die mir allerdings keine Kopfschmerzen verursachte, derzufolge ich aber zum peruanischen Kapitän ernannt wurde, wie die folgende Abschrift meines Patents bestätigt:
| Republica Peruana.
Alfredo Tetens natural de Dinamarca Ante V. E. Digo que habiendo elegado a’ este Puerto con procedencia de la China al Mando de la Fragato nacional “Perseverancia” y y deseando cumplir conlo dispuesto en el decreto supremo de 5 de Agosto de 1840 ocurro a’ V. E. Afin de que se sirva ordenar se me examine de segundo Piloto de Altura para lo cual poseo los conveimientes necesarios pues hace largos anos que he exersido mi profecion en todó el Globo y para ello A.V.E. pido y suplico se sirva acceder á mi solicitud por ser dejusticia gracia etc.
|
In wohl weiser Erwägung der zwischen Spanien und Peru herrschenden Spannung, die später zum Kriege führte, übergab mir mein Reeder für den Notfall auch italienische Schiffspapiere und Flagge...
Von dem Augenblicke an, wo ich mich zur Guanobefrachtung entschlossen hatte, suchte ich meine geringfügigen Kenntnisse von diesem so überaus wichtigen Handelsartikel, der dem ausgesogenen europäischen Ackerboden belegende Nahrungssäfte zuführt und ohne dessen Verwendung ein großer Teil der alten Erde ertraglos zu werden droht, zu vervollkommnen...
Der Guano besteht zum großen Teile aus den seit Jahrtausenden angesammelten Exkrementen von Seevögeln, ist je nach Lage und Alter der Fundorte in seinen Bestandteilen und Werten verschieden und seit mehr als 700 Jahren als vorzügliches Danmittel bekannt... Der hier in Betracht kommende Guano der Chinchas-Inseln gehört zu dem besten und wertvollsten aller Guanos, weil er vorzugsweise aus Exkrementen von Seevögeln gebildet und daher den höchsten Gehalt an Stickstoff und Phosphorsäure enthält...
Nach dreimonatlichem Aufenthalt auf den Chinchas-Inseln war meine PERSEVERANCIA tief beladen. Wir konnten endlich von unseren Nachbarschiffen, die noch zu einem längerem Verweilen gezwungen waren, festlich Abschied nehmen. Zur Komplettierung der Ladung wie auch zum vorschriftsmäßigen Ausklarieren mussten wir zunächst auf Callao zurück und konnten erst von hier aus unsere Ausreise antreten...
Nachdem wir Callao mit günstigem Winde verlassen, erreichten wir alsbald den Südost-Passat und trafen, unseren Kurs um das Kap Hoorn nehmend, bereits nach 20 Tagen die Region der Westlichen Winde. Kap Hoorn ist bei allen Seeleuten wegen seiner durchgängig stürmischen Witterung sehr berüchtigt. Namentlich haben die von Europa ausgehenden Schiffe mit den beim Kap Hoorn vorherrschenden westlichen Stürmen schwere Kämpfe zu bestehen und sind öfters gezwungen, drei bis vier Wochen auf der Höhe des Kaps herumzukreuzen, ehe es ihnen gelingt, dasselbe zu umsegeln und die Westküste zu erreichen.
Auch ich hatte mit meiner PERSEVERANCIA, ein 2000-Tons-Schiff, beim Umsegeln des Kap Hoorn mitten im Winter einen sehr schweren Weststurm zu bestehen, so dass ich zur Sicherheit meines zu tief beladenen Schiffes gezwungen wurde, einen Teil meiner Guano-Ladung über Bord zu werfen. Von einer sehr guten Fracht von £ 4,10 per Ton verlockt, hatte ich so viel Guano geladen, als nur irgend möglich gewesen. Jetzt forderte jener Weststurm gebieterisch seinen Anteil. Das Barometer fing an rasch zu fallen, die Luft wurde dick und bot einen schaurig schönen Anblick. Um den nahenden Sturm auswettern zu können, wurden die kleinen Segel rasch geborgen und alles sicher auf Deck befestigt. Allmählich wuchs der Wind zu einem schweren Sturme heran, die chaotisch aufgewühlte See wurde immer höher, und alsbald lenzte die PERSEVERANCIA mit dicht gerefftem Marssegel und gerefftem Fock vor günstigem Sturme dahin. Heftige Regenböen wechselten mit Schnee und Hagelschauern ab; immer heftiger wurde der Wind, die Sonne versank in Wolken, die Luft verfinsterte sich gegen Abend bis zur tiefen, nur selten gelichteten Dunkelheit.
In schreckenerregender Weise türmte sich nunmehr die See hinter dem Schiffe auf, es schien als sei es von hochragenden Wasserbergen, die es im nächsten Moment erdrücken würden, eingeschlossen. Brüllend verfolgte die wild schäumende See das wie ängstlich davoneilende Schiff; immer gieriger drangen die gepeitschten Wogen gegen die Schiffswände, als müssten sie im nächsten Moment das fliehende Opfer verschlingen. Im ununterbrochenen Wechsel wurde das Schiff auf den Gipfel einer langen See emporgehoben und dann pfeilgeschwind ins dräuende gischtsprühende Tal hinabgestürzt.
Ergriffen von der Macht dieses grausigen Bildes wagte man kaum rückwärts zu schauen. Mit furchtbarem Donnergebrüll liefen die Seen auf beiden Seiten des Schiffes wetteifernd einher, rollende Wogen ergossen sich, die schwache menschliche Gegenwehr verhöhnend, zischend und brausend über die Schanzkleidung aufs Verdeck. Immer unheimlicher heulte der Wind sein schauriges Lied durch die Masten; stundenlang kämpfte das Schiff gegen die schäumende See. Was ich bei dem schweren Rollen des tief beladenen Schiffes gefürchtet, war eingetreten – ein Leck! Wie ein tödlich verwundetes Wild schleppte sich das Schiff auf dem unheildrohenden Pfade stöhnend vorwärts. Die Mannschaft stand oft bis an den Hals im Wasser, festgebunden bei den Pumpen. Drei Tage und drei Nächte dauerte mit ungeschwächter Kraft diese Gewalt des Sturmes, und während dieser eine Ewigkeit scheinenden Zeit verharrte jeder pflichtgetreu auf seinem Posten. Zwei Mann standen unausgesetzt am Steuerrad, der geringste Fehler beim Steuern musste verhängnisvoll werden. Sobald das Schiff den Brechseen die Breitseite zukehrte, war sein Untergang gewiss. Das Steuern erforderte die größte Kaltblütigkeit und Aufmerksamkeit – es kam alles darauf an, das Schiff recht vor der See zu halten. Unter dem gewaltigen Druck des Sturmes raste das bedrohte Fahrzeug zitternd und ächzend in die undurchsichtigen Dunstmassen hinein. In der dritten stockfinsteren Nacht, als die Wut des Windes unter unausgesetztem Blitzen und Donnern eine schreckenerregende Höhe erreicht, das Brüllen der sprühenden Wogen wahrhaft betäubend wirkte, die weißschäumenden Köpfe der Brechseen magisch beleuchtet auf und nieder tauchten, St. Elmsfeuer auf den Mastspitzen gespensterhaft tanzten, stand ich noch immer auf meinem seit 60 Stunden innegehabten Platze und blickte tief bewegt in das grausige und doch wieder so unendlich erhabene Schauspiel der entfesselten Elemente. Was in solchen unvergesslichen Augenblicken, welche die menschliche Ohnmacht und Winzigkeit klar zeigen, die Seele des Seemannes erfüllt? Vor allem ehrfurchtsvolle Bewunderung vor der unbeschreiblichen Majestät des Meeres. –
Die Masten und Rahen waren kaum im Stande, den Druck der Segel zu tragen, aber ich durfte letztere nicht kleiner reffen lassen, weil sonst die Fahrt des Schiffes gemindert, die hohen Seen sich von hinten über das Fahrzeug gestürzt und dieses dann in die brausenden Fluten niedergedrückt hätten. Beidrehen konnte ich ebenso wenig, dazu war es zu spät. Das Schiff musste also unter einem verhältnismäßig großen Press von Segeln vor dem Sturm und vor der See dahineilen – dies war die einzige Möglichkeit, um es vom Untergange zu retten. Um nun dem Brechen von Masten und Rahen vorzubeugen, welch’ letztere bereits von dem gewaltigen Druck des Windes wie Flitzbogen gekrümmt waren, hatte ich besonders starke Extra-Brassen, Perdunen und Springtaue verwenden lassen. Meine Leute haben während dieses fürchterlichen Sturmes, der die ganze Kraft des einzelnen Mannes erschöpfte, eine beispiellose Ausdauer bewiesen; zu all den Leiden gesellte sich auch noch ein weiteres. In Folge des Lecks war Seewasser in den Behälter gedrungen, welches das Trinkwasser ungenießbar machte. Den Schrecken des Sturmes folgten die grausigen Qualen des tagelangen Durstes. Schnee und Hagel wurden emsig zusammengefegt, um daraus einige genießbare Tropfen zu gewinnen. Kein Wort kam über die Lippen der schwer geprüften, vor Kälte zitternden, durstgequälten Männer, aber mit der Kraft der Verzweiflung erfüllten sie meine Befehle. – Endlich nach Ablauf des dritten Tages hatten wir Kap Hoorn passiert, der Sturm nahm ab, und nachdem wir den Kurs des Schiffes etwas nördlicher gerichtet, erreichten wir alsbald ruhiges Fahrwasser und besseres Wetter im Schutze des Festlandes und der Falkland-Inseln. Leichter Schein im Osten verkündete den Beginn eines neuen Tages, nach wenigen Augenblicken trat die majestätische Sonnenscheibe hervor mit ihrem leuchtenden Gewande, deren goldschimmernde Strahlen in die beruhigten Fluten nieder tauchten.
Ein tiefer, erlösender Seufzer entquoll der Brust, das Herz schlug freudig, im andächtigen Sinnen erhob sich der dankbare Blick zum hellstrahlenden Himmelsdome, der liebe Gott hatte uns wieder einmal aus großer Gefahr errettet. Als dann bei anhaltend nördlicher Fahrt starke Regenschauer das sehnsüchtig erwartete Trinkwasser in ausreichendem Maße lieferten, der quälende Durst verscheucht wurde, war auch alles überstandene Leid mit einem Schlage nach alter Seemannsweise vergessen...
...Die PERSEVERANCIA glitt in raschem Fluge ihrem Endziel entgegen. In wenigen Tagen musste ein herzerfreuender Ruf aus dem Mastkorb erschallen. Noch hatte der spähende Blick keinen anderen Ruhepunkt als die Segel der sich in dieser stark frequentierten Fahrstraße kreuzenden Schiffe gefunden und dennoch zog nur der eine Gedanke durch die ergriffene Seele: Land! Land! Wer nach langer, gefahrvoller Fahrt die Macht dieser geheimnisvollen Empfindung kennen gelernt, der wird auch die namenlose Freude, den herzigen Jubel begreiflich finden, mit welchem meine Ortsbestimmung an Bord begrüßt wurde. Von diesem Augenblicke an verstummte plötzlich jede Unterhaltung, als fürchte man das nahe Land wieder zu verscheuchen. Alle Blicke spähten nach dem Leuchtfeuer von Lizard. Da... da flimmerte es vor den erwartungsvollen Blicken. In der vorschriftsmäßigen Meldung: „Lizard Feuer gerade voraus!“ mischte sich das erlösende Hurrah der Matrosen. Lange vor Tagesgrauen schlichen die Leute wieder aufs Deck; wer könnte auch in diesem Augenblicke an Ruhe oder gar Schlaf denken? Kaum hatten sich die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne auf die smaragdgrünen Fluten niedergesenkt, da hatte der ermüdete Blick den sehnsuchtsvoll erwarteten Ruhepunkt gefunden. Lizard, das Vorzimmer Europas, wurde mit lautem Jubel passiert. –
Immerfort mehrten sich die Anzeichen des Landes! Ist nicht die herzinnige Freude des Seemannes, sein grenzenloser Jubel, begreiflich, wenn sein monatelang von unermesslichen Wasserbergen eingeschlossener Blick auf solch’ entzückendem Bilde ruht? Freudentrunken halten sich die Seeleute umschlungen und tanzen nach Herzenslust; können sie ihren Frohsinn deutlicher zum Ausdruck bringen? Ich glaube kaum.
Von Minute zu Minute wechseln die mannigfachen Eindrücke. Jetzt tauchen die ersten Lebenszeichen des nahen Europas auf; es sind die Lotsenfahrzeuge, deren waghalsige Besitzer sich zum Führer des einkommenden Schiffes anbieten. Noch ist das Lotsenboot zu weit entfernt, um die im Segel geführte Nummer deutlich erkennen zu können, aber gerade dieser Umstand gibt dem Seemanne Gelegenheit, sich schon frühzeitig der festländischen Gewohnheit, der Wettgier zu erinnern. Wetten werden ausgeschrieen und angenommen...
...Von den inzwischen auf Signalweite herangekommenen, meist englischen, französischen, belgischen oder holländischen Lotsen wird natürlich derjenige gewählt, dessen Boot die Flagge des Landes trägt, in dessen Hafen man zu ankern denkt. Unser holländischer Lotse kam heran. Die hervorragende Gewandtheit des Mannes, mit welcher er das winzige Fahrzeug gegen die ihren Kurs fortsetzende PERSEVERANCIA lenkte, erregte die Freude meiner Leute. Die „Nussschale“, von den tänzelnden Wellen auf und nieder gehoben, verfolgte unablässig ihr Ziel. Dieses geschickte Manöver hat die Bewunderung der wetterfesten Zuschauer erregt. Mit solchem kleinen Boote über hundert englische Seemeilen in die gefahrvolle Fahrstraße des Kanals sich hinauszuwagen, das war keine Kühnheit mehr, das war Leichtsinn zu nennen. Aber was half es, Die zahlreichen Mitbewerber dringen ja immer weiter vor, um den winkenden Lohn zu erhaschen; bleibt der Einzelne zurück, so hat er ja jede Aussicht auf Erfolg verloren, und daheim warten Frau und Kinder auf Brot. Darf er nur einen Augenblick zögern, sein Leben einzusetzen? Kaum die Schwelle Europas betretend, fühlten wir den Kampf ums Dasein seiner Bewohner. Trotz seines reichen Sprachschatzes kam unser mutiger Holländer , dem wir die peruanische Flagge zeigten, ein wenig in Verlegenheit, als wir in Hörweite seine englischen, französischen, holländischen und flämischen Fragen kopfschüttelnd verneinten. „Na, was sprecht ihr denn eigentlich?“ entgegnete der Lotse, den Scherz erkennend, in seiner Muttersprache. „Ihr seht ja doch Menschenkindern ähnlich und eure Ladung scheint auch nicht vom Himmel zu kommen.“ „Also dütsch,“ begann jetzt der Lotse, mit Hilfe meiner Leute rasch das Deck erreichend, „jawoll Kaptän, jawoll, kann ick ok.“ Schallendes Gelächter folgte dieser zarten Anspielung.
Nach der ersten Begrüßung und den erforderlichen Mitteilungen wurde unser Holländer recht gemütlich. Ich muss die wahre Veranlassung verraten... der gute Mann hatte den Tiefgang unseres Schiffes, nach welchem seine Lotsengebühr berechnet wurde, erfahren, und dieser Tiefgang verhieß ihm einen außergewöhnlich großen Gewinn.
Sobald der Lotse das Kommando des Schiffes übernommen, verstummte jede Unterhaltung, seine ganze Aufmerksamkeit gehörte jetzt dem Schiffe; Tag und Nacht bis zum Niederlassen des Ankers blieb er auf seinem Posten.
Ohne die geringste Störung wurde die PERSEVERANCIA in den Hafen von Rotterdam geleitet, die Anker rasselten unter dem Hurrahruf meiner entzückten Leute nieder. Ein Strom seliger Empfindung durchflutete mein Herz, Land! Land! Nachdem die Ladung gelöscht, all meine Obliegenheiten erfüllt, das altersschwache Schiff verkauft war, eilte ich freudebewegt in die Heimat – in das Elternhaus!
* * *
Nach jahrelangen, gefahrvollen Reisen kehrte ich in die liebe Heimat zurück. Unbeschreiblicher Jubel schwellte meine Brust, in den nächsten Minuten musste ich das heißersehnte Ziel erreichen. Aber welch schmerzliche Kunde traf mich an der Schwelle des Elternhauses. Mein Vater ruhte in kühler Erde; - es war mir nicht vergönnt, ihn noch einmal in meine Arme zu schließen...
Die Stätte meiner Kindheit gewährte mir nicht mehr die früher empfundene Freude; es trieb mich nach einem mehrwöchigen Aufenthalt wieder hinaus. War ich doch dem Eldorado der deutschen Seeleute, dem schönen Hamburg, nahe, konnte mich an dem wunderbaren Anblick des schönsten und größten Hafens des europäischen Festlandes erfreuen.
Wie oft ist diese echt deutsche Perle von berufener Feder beschrieben, wie oft hat des Künstlers Stift dieses Kleinod in Farben dargestellt; die Fotografie und all ihre verwandten technischen Vervielfältigungsarten der Neuzeit, sie alle haben es versucht, ein naturgetreues Abbild des Hafens zu liefern. Allein, was hat die gewandteste Feder, die geschickteste Hand, die fotografische Wiederspiegelung erreicht? Kann die beste Verschmelzung von Wort und Bild dem Fernstehenden einen ausreichenden Begriff von der Schönheit dieses Panoramas bieten? Kann er den entzückenden Eindruck, welchen der Hamburger Hafen auf jeden Beschauer hervorruft, voll und ganz nachempfinden?
Ich darf getrost mit Nein antworten. Und dennoch darf sich kein Künstler verletzt fühlen. Es liegt außer dem Bereiche menschlichen Könnens, dieses prachtvolle, jeden Moment sich verändernde Bild festzubannen. Was eine gütige Natur hier geschaffen, hat kunsterfüllter Schönheitssinn glücklich ergänzt. Nicht nur das Auge des Beschauers weidet sich an dieser Herrlichkeit; auch Herz und Gemüt wird von der eigenartigen Pracht ergriffen. Sein geistiger Blick dringt über den stolzen Mastenwald hinaus und wähnt die fernen Meere und Länder zu erfassen. Jene zahllosen Fahrzeuge von der schlanken Bark bis zum imposanten Vollschiff, deren Kiele die Weltmeere durchfurchen, an deren Masten die Flaggen aller Schifffahrt treibenden Völker flattern, das rastlose geschäftige Treiben der Vertreter zahlreicher Völker, das ist es, was dem zauberhaften Bilde seinen bestrickenden Reiz verleiht und dem Beschauer einen Weltblick gewährt...
Hoch von den Masten flattert das bekannte Banner der mächtigen Hansestadt. Seit vielen Jahrhunderten haben Hamburgs Schiffe die Weltmeere durchkreuzt. Seine Flagge wird von den Völkern der Erde geachtet und geschätzt. Nicht ohne andauernden, harten Kampf hat sich Hamburg seine ehrenvolle Stellung unter den Schifffahrt treibenden Völkern erworben. Unzählige Schicksalsschläge haben die Frucht jahrelanger Mühen zerstört, welterschütternde Ereignisse haben seine Existenz bedroht. Mancher Zweig wurde entblättert, mancher Ast verdorrt, aber der Stamm des Baumes wurzelte in einem gesunden Boden und zeigte immer wieder seine segensreiche Frucht...
Diese nach Jahrhunderte langen Kämpfen gewonnene Erkenntnis ist die Grundlage, auf welcher der wahre Kaufmann seine Aufgabe zu erfüllen sucht, und wodurch er zur mächtigen Stütze des Staates geworden ist. Wer zählt die Namen der mächtigen Hamburger Handelsfürsten, die über eine stolze Kauffahrteiflotte gebieten, all die Männer, welche als Säulen des deutschen Welthandels gelten, im Interesse des großen Ganzen wirken?
Sie sind es, die den Geist im Volke weckten, dem Hamburg seine Größe und Blüte verdankt. Nur einen Namen, welcher mit dem nächsten Teil meiner Erzählung eng verknüpft ist, muss ich hier nennen. Der Name Godeffroy füllt ein ehrenvolles Blatt der vaterländischen Geschichte. Das einst so mächtige Handelshaus befolgte eine epochemachende Praxis und gab dem Hamburger Handel einen neuen, kräftigen Impuls. Seine weitblickenden Führer begnügten sich nicht damit, einen zeitweiligen, lebhaften Warenaustausch mit den fernen Völkern zu unterhalten, höhere Ziele verfolgten die genialen Männer. Ein kurzer Hinweis wird meine Ansicht bestätigen.
Mit einem lebhaften Import- und Exportgeschäft beginnend, wodurch die Mehrzahl der Schiffe lohnende Beschäftigung fanden, erstreckte sich ihr Handel zunächst auf die Westküste von Südamerika, wo Gustav und Alfred Godeffroy als Superkargos tätig waren. Der Reihe nach wurde mit Ostindien, Australien, Südafrika ein lebhafter Verkehr eröffnet und später die Südseeinseln und Sibirien, speziell der Amur in den Bereich ihrer Tätigkeit bezogen. 1863 stand die Reederei des Hauses in ihrer vollen Blüte, sie umfasste in diesem Jahre 30 Segel-, 6 Dampfschiffe, nebst 3 Flussdampfern. Lebhaften Anteil nahm die Firma an der Beförderung von Kolonisten nach Südafrika, nach den vier australischen Provinzen und der Westküste Südamerikas.
Godeffroys Geschäftsagenten waren die ersten Weißen, welche den Boden so mancher fernen Insel betraten, ihre Bewohner wurden durch Godeffroys in die Welt gerückt und empfingen eine segenbringende Kultur. Ganze Völker unterstellten sich freiwillig dem Hamburger Handelshause, immer mehr wurden die Beziehungen gepflegt, wertvolle Gebiete, den Neid fremder Staaten erregend, wurden hamburgisches und somit deutsches Eigentum. Bald genug wurde die wohldurchdachte Absicht der geistvollen Kaufleute erkennbar. Es galt, der vaterländischen Industrie größere Absatzgebiete dauernd zu erhalten, fernere zu erschließen und den Handel Deutschlands mehr und mehr zu befestigen...
Angesichts des imposanten Hamburger Hafens, der mich zu dieser Betrachtung veranlasst, erwachte wieder meine Sehnsucht zur See. Ein glücklicher Zufall begünstigte dieses begreifliche Verlangen. Eine Hamburger Zeitungsnotiz, die von meinen Reisen und meiner Rückkehr in die Heimat erzählte und mich als Vizekönig der Karolinen-Inseln bezeichnete, gab dem derzeitigen Chef des Hauses J. C. Godeffroy & Sohn Veranlassung, meinen Besuch zu erbitten. Bereitwilligst kam ich diesem Wunsche nach. Was ich von den mir bekannten Inselgruppen berichtete, erregte die Teilnahme des Handelsfürsten im hohen Grade. Sein scharfer Blick eilte meinen Erzählungen voraus, es war nicht nötig, die Zweckmäßigkeit der beabsichtigten Expedition besonders hervorzuheben; der geniale Kaufmann hatte den Schwerpunkt im Fluge erfasst. Bald war der Entschluss gereift. Das erste einlaufende Schiff des Hauses sollte für das geplante Handelsunternehmen zu meiner Verfügung stehen; wie sehnlichst ich diesen Augenblick erwartete, will ich hier nicht hervorheben.
Ich wähnte mich am Ziele meiner Wünsche. War ich doch der Führer eines deutschen Schiffes geworden, von einem hervorragenden Hamburger Reeder mit der Aufgabe beehrt, die mir eine besondere Tätigkeit in Aussicht stellte. Jetzt war mir endlich Gelegenheit gegeben, meine Erfahrungen im Dienste des deutschen Handels zu verwerten...
Endlich lief ein Godeffroy’sches Schiff, und zwar die Brigg VESTA, in den Hamburger Hafen ein. Sobald die Entladung des Schiffes geschehen, wurde mit einer zweckdienlichen Ausrüstung begonnen. Bald zeigte sich die VESTA in ihrem Waffenschmuck von zwölf Geschützen, darunter sechs Drehbassen (drehbare Geschütze mit kleinem Kaliber), während die inneren Räume die von mir als geeignet bezeichneten Tauschwaren aufnahmen. Zu diesen Gegenständen gehörten insbesondere grellfarbene Manufakturwaren, Eisenteile, Waffen, Pulver und Blei, Feuerstein, Feuerstahl, Streichhölzer, böhmische Glasperlen, eiserne Kochtöpfe, Fischangeln usw. Die Reederei beschaffte einen vorzüglichen, für die klimatischen Verhältnisse genau berechneten Schiffsproviant. Wohl selten ist ein Kauffahrer so glänzend ausgerüstet worden. Die Reiherstieg-Schiffswerft erhielt den Auftrag, sofort ein kleines, eisernes Dampfboot nach meiner Angabe zu erbauen. Alles, was nur irgendwie zweckdienlich erschien, traf mit militärischer Pünktlichkeit an Bord ein. Allein schon die Ausrüstung lieferte den Beweis, von welch hohen Gesichtspunkten aus die Expedition von dem Handelshause betrachtet wurde. Dank der musterhaften Schlagfertigkeit des Godeffroy’schen Apparats war die VESTA in unglaublich kurzer Zeit reisefertig. Im Museum Godeffroy wurde mir Gelegenheit geboten, sowohl das Ausstopfen der Vögel wie auch das Präparieren und Konservieren von Pflanzen, Schlangen, Eidechsen und sonstigen Tieren zu erlernen, um die auf den Südseeinseln zu sammelnden Gegenstände in geeigneter Weise dem Museum Godeffroy zuführen zu können. Es galt nur noch einige nebensächliche Dinge, meist privater Natur, zu erledigen. Hierzu gehörte in erster Reihe die Erfüllung der Hamburger gesetzlichen Bestimmungen, wonach der Führer eines Hamburger Schiffes nicht nur das Kapitäns-Examen abzulegen hatte, sondern auch das Hamburger Bürgerrecht erlangen musste. Nachdem ich meiner nunmehrigen zweiten Heimat, dem lieben Hamburg, den Eid der Treue als Bürger geleistet, konnte ich schon am nächsten Tage vor der Prüfungskommission erscheinen. Ich kann nicht auf die Einreihung des Hamburger Zeugnisses an dieser Stelle verzichten. Schon an und für sich ist das von dem ersten deutschen Handelsstaate ausgefertigte Attest für jeden Seefahrer ein wertvolles Dokument; außerdem trägt es die Unterschrift hervorragender, verdienstvoller Männer, denen ich unvergesslichen Dank schulde. Das Schriftstück lautet:
| Wir Endestunterzeichneten von der hiesigen hochlöblichen Schifffahrt- und Hafen-Deputation im Auftrage des hochedlen Senates zur Prüfung der Fähigkeiten derjenigen, welche auf hamburgischen Schiffen als Steuerleute dienen wollen, angestellte Examinatoren, bescheinigen hierdurch, dass der Vorzeiger dieses, Alfred Friedrich Tetens, gebürtig aus Wilster, 30 Jahre alt, welcher 14 Jahre zur See gefahren hat, von uns examiniert worden ist, und zwar über die demnächst folgenden Gegenstände, sowie dass wir in Folge der nach vollendetem Examen angestellten Beratung darüber einig geworden sind, dass er bestanden habe:
1. im Manövrieren des Schiffes, sowie in der Kenntnis der Pflichten des Steuermannes: gut.
2. in der Kenntnis der Elbe und der Mündung derselben, sowie im Verhalten beim vor Anker Liegen: gut.
3. in der Arithmetik, Geometrie und Trigonometrie nebst den dazu gehörigen Beweisen: gut.
4. in den geographischen und astronomischen Vorkenntnissen: gut.
5. in der Anwendung der ebenen Trigonometrie auf die Planschifffahrt, im Gebrauch des Kompasses und Log: gut.
6. in der Theorie der mercatorischen Projektion und dem Segeln und dem Messen auf runden Karten: gut.
7. in der Kenntnis der nautisch-astronomischen Werkzeuge und deren Korrektion: gut.
8. in der Anwendung der sphärischen Trigonometrie und Astronomie auf nautische Probleme mit den dazu erforderlichen Erklärungen: gut.
9. in der Bestimmung der Breite, der Länge und die Variation auf See, nebst der Kenntnis des Gebrauchs der Chronometer: gut.
10. in der nautischen Geographie: gut,
weshalb wir ihn für den Dienst als Steuermann und Seeschiffer erster Klasse gehörig und hinreichend erfahren befunden haben.
Zur Beurkundung dessen haben wir dem gedachten A. F. Tetens das gegenwärtige Attest ausgestellt, mit dem Wunsche, dass es demselben zur Empfehlung und zum guten Fortkommen in seinem Berufe als Seemann gereichen möge.
So geschehen zu Hamburg, den 8. Juni 1865.
Pro confirmatione C. W. Schuback
H. A. Hübner Inspector als Examinatoren
ex Commissario J. Fokkes
der Hamburgischen Schifffahrs- G. H. A. Heuer
und Hafen-Deputation Marine-Inspector
Theod. Niebour Director.
Lehrer der Navigations-Schule und Examinator.
|
Nunmehr wurde auch eine ausreichende Besatzung der Brigg, 2 Steuerleute und 14 Matrosen geheuert. Es waren ausgesuchte, stämmige Leute, meist Hamburger und Holsteiner, die sich schon oft auf dem Meere getummelt, denen schon mancher Wind um die Nase geweht und von denen ich eine volle seemännische Pflichterfüllung erwarten durfte. Mit dem Augenblicke, wo die Mannschaft an Bord eintraf, war alles zum Auslaufen klipp und klar. Nur die Probefahrt mit dem kleinen Schraubendampfer, um auch gleichzeitig mit dem Mechanismus vertraut zu werden, musste noch geschehen. Am letzten Sonntage meines derzeitigen Aufenthalts dampfte das schmucke Fahrzeug stromabwärts aus dem Hafen. Es war ein wunderschöner Tag; das herrliche Elbufer prangte in dem farbenschimmernden Schmucke des Sommers. Die Sonne glänze so hell und freundlich am wolkenlosen Horizont, als wollte sie dem jüngsten Hamburger Bürger und Kapitän die ganze Pracht seiner neuen Heimat zeigen. Sorgsam gepflegte Parkanlagen, mit Blumen und Pflanzen aller Zonen kunstgerecht geschmückt, verleihen dem rechten Ufer einen bestrickenden Reiz. Auf dieser duftenden, blütenreichen Hügelkette erheben sich die Schmuckkästen ähnlichen Villen der Hamburger Granden, ihren Besitzern einen prachtvollen Fernblick auf den imposanten, mit zahllosen Fahrzeugen übersäten Heimatstrom gewährend. Beim unausgesetzten Betrachten dieses Panoramas erhielten die verblassten Tropen-Bilder wieder lebhafte Farben. Hätte ich nicht die kernigen Zurufe der passierenden Schiffer vernommen, rückwärts die Türme der nordischen Hansastadt gesehen, ich hätte geglaubt, die Herrlichkeit Indiens, die Reede von Bombay, zu erblicken. Bald hatte unser kleiner Dampfer einen Punkt erreicht, von welchem aus die Villa Godeffroy klar und deutlich sichtbar wurde. Vermittelst der Dampfpfeife und dem Emporziehen einer kleinen Flagge gaben wir unsere Anwesenheit kund; nach wenigen Augenblicken erschien der Chef des Hauses auf der Balustrade seines Gartenschlosses und schwenkte zum Zeichen des Dankes sein Taschentuch in der Luft. Auf dem Rückwege tat die kleine Maschine trotz eines starken Stromes ihre volle Schuldigkeit, es machte mir und meinem Bruder, gegenwärtigem preußischen Regierungsrat in Schleswig, welcher als einziger Passagier an dem Ausfluge teilnahm, viel Vergnügen, den größeren Schiffen vorauszueilen. Soweit war die Fahrt ohne jede Störung verlaufen, allein beim Einlaufen in den Hamburger Hafen und Anlegen an der Reiherstieg-Schiffswerft sollte ich die Erfahrung machen, dass ich mit dem Mechanismus der Maschine noch nicht ausreichend vertraut sei. Um die Landungsbrücke zu erreichen, musste ich das vorschriftsmäßige Signal mit der Dampfpfeife geben und gleichzeitig den Gang der Maschine etwas hemmen. Hierbei musste irgend ein ungeschickter Handgriff an einem Ventile stattgefunden haben; plötzlich ertönte ein entsetzliches, ohrenzerreißendes Heulen, dem ich trotz aller Bemühungen keinen Einhalt gebieten konnte. Wir hielten unsere Situation für sehr kritisch, jeden Augenblick konnte nach meinem Dafürhalten eine Explosion eintreten. Eine ähnliche Empfindung schien auch meinen Bruder zu beherrschen, der mit einem kühnen Satze von Bord des Dampfers sich auf die Landungsbrücke schwang. Nun wurde es mir erst recht unheimlich. Hier im schönen Hamburger Hafen, angesichts meiner stolzen VESTA einen unvorbereiteten Luftsprung auszuführen, schien mir durchaus nicht verlockend. Schnell entschlossen riss ich das Feuer unterm Kessel fort und folgte dann dem Beispiele meines vorsichtigen Bruders. Im sicheren Port erwarteten wir die entsetzliche Katastrophe, aber Minute auf Minute verrann, kein Knall ließ sich hören. Ja! Das am wenigsten Erwartete trat ein, das Geheul der Maschine wurde schwächer, bis es schließlich zu unserer Freude ganz verstummte. Mein kleiner Dampfer kam nunmehr in sichere Verwahrung. Das kleine Intermezzo herzlich belachend, kehrte ich an Bord meines Schiffes zurück...
Nur noch wenige Stunden, dann war der Augenblick gekommen, in welchem das schöne Fahrzeug im Dienste des Handels auf die weite Meeresbahn hinausziehen konnte.
Die Königin des Tages zerteilte das leicht verschleierte Gewölk, ihre goldschimmernden Strahlen tauchten nieder in die klaren Fluten des schönen Elbstroms, frische Morgenluft begrüßte den aufsteigenden Tag. Nur noch einige köstliche Augenblicke, dann wurde die weihevolle Ruhe, in welche das entzückende Panorama bislang gehüllt war, von der beginnenden Arbeit zahlreicher Menschen verscheucht.
Nie habe ich den Beginn eines Tages freudiger begrüßt! Stürmisch klopfte es in meiner Brust, ein Strom unbeschreiblicher Empfindung durchflutete mein Herz. Vorwärts! – Hinaus! Jubelte es mit tausend Stimmen. Stand ich doch am Ziele meiner Wünsche, auf den Planken eines mir anvertrauten schönen Schiffes!
Mit fieberhafter Eile wurden die letzten Vorbereitungen zum Auslaufen getroffen; die letzte Trosse gelöst, ein Hurrahruf scholl als letzter Gruß zum Ufer hinüber. Im vollen Segelschmuck glitt die VESTA aus dem sicheren Hafen zum Meere.
Mit Allgewalt packte es die Seele, Tränen zitterten in den Augen der wetterfesten Männer; - es ist der Abschied von der Heimat, der diese sentimentale Empfindung wachruft! Aber schon in der nächsten Minute kehrt die Fröhlichkeit zurück. Kopfhängerei ist nicht Sache des Seemannes; sobald sich das Fahrwasser seines Schiffes erweitert, ein frischer Wind die Segel schwellt, wird sein Auge klar, sein Herz leicht. Fast war der Ausgang des Hafens erreicht.
Aber die Mannschaft der VESTA konnte sich dieses Mal mit den üblichen Abschiedsgrüßen nicht begnügen, sie sehnte sich darnach, auf eine außergewöhnliche Art ihre Empfindung auszudrücken. Mir ging es ebenso. Aber kann die Besatzung eines Kauffahrers etwas anderes beginnen, als sich die Kehlen heiser zu schreien, die Mützen zu schwenken und Flaggen zu hissen? Indess, die VESTA war kein gewöhnlicher Kauffahrer, sie führte 12 Geschütze mit sich.
Mein Entschluss war gefasst. Unsere Kanonen sollten unseren ehernen Abschiedsgruß hinübertragen zur nahen Vaterstadt, all die freundlichen Zurufe der am Ufer harrenden Verwandten und Freunde in der verbindlichsten Form erwidern. Aber die gesetzliche Bestimmung verbot solchen Salut. Dort in dem kleinen Häuschen wachte ein unerbittlicher Diener des Gesetzes, der sogleich das gehörte Unerhörte zur Anzeige bringen würde. Mochte er es tun, die VESTA war nicht mehr erreichbar, und wenn sie nach Jahren zurückkehrte – ach was, soweit rechnet kein freudig erregter Seemann; ich gab das Kommando. Wie die erfahrensten Kanoniere vollführten die Matrosen meinen Befehl, im nächsten Augenblick waren drei Geschütze geladen. Kaum war die VESTA auf der Höhe des Fährhauses eingetroffen, da gab ich das Zeichen zum Feuern.
Ein kräftiger, vom Jubelruf der Mannschaft und Zuschauer begrüßter Donnerhall erschütterte die Luft, die Fenster des nahen Fährhauses zitterten bedenklich, der erzürnte Diener des Gesetzes drohte und streckte seine Faust aus, als müsse er die Bösewichter sofort zur Rechenschaft ziehen. Die augenscheinliche Hilflosigkeit des wütenden Beamten reizte nur unseren Mutwillen, je mehr er wetterte und fluchte, desto kräftiger erschall unser Hurrah.
Hätte es in der Macht des gekränkten Wächters gelegen, ich glaube, er würde unsere davoneilende VESTA in den Grund gebohrt haben. So war er zur Wahrung seiner amtlichen Würde auf seine privaten Hilfsmittel angewiesen, von denen er allerdings einen ziemlich weitgehenden Gebrauch machte, er verließ eiligst sein sicheres Heim und erhob am Strande seine laut vernehmbare Stimme: „Verdori! Nich noch mol – wüllt Ji wol dat Scheten loten!“
Ein kräftiger Hurrahruf der Mannschaft folgte dieser Aufforderung. Von der nun beginnenden peremptorischen Erklärung des erbitterten Beamten habe ich leider nur den Schlusssatz verstanden: „Ji Streumers, ji Stratenjungs, komt Ji mi man wedder in’n Haaben, denn lot ick Ji all verschüdden.“
Gewiss gehörte unser donnernder Abschiedsgruß zu den seltenen Gepflogenheiten auslaufender Schiffe, sonst hätte es der pflichtgetreue Wärter nicht zu der imponierenden Körperfülle, über die er verfügte, bringen können. Hoffentlich hat er unseren harmlosen Scherz, der uns den Abschied von Hamburg wesentlich erleichterte, bald wieder verziehen.
Nach mehrtägiger Fahrt blähte ein frischer Wind die Segel, kräftige Wellen hoben das Schiff im regelmäßigen Tempo empor, deutlicher drängten die rauschenden Meereswogen herüber, bald hatte die VESTA das Gebiet der Nordsee erreicht. Vier Tage lang hatten wir mit schlechtem Wetter zu kämpfen; zwar blieben wir von einem regelrechten Sturme verschont, aber es wehte uns schon eine anständige Mütze voll Wind um die Ohren.
Nachdem wir endlich das Galloper Feuerschiff passiert, mussten wir den ganzen Kanal durchkreuzen und bis auf die Höhe von Oporto gegen widrige Winde manövrieren. Erst volle vier Wochen später erhielten wir den Nord-Ost-Passat auf 35° Nördlicher Breite, der leider nur sehr schwach war und schon auf 14° Nördlicher Breite aufhörte, so dass die VESTA erst am siebenundfünfzigsten Tage nach ihrem Auslaufen die Linie passierte.
Den Süd-Ost-Passat erhielt ich auf 3° Nördlicher Breite und schnitt den Äquator in 28° W. Länge. Eine so lange Reise bis zur Linie ist mir während meiner ganzen seemännischen Tätigkeit niemals vorgekommen; es war durchaus kein Trost für mich, dass es meinen Nachbarschiffen, mit denen ich mich zeitweilig unterhielt, ebenso schlecht erging. „Martin Bass-Rocks“ wurde drei Meilen Distanz passiert. Nachdem wir den SO-Passat auf 30° S. Breite und 27° W. Länge verloren, segelten wir mit starken Westwinden im größten Kreise längs des 46. – 48. Breitengrades und bekamen nach einer Reise von 120 Tagen das Nordwest-Kap von Australien in Sicht.
Auf leicht gekräuselten Wogen eilte die VESTA, das blaue Weltmeer durchfurchend, ihrem noch Tausende von Meilen entfernt liegenden Bestimmungsorte entgegen. Majestätisch ragten die schlanken Masten, eine Wucht von Segeln tragend, gen Himmel empor. Bis in die obersten Spitzen der Bramen, Royal- und Scheußelstengen hinauf prangte das blendende Weiß der Segel.
Es ist ein wunderbarer Tag, der in meinem Schiffsjournal eine außergewöhnliche Aufzeichnung gefunden hat und den ich jetzt zu schildern wage. Wohin das Auge blickt, erschaute es die unbeschreibliche Schönheit , die erhabene Majestät des Meeres; der unaufhörliche, genussreiche Wechsel des feenhaften Bildes prägt sich mit unauslöschbarer Erinnerung in das Herz des bewundernden Beschauers, ihm ist es, als ob er das Geheimnis des Meeres erlauscht, als ob er einen wunderbaren Schatz erobert habe, einen Schatz, den niemand zu rauben vermag. Versunken in den Anblick der blauen Fluten zieht diese wonnigliche Empfindung durch meine Seele. –
Wie eine Wolke eilt die VESTA, etwas nach Backbord überliegend, auf der glatten Meeresbahn dahin, als wolle sie nunmehr die günstige Gelegenheit wahrnehmen und den durch schlechtes Wetter verursachten Zeitverlust wieder einholen. Es war also wieder Aussicht auf eine schnelle Reise vorhanden; durfte ich mich nicht für den glücklichsten Menschen halten?
Es ist sieben Uhr morgens. Eine schlanke Brise weht zehn Strich von Steuerbord ein. Auf meinen Wunsch trägt der Steward den Kaffee herbei. Wie der braune Trank oben auf Deck mundet, umgeben von der Pracht des Meeres, wie vergnügt man da sein Stückchen pfeift und mit welchem Behagen man die Hände reibt! Allein die Beschreibung dieser nebensächlichen Dinge würde Seiten erfordern. Bleiben wir bei der Hauptsache!
Unter Leitung des Steuermannes ist die Bordwache noch beim Deckwaschen beschäftigt. Nach einer halben Stunde ist alles gereinigt, das Messinggeschirr geputzt und das Verdeck aufgeklart. Bald verkündet die Schiffsglocke acht Glasen. Sofort ertönt der Ruf des Untersteuermannes: „Loggen“ und die Fahrt des Schiffes wird gemessen.
„Tein Miel, Captein,“ rapportiert der Untersteuermann vergnügt.
„Good, Stürmann, lat se man loopen; hol den Luv-Brassen noch en beten in, - ick gleuv, wi krigt bald mehr Wind, de Luft süht mi dar to luwart ein beten smerig ut.“
Mittlerweile erscheint der Obersteuermann auf Deck, um die Wache zu übernehmen.
„Good oppassen, Stürmann.“ – „Gewiss, Captein.“
Kaum hatte ich in der Kajüte den Standpunkt des Schiffes festgestellt, ein leises Sinken des Barometers beobachtet, da eilte ich aufs Verdeck zurück, um meinen unterbrochenen Spaziergang wieder aufzunehmen. Die VESTA lief jetzt 12 Knoten. Diese Gewissheit gestattete mir den Luxus einer echten Havanna. Jedes kleine Wölkchen, das ringelnd emporstieg, gab Zeugnis von der ungetrübten Freude des Rauchers. In Folge des erstarkten Windes neigte das Schiff immer mehr nach Backbord über. Nach wenigen Augenblicken brüllte die weißschäumende See gegen den Bug des überliegenden Schiffes. Plötzlich erschienen, den Bug kreuzend, Hunderte von Springfischen, die in prachtvoller Ordnung reihenweise sich gleichzeitig über Wasser erhebend, spurlos verschwanden und dann wieder, dem Schiffe vorauseilend, im neckischen Spiel emportauchten. Der Seemann betrachtete dieses liebliche Schauspiel mit recht nüchternen Blicken.
Sogleich kletterten einige Matrosen, mit Harpune und Leine versehen, vorne nach dem Stampfstock hinaus; ein geschickter Wurf – und von der übrigen auf der Back stehenden Mannschaft unterstützt, wird die erlegte Beute, ein großer Springer, auf Deck gezogen. Das so unerwartet seinem nassen Elemente und spielenden Genossen entrissene Tier bescheinigt sein begreifliches Unbehagen durch eine zwar achtbare, aber durchaus zwecklose Kraftanstrengung; bevor 30 Minuten verstrichen, hat der Schiffskoch die Umwandlung des ihm übergebenen Schlachtopfers vollendet. Als die einigen Überbleibsel des lustigen Springers erscheint nur noch eine gehörige Portion wohlschmeckender Steaks zum willkommenen Morgenimbiss.
Inzwischen hat sich der Anblick des Himmels verändert. Die Sonne verschwindet zeitweilig hinter dicken, aufeinander getürmten Wolken. Der Wind fängt an, einige Striche zu schralen. – Am fernen Horizonte zeigen sich bleifarbige, mit roten und grünen Flecken untermischte Wolken; eine stets zunehmende Dünung kreuzt sich mit den kleineren Wellen des Meeres, die Anzeichen eines herannahenden Sturmes treten immer deutlicher hervor.
Aber er soll die VESTA nicht unvorbereitet finden, rechtzeitig werden die leichten Obersegel eingezogen und festgemacht, die Luken nachgesehen, alles gut gezurrt, um gegen die zu erwartenden Sturzseen gesichert zu sein. Sobald die Erinnerung an diesen Sturm geweckt wird, glaube ich wieder auf der Vorderkante des Halbdecks zu stehen, den Befehl gebend: Alle Mann auf Deck! Ich sehe die vertrauensvollen Blicke meiner Leute auf mich gerichtet, fühle den ersten Aufprall des Sturmes. „Untersegel auf! Klüver herunter!“, schallt es durch das Sprachrohr.
Vom taktmäßigen Gesange begleitet werden die Befehle schnell ausgeführt. Ruhig und gelassen steht die Mannschaft, fernere Befehle erwartend, auf Posten. Wind und See nehmen immer mehr an Stärke zu, dräuendes Gewölk türmt sich auf; abgerissene, rötlich erscheinende Wolkenfetzen fliegen mit rasender Geschwindigkeit über das Schiff hin. Dicht am Horizont zeigt sich ein blendend weißer Streifen. Unheimliche Töne, geheimnisvolles Rauschen und Sausen dringen aus der Ferne herüber, unglaublich rasch zieht es daher und erhebt sich zu einem entsetzlichen, herzerbebenden Donnergebrüll.
Vom Orkan gepeitschte Wogen sausen schäumend über die aufgewühlte Bahn – der Sturm bricht los! Nur mit der größten Anstrengung ist es meiner Stimme möglich, den erforderlichen Befehl: „Los die Obermarsfallen“ zu erteilen. Rasselnd senken sich die Obermarssegel nieder; das dumpfgrollende Geheul des Sturmes übertönt die ferneren Kommandos. In unheimlichen Tönen erbraust das Sturmlied des Meeres. Schiff und Masten ächzen unter dem gewaltigen Druck des Windes, es legt sich dergestalt auf die Seite, dass die Nocken der Rahen in die heraufwogende See tauchen.
Meine brave Mannschaft, oft bis am Halse im Wasser, versieht dabei so ruhig ihren schweren Dienst, als ob ihr gar nichts Besonderes begegne. Trotz der dräuenden Gefahr beginnt ein herzerfreuender Wettstreit, jeder will der Erste sein, um die Segel im Sturme zu reffen. Das ist der Stolz des Seemannes! Dort auf schwankender Rahe liegen die dunklen Gestalten Kopf an Kopf im erbitterten Kampfe mit den entfesselten Elementen.
Bis in die tiefe Nacht hinein steigt die Gewalt des Sturmes. Schwer arbeitend, oft von den hereinbrechenden gischtsprühenden Sturzwellen begraben, dringt die VESTA nur langsam auf der chaotisch aufgewühlten Bahn vorwärts. Blitz auf Blitz erhellt auf Sekunden den tiefschwarzen Horizont; mit furchtbarer Gewalt rollt der Donner einher, auf den Mastspitzen und den Nocken der Rahen tanzen die St. Elmsfeuer gespensterhaft in bläulich schimmernden Flämmchen auf und nieder. Im Anblick des gewaltigen, von Blitzstrahlen erleuchteten Schauspiels erbebt das Herz in banger Demut vor dem Zorne der Natur.
Unerschütterlich beharrt die Mannschaft auf ihrem gefahrvollen Posten auf den Rahen; mit fast übermenschlicher Kraftanstrengung sucht sie ihre Aufgabe, die schweren, steifen Segel zu dämpfen und festzumachen, zu erfüllen. Niemand denkt an Gefahr; wie in der Schlacht stehen die unbeugsamen Männer dem stürmenden Feinde gegenüber.
Sämtliche Segel sind jetzt eingezogen, nur ein kleines hinten gesetztes Sturmsegel muss der ganzen Wucht des Sturmes widerstehen, um den Kopf des Schiffes einigermaßen gegen die See zu halten. Dasselbe liegt jetzt beigedreht und treibt langsam seitwärts und rückwärts. Die schwierigste Arbeit der Matrosen ist vollbracht, erschöpft und durchnässt melden sie sich vor dem Halbdeck beim Steward, der jedem einen erquickenden Trank verabreicht.
Bis jetzt hat sich die VESTA wacker gehalten. Zwar ist die Gewalt des Sturmes noch nicht gebrochen, aber mit hoffnungsvoller Zuversicht konnte ich den heraufziehenden neuen Tag erwarten. In solchen feierlichen Augenblicken verschwindet die körperliche Ermattung, sturmgepeitschter Gischt hat das Antlitz mit einer Salzkruste überzogen, aber der stundenlang brennende Schmerz wird nicht beachtet – es gilt die Sicherheit des Schiffes.
Da endlich bricht der langersehnte Tag an, ein tiefer Seufzer entquillt der Brust, und von den Lippen steigt ein heißes Dankgebet zum Allmächtigen empor. Jetzt, wo die goldschimmernden Sonnenstrahlen das dunkle Gewölk durchbrechen, der Blick das sturmgepeitschte Meer klar und deutlich zu erfassen vermag, da regt es sich wieder hoffnungsfreudig in der Brust des Beschauers.
Wohl ruht der Blick auf dem entsetzlichen Zerstörungswerk des Sturmes, auf dem noch immer wild bewegten Meere, aber das grausige Dunkel der Nacht ist verschwunden, die Gefahr deutlich erkennbar. Noch einmal verschwindet der helle Sonnenglanz hinter dichten Wolkenmassen, erst mit dem allmählichen Zurückweichen des tobenden Wetters dringt er wieder vor und kann die Wahlstatt siegreich behaupten.
Freude spricht aus den Blicken der Matrosen, ihr Humor ist wieder entfacht; zu all den Herrlichkeiten des beginnenden Tages hat sich noch ein kleines Missgeschick gesellt. Wie die sämtlichen Matrosen so hat auch der Schiffskoch versucht, eine außergewöhnliche Leistung zu vollbringen. Trotz des schweren Überholens des Schiffes ist er in seiner Küche bemüht, den Kaffee für seine angestrengten Kameraden zu bereiten. Plötzlich bricht aber die Zurring des Kochherdes und Kochhaus, Herd, Koch und Töpfe, alles, was sich in diesem Raum befindet, wird mit einer rapiden Geschwindigkeit gegen die Leeschanzkleidung geschleudert.
Der kernige Fluch des entrüsteten Koches übertönt einen Moment das Geräusch des Sturmes; allein seine Absicht wird schlecht belohnt – unter scherzhaften Zurufen der hocherfreuten Deckwache sammelt der wutentbrannte Koch seine umherschwimmenden Trümmer. Die Szene wirkt so überaus komisch, dass die Mannschaft den sichtbaren Verlust ihres erwärmenden Getränkes nicht einmal bedauert und sich gerne mit dem Anblick des verzweifelten Koches begnügt.
„Du, den Kaffee drink man alleen, de ist doch en beten to dünn geraden.“ – „Du wullt woll upn Kaffepott dat Rieden lehren.“ – „Lot em doch, he will je man sin Tüg farben.“ – „Hein, holl den Lepel fast, he geiht sünst öber Bord.“ – So schwirrt es unausgesetzt durcheinander.
Frisch belebt und freudeerfüllt geht es an die Arbeit. Bald sind die Schäden nach Möglichkeit ausgebessert. Segel zieren wieder die Rahen, lebhafter wird die Fahrt des geretteten Schiffes und – wie der Dichter sagt: Neues Leben blüht aus den Ruinen!
Allmählich verstummt das Geräusch des Sturmes, die hochtürmenden Wogen sind verschwunden, sanft und gleichmäßig wiegt sich das Schiff wieder auf der leise wallenden Wasserfläche. Der unermessliche Himmelsdom prangt wieder im satten Azurblau, linder Wind schwellt die Segel – ein freudejauchzendes Hurrah entströmt den Lippen der Besatzung. – Die VESTA hat ihren früheren Kurs wieder aufgenommen. Jetzt ist alles Ungemach vergessen! Das ist Seemannsart.
Auch später wurde die VESTA mehrfach von starken westlichen Stürmen heimgesucht. Bisweilen rollte das Schiff so entsetzlich, dass fast jede Hoffnung auf seine Erhaltung schwinden musste. Es ist nicht meine Absicht, die zahlreichen Stürme, welche wir vom Kap der guten Hoffnung bis zum N.W. Kap von Australien zu bestehen hatten, zu beschreiben, aber ich möchte dem geehrten Leser eine kurze Andeutung machen, damit er sich wenigstens von der Wucht eines solchen Weststurmes eine annähernde Vorstellung machen kann.
Mein kleiner, auf dem Deck befestigter Schraubendampfer musste noch besonders mit Ketten versehen werden. Nach fast jedem Sturme waren einige starke, schmiedeeiserne Glieder zerrissen oder lang gestreckt. Eines Nachts wurde ich recht unsanft aus meinem Schlaf geweckt, der Sturm brach plötzlich herein, das Schiff holte so sehr über, dass das querschiffs stehende Sofa, auf dem ich soeben noch von der fernen Heimat geträumt, plötzlich kerzengerade emporgerichtet wurde und ich kunstgerecht auf den Füßen stand. –
Auch die doch gewiss hinreichend befestigte Kajütentür flog mit einem Rucke aus den Angeln, in Folge dessen sich mein treuer Neufundländer so getroffen fühlte, dass er seinen Schmerz in einem entsetzlichen Jammergeheul ausdrückte und erst nach einigen Tagen seinen alten Schlafplatz vor der heimtückischen Kajütentüre wieder einnahm.
Es war ursprünglich meine Absicht gewesen, die Route südlich um Australien und Neuseeland zu nehmen. Nach reiflicher Überlegung hielt ich es aber für vorteilhafter, den nördlichen Weg zu wählen, weil er kürzer ist und die Winde und Strömungen in der Flores-See und Pitts-Passage während der Wintermonate weit günstiger sind. In der nächstfolgenden Nacht warfen wir das Lot jede zweite Stunde und erhielten vor Tagesanbruch in 80 Faden Tiefe den erhofften Grund. Eine Stunde später wurde die Küste auf eine Entfernung von 10 Meilen sichtbar; wir steuerten dann mit günstigem, fast acht Tage anhaltendem Winde nordwärts. Auf der Höhe von Timor begann wieder der unausgesetzte Kampf mit schwerem Wetter, heftigem Gewitter und Böen, der indes leichter überwunden wurde, als die darauf eintretende lähmende Windstille.
Meine Absicht, die Timor-Straße zu passieren, wurde von den hier unerwartet auftretenden östlichen Winden vereitelt, der Kurs wurde daher nach der Allas-Straße zwischen Sumbava und Lombok gerichtet. Mit prachtvollem Wetter segelten wir dann ostwärts durch die Flores-See. Beim Passieren von Amblau fand ich die erwünschte Gelegenheit, meinen Reedern ein Lebenszeichen zu übermitteln.
Sobald unser Kanonenschuss verhallt war, näherte sich eine große Práo, in welcher sich der Gouverneur von Amblau, ein Malaie, in höchsteigener Person befand. Die Verständigung mit dem dienstbereiten Beamten bot wohl einige Schwierigkeiten, aber schließlich dämmerte es doch in dem Oberstübchen des Gouverneurs, wenigstens gab er durch Zeichen seine Bereitwilligkeit kund, meinen Rapport mit ans Land zu nehmen und baldmöglichst nach Batavia befördern zu lassen, wofür ihm einige kleine Geschenke ausgehändigt wurden.
In der nächstfolgenden, tief dunklen Nacht musste die Manipa-Straße durchkreuzt werden, es war das bei dem stürmischen Wetter und der schmalen Fahrstraße eine recht schwierige, unsere ganze Aufmerksamkeit erfordernde Aufgabe, aber sie wurde, Dank der unausgesetzten Anstrengung meiner Mannschaft, glücklich gelöst. Bald wurde Pulo Popa zwei Meilen Distanz passiert und am folgenden Tage die Dampier-Straße erreicht.
Die Vegetation der umliegenden Inseln ist eine so üppige und verlockende, dass ich der Versuchung nicht widerstehen konnte, auf einer derselben zu landen. Bald wurde die VESTA von zahlreichen Kanus umringt, deren Insassen Kokosnüsse, Ananas und Mangos feil boten. Die Leute gingen übrigens mit einer Vorsicht und Schlauheit zu Werke, die zur Genüge einen früheren Verkehr mit europäischen Schiffen bewies. Unsere Eingeborenen mussten also schon böse Erfahrungen mit Weißen gemacht haben, um so mehr waren sie erfreut, nach Ablieferung der verlockenden Früchte die ihnen zugesicherte Bezahlung zu erhalten. Während unsere Lieferanten schreiend und jubelnd Abschied nahmen, verzehrten wir die kostbaren Früchte mit großem Appetit; es war ja seit unserer Abfahrt der erste Bissen, der nicht unserem Schiffsproviant entnommen war.
Als wenige Stunden später totale Windstille eintrat, ließ ich sogleich ein Boot hinunter und landete auf Batanta. Genau 150 Tage nach unserer Abreise von Hamburg machte ich mir das besondere Vergnügen, wieder festen Boden zu berühren.
Leider gestatteten es die steilen, dichtbewachsenen Felsen nicht, weiter ins Innere zu dringen, ich musste mich nach mehreren vergeblichen Versuchen mit dem Einsammeln einiger Muscheln auf dem weißgewaschenen Strande begnügen.
Mit günstiger Brise passierten wir auf Kabellänge die Taubeninsel, gingen hier jedoch vor Anker, da es nicht ratsam erschien, während der Dunkelheit durch die zahlreichen Klippen und Bänke zu segeln. Nachdem bei Tagesanbruch wiederum Windstille eingetreten, beschloss ich in Begleitung meines zweiten Steuermanns ans Land zu rudern, um besondere Muscheln, Seepflanzen und Tiere zu suchen; dieses Mal war mein Versuch erfolgreich. Wir fanden einige seltene Muscheln am Strande und erlegten einige kleine Vögel. Was mich am meisten auf dieser unbewohnten Insel interessierte, war das Auffinden von Holothurien, eines eigentümlichen, zur Klasse der Echinodermen gehörenden, wurmartigen Tieres, aus welchem eine in China sehr beliebte Delikatesse, das sogenannte Trepang oder Biche la mar bereitet wird. Zu meinem Bedauern zeigten sich jene Tiere, nachdem ich dieselben an Bord präpariert, für den genannten Zweck wenig geeignet.
Zur Zeit der Ebbe wird das die Insel umschließende kleine Riff von nur 2 – 3 Faden Wasser bedeckt. Die in dem klaren Wasserspiegel reflektierenden Korallen gewähren ein prachtvolles, das Auge des Beschauers fesselndes Farbenspiel. An Bord zurückgekehrt, setzte abermals eine leichte Brise ein, und wir steuerten nunmehr unseren Kurs, vom schönen Wetter und günstigem Nordwestwind begleitet, nach Point Pigot. Bald peilten wir Point Pigot W. N. W. und Kap der guten Hoffnung O. ¼ N. und fanden durch Beobachtung, dass sowohl mein Privat- als auch der Schiffs-Chronometer, nachdem ich beiden schon bei Martin Bass-Rocks einen neuen Gang und Stand gegeben, genau übereinstimmten.
Meine Mannschaft hatte sich während der ganzen Fahrt gesund und munter erhalten, auch nicht das geringste Anzeichen von Skorbut oder sonstigen Krankheiten war bemerkbar. Dieser vortreffliche Gesundheitszustand war in erster Reihe der ausgezeichneten Verproviantierung des Schiffes zuzuschreiben, freilich wurde auch auf die stete Reinlichkeit, rechtzeitiges Lüften des Schiffsraumes peinlichst geachtet und meine Leute nach Möglichkeit von jeder Anstrengung befreit; es war ja für den Erfolg meiner Expedition von größter Wichtigkeit, dass meine Mannschaft bei Ankunft auf den Karolinen tatkräftig mit eingreifen konnte. So oft ich den ersten Steuermann nach dem Wohlbefinden der Leute befragte, immer erhielt ich die zufriedene Antwort: „Alles kandidel, Captein!“ –
Während der öfteren Unterbrechungen im letzten Viertel unserer Fahrt, die teils durch Windstillen, teils durch enge Passagen und zahlreiche Korallenriffe erfolgen mussten, erhielt die VESTA einen frischen Anstrich von innen und von außen; alle Spuren der sturmreichen Fahrt waren verwischt, im vollen Schmucke nahte sich das schöne Fahrzeug seinem vorläufigen Bestimmungsplatze.
Während die VESTA bei flauen Winden an der Küste von Neu-Guinea entlang segelte, benutzte ich die Gelegenheit, in Begleitung meines Untersteuermannes ans Land zu rudern und den Strand nach Gegenständen abzusuchen, die sich für das Godeffroy’sche Museum eigneten. Aber die Mühe war vergeblich, der Strand war leer. Die Erfolglosigkeit meiner Anstrengung betrübte mich nicht allzu sehr, sie diente vielmehr dazu, meine längst gehegte Absicht auszuführen.
Worin diese bestand? Nur in dem bescheidenen Verlangen, von dem herrenlosen Neu-Guinea Besitz zu ergreifen. Ich hatte bis jetzt nur fremdländische Flaggen flattern gesehen, viele prachtvolle Inseln kennen gelernt, die durch geringfügige Veranlassung in den Besitz europäischer Staaten gekommen waren. Warum sollte ich nicht für mein Heimatland dasselbe versuchen, was Engländern, Franzosen, Holländern und anderen Nationen gelungen?
Wenn sich auch nur mein Herzenswunsch erfüllte, die Besitzergreifung von Guinea weiter nichts als eine persönliche Genugtuung verhieß, so wollte ich ihn doch wenigstens ausführen, um der Heimat meinen guten Willen zu zeigen.
Während mein Steuermann die mitgeführte Hamburger Flagge und die zweckentsprechende Bambusstange zum Aufhissen derselben in Bereitschaft setzte, sann ich über die beste Bezeichnung dieser neuen Besitzung nach. Das war bei meiner Besitzergreifung die schwierigste Arbeit!
Zunächst wollte ich meinem Reeder eine kleine Aufmerksamkeit erweisen, dann gegen Hamburg meine Bürgerpflicht erfüllen und schließlich erwachte sogar das selbstsüchtige Verlangen, meinen Namen geographisch festzunageln. Tetens-Land klang gar nicht mal so schlecht; je öfter ich die Bezeichnung wiederholte, desto besser gefiel sie mir. Aber schließlich siegte doch meine Bescheidenheit; wenigstens sollte das Los entscheiden. Ich wählte drei gleiche Steine, versah jeden mit einem Namen und drückte die beschriebene Seite in den weichen Sand; als das Werk gewissenhaft beendet, rief ich meinen Begleiter herbei: „Stürmann, kumm mol en Oogenblick her.“ – „Scheun, Herr Captein.“ – „Kiek mol her, do sünd dree Stehn, nun goh mol hen un nümm eenen ut’n Sand, is ganz egol, wecken Stehn Du nümmst.“ – „Jawoll, Herr Captein.“ – „Nu roop mol den Nomen, du up’n Stehn steiht.“ – „Neu Hamburg! Herr Captein.“ – „Na, denn mark Di dat – dütt Land heet von hüt an Neu Hamburg. Nu wült wi man blos noch de Flagg hissen.“
Unter Hurrahrufen wurde der denkwürdige Akt vollzogen! Aber kaum zeigte sich das weiß-rote Banner der fernen Hansastadt an der Spitze des Bambus, da brachen plötzlich einige mit Speer und Keule bewaffnete Eingeborene aus dem nahen Urwald hervor, erhoben ein entsetzliches Geschrei und drangen sehr rasch auf uns ein.
Über die Absicht der Wilden konnte kein Zweifel bestehen, ihr Heulen und Waffenschwingen sagte genug. Kaum in Besitz eines Landes gelangt, sollte ich es schon wieder verteidigen. Ich kann nicht behaupten, dass mir diese Oberhoheitspflicht bei der augenscheinlich erdrückenden Übermacht sehr verlockend erschien. Immerhin wollte ich nichts ohne Zustimmung meines Steuermannes unternehmen, ein Entschluss musste gefasst werden, unsere Gegner kamen bedenklich näher.
Na Stürmann, war mokt wi nu?“ – „Uthoken, Captein.“ – „Unse Flagg?“ – „Nehmt wi mit.“ – „Und unse Land?“ – „Lot wi hier!“ – „Na denn man gau vorwärts, veel Tied hefft wi nich mehr.“
Innerhalb weniger Minuten hatten wir unseren ganzen Besitzergreifungs-Apparat wieder im Boot und stießen vom Lande ab. Wir hätten nicht länger zögern dürfen, kaum waren wir einige Hundert Fuß vom Ufer entfernt, da war die buntbemalte Gesellschaft auf unserem ursprünglichen Platze eingetroffen. Einige Zwanzig der verwegensten Kerle sprangen sogar ins Wasser und suchten uns schwimmend zu erreichen; unsere Verfolger schwammen vorzüglich. Wir ruderten zwar mit aller Kraft, aber trotzdem verringerte sich die Entfernung zwischen uns und den wütenden Landesverteidigern so wesentlich, dass sie uns, bevor wir das schützende Schiff erreichen konnten, sicher eingeholt haben würden. Leo, mein kluger Neufundländer, hatte den ganzen Rückzug höchst gleichgültig mitangetreten; als er aber jetzt die schwarzköpfigen Gestalten , deren schlanke Körper wie schnelle Delphine aus dem Wasser tauchten, aufmerksamer betrachtete, da ahnte vielleicht das treue Tier den ganzen Zusammenhang.
Leo sprang wütend empor und erhob seine kraftvolle Stimme gegen die heranrückenden Verfolger. Eine brillantere Wirkung hat wohl nie ein Hundegebell erreicht. Wie auf Kommando wandten sich die bestürzten Schwimmer in wilder Flucht zurück. Eine solch rapide Schwenkung hätte jeder attackierenden Kavallerie zur Ehre gereicht. Leo hatte den Angriff ganz allein abgeschlagen. Jedenfalls darf ich annehmen, dass er der erste Hund gewesen, welcher die Eingeborenen in Schrecken versetzte.
Wenn meiner Besitzergreifung auch keine allzu lange Dauer beschieden war, so hatte mir doch meine Landung und die eilige Flucht der wilden Schwimmer viel Vergnügen bereitet. Vielleicht war ich sogar der erste Deutsche, welcher die Flagge auf Neu-Guinea hisste, und das genügte meinem Ehrgeiz schon vollkommen.
An Bord zurückgekehrt, benahm sich Leo plötzlich höchst sonderbar, er rannte auf dem Vordeck wie besessen umher, bald stand ihm auch Schaum vor dem Munde. Das ganze Gebaren des Tieres war so unheimlich, dass es die Mannschaft für geraten hielt, schleunigst in die Wanten zu flüchten. Erst nachdem ich dem erkrankten Leo einige Eimer Wasser über den Kopf gegossen, wurde er wieder ruhiger und von dem Anfalle befreit. Ob dem armen Tiere die Eindrücke der letzten Stunde zu Kopf gestiegen waren, etwa ihm die wilden Eingeborenen noch in der Einbildung vorschwebten, oder ob er vom Sonnenstich betroffen war, weiß ich nicht bestimmt, das letztere erscheint mir indes am wahrscheinlichsten. Jedenfalls war ich hocherfreut, dass mir mein treuer Leo, der mir später noch recht wesentliche Dienste erwies, erhalten geblieben war.
Nach zweitägiger Fahrt sichteten wir die Sonserol-Insel, wo ich zu landen beschloss. In der Nähe der Insel ist kein Ankergrund vorhanden, das Schiff war daher gezwungen, während dieser Zeit beigedreht zu liegen. Sehr rasch wurde meine Absicht ausgeführt. Das Boot konnte sich jedoch nur auf hundert Fuß dem Ufer nähern, hier wurde das Wasser so seicht,, dass wir jeden Augenblick auf Grund geraten konnten. Es musste deshalb der kleine Anker ausgeworfen werden.
Wollte ich meine Landung bei diesem ungünstigen Wasserverhältnis dennoch ausführen, so blieb mir kein anderer Ausweg, als die Wasserfläche, so gut es ging, zu durchwaten. Soeben wollte ich das Boot verlassen und die einzuschlagende Richtung bestimmen, als mir eine eigenartige Überraschung bereitet wurde. Eine Schar Männer, Frauen und Kinder eilte vom Ufer ins Wasser, in der unzweideutigen Absicht, mir einen Besuch zu machen.
Im ersten Moment griff ich zu meinem Ruder, um dem fraglichen Vergnügen zu entgehen, aber sehr bald konnte ich die grünen Zweige bemerken, welche die Inselbewohner zum Zeichen des Friedens empor hielten. Bereitwilligst gab ich die bei fast allen Mikronesiern übliche, als friedfertig geltende Zustimmung.
Während der Hauptteil meiner Besucher zurückblieb, kamen acht herkulische, schön gewachsene Männer in die unmittelbare Nähe meines Bootes und begannen eine mir leider unverständlich gebliebene Ansprache. Meine Antwort in der Sprache der Palauer fand ebenfalls kein Verständnis.
Jetzt versuchte ich den betrübt darein schauenden Eingeborenen durch allerlei Zeichen anzudeuten, dass ich ihre Insel zu sehen wünsche, aber vor Sonnenuntergang wieder zurückkehren werde. Ein lebhaftes, Freude ausdrückendes Geheul, in das die rückwärtsstehende Schar kräftig einstimmte, folgte meinem Gebärdenspiel. Die acht Männer ergriffen ihre mitgeführten Kanu-Paddeln, legten die Enden derselben auf ihre Schultern und machten es mir ziemlich klar, auf der recht geschickt hergestellten Tragbare Platz zu nehmen. Willig folgte ich dieser freundlichen Einladung und erreichte trockenen Fußes die mit Kokospalmen dicht bewachsene Insel.
Unter unaufhörlichen Jubelrufen und einem entsetzlichen Geschrei, das wie lebhaftes Gänsegeschnatter klang, begann nun ein höchst sonderbarer Triumphzug bis zur Mitte des Dorfes. Hier strömten schließlich alle Einwohner zu einem dichten Knäuel zusammen.
Inmitten dieses tanzenden, schreienden und heulenden Schwarmes wurde ich noch immer auf meiner Sänfte feierlichst herumgetragen. Endlich war die Einleitung der Vorstellung beendet und ich stieg von meinem Paddel-Throne zu meinen Verehrern herab. Jetzt begann erst die eigentliche Begrüßungsfeierlichkeit.
Wer Hände hatte, streckte sie aus, um meinen Körper zu berühren, es erforderte meine ganze Kraft, um das Gleichgewicht zu erhalten; Mütter hielten ihre kleinen Kinder empor, damit sie mein Gesicht bestreichen konnten; wo die fürsorgliche Mutter fehlte, suchte der neugierige Sprössling an meinen Beinen empor zu klettern. Während die Männer und Kinder meinen Anzug, Bart und Haare, besonders aber die weiße Farbe meiner Arme und meines Gesichts bewunderten, konnte die liebe Weiblichkeit ihre besondere Neugierde nicht beherrschen und war unaufhörlich bemüht, meine Bekleidung zu entfernen oder mindestens zu verschieben.
Sobald sie sich davon überzeugt, dass ich allenthalben mit derselben weißen Haut versehen, dass sie also nicht künstlich erzeugt sei, sprangen die Weiber tanzend umher und gerieten schließlich in ein Entzücken, bei dem mir sehr unheimlich zu Mute ward.
Selbstverständlich nahm ich die sonderbaren Liebkosungen und Freundschaftsversicherungen der Damenwelt mit anscheinender Gelassenheit entgegen; ich wollte weder verletzen noch Gefahr laufen, gegen die Landessitte zu verstoßen. Die Feindschaft der Männer wäre die unvermeidliche Folge gewesen, und dass ich in diesem Falle die Insel nicht lebend hätte verlassen können, ist wohl selbstverständlich.
Dass die Eingeborenen auf einer noch niedrigeren Kulturstufe als die Bewohner von Palau oder Yap standen, bewies mir schon der gänzliche Mangel einer Bekleidung; sie trugen nicht einmal den gewöhnlichen, aus Blättern gewundenen Hüftgürtel der unzivilisierten Mikronesier. Jedenfalls war es für mich eine recht schwierige Situation, wusste ich doch, dass eine sehr strenge Grenze zwischen der Behandlung eines Weibes und der eines Mädchens gezogen war; was bei ersterem als Verbrechen betrachtet wurde, galt bei dem Letzteren als die höchste Ehre.
Unter den Weibern befanden sich eine größere Anzahl schön gebauter, formvollendeter Gestalten, deren zart gegliederte Hände und Füße mancher weißen Dame zur Zierde gereicht haben würden. Endlich war die Begrüßungsfeierlichkeit zu Ende.
Am meisten hatte darunter mein weißleinener Anzug gelitten; durch das fortwährende Berühren der gelb eingeriebenen Hände und Körper der Eingeborenen war meine Toilette in eine so bedauernswerte Verfassung geraten, dass sie für mich vollständig wertlos geworden war. Keine Seife der Welt hätte die gelbe, aus Pflanzen gewonnene, übelriechende Farbe der Kurkuma entfernen können.
Sobald man mich in die Hütte des Häuptlings geführt, entledigte ich mich so rasch als möglich meiner unheimlich duftenden Hülle und überreichte sie dem freundlichen Oberhaupte zum Zeichen des Friedens und der Verehrung. Niemals hat mir ein verschenkter Gegenstand mehr Freude gemacht.
Der Häuptling, in der verzeihlichen Annahme, dass diese Begrüßungsform unter den Weißen üblich sei, ergriff das freundschaftsverheißende Beinkleid und begann sogleich den Versuch, seine Achtung gebietende Körperfülle hineinzuzwängen. Eine ergötzlichere Szene lässt sich kaum denken.
Der liebenswürdige Häuptling hatte schon alle möglichen Arten versucht, aber mit einer wunderbaren Geschicklichkeit die allein richtige vermieden. Der Wilde mühte sich im Schweiße seines Angesichts redlich ab, zum Ziele zu gelangen, allein die Unaussprechliche widerstand energisch allen seinen Bemühungen. Schon wollte sich der höfliche Häuptling damit begnügen, indem er nur seinem rechten Beine die Segnung des europäischen Fabrikats zu Teil werden ließ und die andere leere Hälfte des Beinkleides wie eine Damenschleppe gravitätisch nachzog, als ich hilfreich eingriff.
Bei dieser Operation warf sich mein Opfer erschöpft zur Erde, als handle es sich um Leben und Tod. Endlich war das große Werk gelungen. Der Häuptling stolzierte in seinem neuen Kostüm einher; aus seinen Mienen sprach aber ein so entsetzliches Unbehagen, dass ich das Opfer meines Scherzes aufrichtig bedauerte.
Wer aber beschreibt die Überraschung des Volkes, als es seinen Landesvater in der neuen Verfassung erblickte? Als sich die erstaunte Menge genugsam ihres plötzlich von der Kultur beleckten Oberhauptes geweidet hatte, begann ich die Verteilung der mitgeführten Geschenke: Tabak, Angelhaken, Flintensteine und Feuerstahl. Das Freudengeschrei und Geschnatter erreichte seinen Höhepunkt. Während die Männer auf Geheiß des Häuptlings nach allen Richtungen fortliefen, begann die Damenwelt eine ganz besondere, noch nicht bei mir angewandte Liebkosungsart, der auch der letzte Rest meiner Bekleidung zum Opfer fiel. –
Ich atmete erleichtert auf, als die ausgesandten Männer mit den Gegengeschenken zurückkehrten. Eine Unmasse frischer grüner Kokosnüsse und Bananen, auch Hühner, Fische, Tarro und andere Appetit reizende Herrlichkeiten wurden vor mir aufgestapelt. Ein junges Mädchen, wahrscheinlich die Tochter des Häuptlings, zerlegte eine der schönsten Bananen mit ihren Händen und überreichte mir und dem Könige die einzelnen Stücke. Sobald das Mahl beendet, nahm ich Abschied von dem liebenswürdigen Gastgeber, auf dessen Begleitung ich in Folge der ihn beengenden Hälfte meines Beinkleides verzichten musste.
Ich wurde wieder auf die ursprüngliche Paddelbahre gesetzt und mit denselben Feierlichkeiten nach meinem Boote befördert.
Sobald die Träger mit den Geschenken eingetroffen, dankte ich in der Weise des friedliebenden Volkes und kehrte zu meinem Schiffe zurück. Bei dem verheißungsvollen Anblick der kostbaren Früchte beachtete meine Mannschaft kaum noch den Mangel meiner Bekleidung.
Nach einem Zeitraum von fünf Monaten, während welcher wir nur auf die Schiffskost angewiesen waren, schmeckten diese frischen Sachen ganz vorzüglich. Ob der Häuptling nach meinem Fortgang meinem Beinkleide noch länger die Ehre erwiesen, ist kaum anzunehmen, wohl aber, dass ich der erste Europäer gewesen, der in der Mitte dieses gemütlichen Volkes einige interessante Stunden verlebte.
Wir setzten unsere Fahrt fort und passierten nunmehr die Gruppe von St. Andrew oder Sonserol, welche aus zwei sehr kleinen, niedrigen, mit Kokosbäumen dicht bewaldeten Inseln bestehen. Sie sind von Korallenriffen umgeben, welche sich fast bis zum Lande erstrecken und die Brandung auf eine sehr große Entfernung erkennen lassen. An dem selben Tage kam Angaur, die südlichste der Palau-Inseln in Sicht, wir kreuzten die Inselgruppe hinauf und erreichten endlich nach einer 172tägigen Fahrt den Hafen von Malaccan, auch Korror-Hafen genannt. Bevor ich nun mit der Erzählung meiner Erlebnisse auf den Karolinen beginne, möge mir eine kurze allgemeine Erklärung gestattet sein.
Als die beachtenswertesten Inseln des Karolinenarchipels im nordpazifischen Ozean dürfen wohl die Palau-Inseln bezeichnet werden. Sie erstrecken sich von 6° 55 NBrt. und 134° 8’ OLg. Bis 8° 8’ NBrt. und 134° 35’ OLg. und sind die westlichste, größere Inselgruppe Mikronesiens. Mit Ausnahme zweier Inseln, Angaur im Süden und Kreiangel im Norden sind die 7 bewohnten und 20 unbewohnten Inseln von einem großen Riffe eingeschlossen. Bei einem Flächeninhalt von 16,29 Quadratmeilen dürfte die Einwohnerzahl der Palau-Gruppe kaum 10.000 übersteigen. Das hügelige, stellenweise sehr steile Bergland besteht teils aus schwarzgrauen Kalksteinfelsen, teils aus fruchtbarem Lehmboden. Eine reiche Vegetation, begünstigt durch hohe, von dichten Waldungen eingerahmte Berge, erhebt die Palau-Inseln zu den wertvollsten des ganzen Karolinenarchipels. Das Klima ist als ein Gesundes zu bezeichnen. Die kühlen Nächte und die heftigen tropischen Regenschauer regeln die während des Tages herrschende Hitze. Nur sehr selten werden die regelmäßigen Winde durch Wirbelstürme unterbrochen. Im Jahre 1862 wurde die ganze Gruppe von einem furchtbaren Typhon heimgesucht, der einen großen Teil der Kokospalmen zerstörte.
Außer der in der Südsee herrschenden Krankheit, der Elephantiasis Polynesiorum, fordert auch die epidemisch auftretende, sogenannte Influenza regelmäßig ihre Opfer.
Die Eingeborenen unterscheiden nur vier Himmelsgegenden und zwar Nordost, Südost, Nordwest und Südwest; deren letztere Bezeichnung, Angebart, dient auch gleichzeitig als Name für jeden Fremden, weil das erste europäische Schiff von Südwesten eintraf. In politischer Beziehung wird Palau in eine große Anzahl Länder geteilt, die sich zwar selbständig regieren, jedoch der Oberhoheit des Königs von Korror unterstellt sind.
Die Beratungen der Fürsten oder Häuptlinge finden in großen Klubhäusern statt; jeder der Teilnehmer hat seinen Platz an einer der zahlreichen Fensteröffnungen, die auch gleichzeitig als Eingang benutzt werden. Vor Beginn der Beratung herrscht ein tiefes, fast zehn Minuten währendes Schweigen. Nach der Beschlussfassung begibt sich die Versammlung – der jüngste Häuptling die Spitze und der König den Schluss bildend - im Gänsemarsch auf der gepflasterten Dorfstraße nach Hause. Die zwischen den mächtigen Staaten Artingal und Korror niemals beendete Eifersucht führt stets neue Verwicklungen und Kriege herbei. Insbesondere sind es die kriegerisch gesinnten Eingeborenen der nordöstlich gelegenen Insel Yap, welche die Entwicklung der europäischen Kultur wesentlich hemmen. Jeder Palau-Insulaner hat seinen besonderen Schutzgeist, der eine verehrt den fliegenden Fuchs, der andere die Taube, der dritte die Schlange oder irgend einen besonderen Fisch. Er betet die Tiere nicht an, bringt ihnen auch kein Opfer, darf sie sogar töten, aber niemals essen. – Heute ist Korror seiner Auflösung nahe. Die trägen, entarteten Eingeborenen können der fortschreitenden Zivilisation nicht mehr widerstehen. Wie lange noch, und der letzte Mikronesier wird verschwunden sein.
Das Einlaufen der VESTA in den Malaccan-Hafen geschah unter mancherlei interessanten Vorkommnissen. Obwohl das Wetter sehr schlecht war, starker Regen und Böen einsetzten, segelten mir doch sechs Kanus entgegen. Die Geschicklichkeit und Gewandtheit, mit welcher die Eingeborenen die kleinen Fahrzeuge auf offener, unruhiger See zu halten vermögen und fast fliegend die Wasserfläche durchschneiden, ist wahrhaft bewunderungswürdig.
Das sichere Gelingen dieses Wagnisses wird übrigens nicht nur durch die Geschicklichkeit der Eingeborenen, sondern auch durch die vorzügliche Bauart ihrer Kanus erreicht, welche wohl zu den besten im ganzen Pazifik-Ozean gerechnet werden dürfen. Unter den mir entgegeneilenden Kanus befand sich eines, in welchem ich auch einen Europäer bemerkte, in dem ich wenige Minuten später einen alten englischen Freund, Mr. Simpson, erkannte, der schon seit zwölf Jahren mit seiner Familie sich hier angesiedelt hatte. Es gab ein fröhliches Wiedersehen und lebhaftes Begrüßen. Sämtliche Eingeborene, die mich bei meiner ersten Anwesenheit kennen gelernt, freuten sich ungemein, mich wiederzusehen. Jeder drückte meine Hand und presste seine Nase auf mein gequältes Riechorgan.
Es war bei dieser anstrengenden Begrüßung zu spät geworden, um in die nur sehr enge Passage zwischen zahllosen Korallenriffen und Brandungen einzulaufen, daher musste ich den folgenden Tag abwarten.
Am nächsten Morgen befand ich mich vor dem Eingange der Passage, der Wind wehte aber so schräge, dass es sehr fraglich erschien, ob ich die Einfahrt riskieren könnte. Andererseits war es doch von großer Wichtigkeit, sobald wie möglich in den Hafen von Malaccan einzulaufen. Von meinem erfahrenen Freunde, Mr. Simpson, genügend unterstützt, entschloss ich mich nach kurzer Überlegung zur Ausführung des Wagnisses, das unter Mitwirkung der Insulaner in folgender Weise glücklich ausgeführt wurde.
Eine Menge großer Kriegs-Kanus schleppte mein Schiff durch die sehr enge Passage zwischen scharf einschneidenden Korallenfelsen in den inneren Hafen. Mit großer Eile glitten dieselben über die Wasserfläche dahin. Jedes Kanu war mit etwa 30 Mann besetzt. Eine fieberhafte Erregung hatte sich der Mannschaft bemächtigt. Im ununterbrochenen Freudengeheul die Paddeln schwingend, die Muscheltrompete blasend, oft während des Ruderns plötzlich aufspringend und im Kanu tanzende Bewegung machend, so lotsten uns die Eingeborenen mit fliegenden Haaren und leuchtenden Blicken ohne Unfall bis zum Ankerplatz.
Bei solchen Anlässen muss man die Inselbewohner bewundern, jeder Muskel ihres elastischen Körpers ist angespannt, aus ihren Augen blitzt es freudig im Spiel mit der Gefahr.
Die Mannschaft der VESTA war von diesem brillanten Manöver geradezu entzückt. Nie wurden die Arbeiten rascher verrichtet, das Schiff gereinigt und das Verdeck aufgeklart.
Sobald der Anker niedergelassen, bekundete eine Salve von zehn Kanonenschüssen unsere Ankunft in dem Hafen von Malaccan. In kurzer Zeit war die VESTA von zahllosen Kanus umringt, auf dem Verdecke wimmelte es von freudig erregten Eingeborenen, die Kokosnüsse und Tarro in großen Massen herbeitrugen und unausgesetzt ihre herzlichempfundenen Freudengrüße wiederholten. –
Die unerwartete Ankunft meines schönen Schiffes bereitete namentlich den Häuptlingen, nachdem sie sich von ihrem Erstaunen erholt, großes Vergnügen. Immer wieder wurde ich von ihnen betastet, als müssten sie sich davon überzeugen, dass ich der Wirklichkeit angehöre und nicht als ein Schatten die guten Freunde besuche. Kapitän Cheyne, mein einstiger Teilhaber, hatte die Nachricht von meinem Tode verbreitet.
Nach abermaliger Untersuchung begann der Häuptling in seiner Landessprache: „Nein, nein, Freund, du bist es wirklich, der große Häuptling Era Alleman!“
So wurde ich von dem gutmütigen Naturvölkchen als ein guter alter Bekannter empfangen; es war mir, als ob ich in die Heimat, in den Kreis meiner Familie zurückgekehrt wäre. Lebhaft wurde ich an meinen ersten Aufenthalt auf der Insel erinnert, hier hatte ich ja bereits ein und ein halbes Jahr als moderner Robinson fast bis zum Schlusse meines Aufenthalts in ungetrübter Freundschaft mit den Eingeborenen verlebt. Alles, was ich von ihren verlangt, hatte man mir bereitwilligst gewährt. Sehr rasch wurde ich wieder mit ihrer Sprache, ihren Sitten und Gewohnheiten hinreichend vertraut, von jedem Eingeborenen als einer der ihrigen betrachtet.
Dass mir die Insulaner ihre früher bewiesene Freundschaft erhalten, auch ein treues Andenken bewahrt, wie sich dessen kein Weißer, der vor mir unter ihnen geweilt, rühmen durfte, hatte mir der Empfang bewiesen.
Am nächstfolgenden Tage gelangte ich mit meinem Boote nach der Hauptstadt Korror. Wie ein Lauffeuer war die Kunde über die Insel verbreitet: Clow Rupack, Era Alleman sei zurückgekehrt!
Bald gewahrte ich das Herannahen einer großen Anzahl Kanus, die soeben die letzte Biegung um einen Felsen zurücklegten. Nach wenigen Minuten waren die Insassen erkennbar. König Abba Thule in Begleitung seiner höchsten Würdenträger beabsichtigte, mir einen Besuch zu machen.
Als des Königs Kanu auf 50 Schritte herangekommen, wurden 21 Kanonenschüsse zu seiner Begrüßung abgefeuert. Sobald der letzte Schuss verhallte, begrüßte mich der König und alle Bekannten auf das Herzlichste an Bord der VESTA. Im Gefolge des Herrschers befanden sich der Premierminister und Oberhofminister Arakoker, der Kriegsminister Iry Kelao, der Zeremonienmeister Kopack, sowie die Häuptlinge Klotrauel und Erturo nebst den zum großen Gefolge gehörenden Einwohnern von Korror.
König Abba Thule, eine umfangreiche, feiste Gestalt, mit dunkelbrauner, ölglänzender Haut, war nach der Landessitte nur mit der „Tapa“, einem schmalen, rotfarbigen Leibgurt bekleidet. Das lange, schwarze Haar, kunstgerecht verschlungen und mittelst eines geschnitzten Schildpattkamms nach hinten befestigt, zierte das königliche Haupt. Eine Manschetten ähnliche, aus dem Halswirbelknochen eines Seesäugetiers, des sogenannten Dugongs, verfertigte Spange am tätowierten Handgelenk, das über der linken Schulter hängende Beil, eines der wichtigsten Schmuckgegenstände Mikronesiens, vervollständigte die Toilette König Abba Thules. Er trug außerdem in seiner rechten Hand einen zierlich aus Kokosblättern geflochtenen Korb, worin sich die Rauch- und Kauutensilien nebst kleinen hohlen mit Kalk gefüllten Bambusstäbchen befanden. Des Königs Gesicht ist nach europäischen Begriffen nicht schön zu nennen, macht aber trotz seines geld-grün gefärbten Kopfhaares keinen unfreundlichen Eindruck. Die einzelnen auf der dicken Oberlippe sich erhebenden Haare dürfen auf die Bezeichnung Bart keinen Anspruch machen, weit günstiger für eine solche Anlage zeigt sich das von kleinen gekräuselten Haarbüscheln umrahmte Kinn. Die Bewegungen der stark entwickelten Gliedmaßen sind keineswegs schwerfällig, die Haltung fast straff und der Schritt sehr elastisch.
Nachdem die freundschaftlichsten Versicherungen und Grüße gewechselt, gab der König seinem Erstaunen über die achtunggebietende Größe meines Schiffes Ausdruck. Ganz besonders war es mein kleiner, auf Deck befindlicher Dampfer, der die Aufmerksamkeit Abba Thules in außergewöhnlichem Maße erregte. Der König wurde nicht müde, meiner Erklärung über Konstruktion und Verwendung meines Dampfbootes zu lauschen.
Auch das Gefolge bekundete ein lebhaftes Interesse für alles, was sich seinem Auge darbot. Wiederholt reichte mir der König die ölige Rechte zum Beweise seiner aufrichtigen Freundschaft. Bald entspann sich zwischen uns eine lebhafte Unterhaltung, die sich nach Erledigung des Hauptteils auf die Vorkommnisse während meiner Abwesenheit ausdehnte. Über alles, was zu erfahren für mich besonders wichtig war, gab der König bereitwillig klare, offene Auskunft...
Nur in einem Punkte zeigte Seine Majestät eine gewisse Zurückhaltung. Das war die Frage nach meinem früheren Chef und nachherigem Teilhaber Capitän Cheyne, die der König in merkbarer Verlegenheit ausweichend beantwortete; erst auf weiteres Drängen erklärte er über den Verbleib des Genannten nichts zu wissen. Ich war zu sehr mit dem Charakter des Königs vertraut, um dieser Aussage Glauben schenken zu können; wusste; wusste ich doch, dass die ganze Bevölkerung gegen den Kapitän einen unaussprechlichen Hass empfand, der einmal zum Durchbruch kommen musste.
Was ich über den Verbleib des Engländers vermutete, sollte ich schon sehr bald als Tatsache vernehmen.
Wie es die Hofsitte vorschrieb, musste ich am folgenden Tage den Besuch des Königs in der Stadt Korror erwidern. Zu diesem Ausflug benutzte ich meinen kleinen Dampfer; wo man ihn erblickte, erregte er Erstaunen und Bewunderung. Es war dem Könige und seinen intelligentesten Männern ein unerklärliches Rätsel, wie ein Boot ohne Segel und Ruder, nur vom Feuer gespeist, sich fortbewegen könne. Ein solches Wunder hatte niemals ein Inselbewohner gesehen!
Für mein geschäftliches Unternehmen konnte es keinen günstigeren Zeitpunkt geben. Meine stolze VESTA, das rätselhafte Dampfboot, wie auch meine große Anzahl geeigneter Tauschgegenstände, die der König nebst Gefolge mit staunender Bewunderung betrachtet hatte, erhöhte mein Ansehen so sehr, dass ich die Erfüllung meiner Wünsche mit Sicherheit erwarten durfte. Nachdem ich das Haus des Königs betreten, begann derselbe vertraulich: „Clow Rupack, Du bist mir und meinem Volke stets ein guter Freund gewesen, es haben nie Streitigkeiten zwischen uns stattgefunden, wir werden auch ferner in Frieden leben.“
Ich gab dem Könige die Versicherung, dass ich stets bestrebt sein würde, unser altes freundschaftliches Verhältnis aufrechtzuerhalten und nur gekommen sei, um die Landesprodukte gegen gute europäische Gegenstände einzutauschen. Der König war über meine Absicht sehr erfreut; die ihn bislang beherrschende trübe Stimmung begann zu weichen. Es war mir klar, dass der König bei meinem Eintreffen eine Befürchtung gehegt, die sich durch meine heutige Erklärung als irrig erwies. Ich blieb daher bemüht, die wahre Ursache jener Befürchtung zu ergründen und gelangte durch die nochmalige Erwähnung des Kapitäns Cheyne auf die richtige Spur.
Der König unterbrach plötzlich die Lieblingsbeschäftigung aller Mikronesier: die Bereitung der Betelnuss, ein Umstand, welche die außergewöhnliche Erregung des Königs verriet.
„Warum nennst du wiederum den Namen eines Mannes, der uns verhasst ist?“ fragte der König fast vorwurfsvoll. „Ist es nicht auch dir erwünscht, wenn er nie wieder unseren Boden betritt?“
„Doch nur dann, wenn ich dessen sicher bin!“
„Du darfst es sein.“
„Kapitän Cheyne liebt es, seine Umgebung zu überraschen; vielleicht sitzt er in diesem Augenblick in Manila oder Hongkong und freut sich darüber, Euch irregeführt zu haben. So plötzlich er verschwunden, so plötzlich kann er zurückkehren.“
„Clow Rupack! Der schlechte Mann wird nicht zurückkehren!“
„Das wünschest du?“
„Nein, ich weiß es.“
„So ist er tot?“
„Ja, er ist es.“ Der König sprang nach diesem ihm entschlüpften Geständnis erregt empor, augenscheinlich bedauerte er, diese bestimmte Erklärung gemacht zu haben. Mit aller Anstrengung unterdrückte ich meine Überraschung; wollte ich das Nähere vom König erfahren, so blieb mir nur der eine Ausweg übrig, eine erkünstelte Gleichgültigkeit zur Schau zu tragen. Nach sekundenlangem, tiefen Schweigen begann Abba Thule endlich seinen eingehenden Bericht.
„Kapitän Cheyne hat nach deiner Abreise wiederum unsere Insel besucht und unter der Vorgabe, nur Trepang und Schildpatt zu erlangen, uns nur Böses zugefügt. Auf sein Anraten haben unsere alten Feinde aufs neue den Krieg gegen uns begonnen, und als auch dieser Streich nicht gelang, entlockte er uns ein Zugeständnis, nach welchem England von unserer Insel Besitz ergreifen durfte. Das Volk von Palau nahm Rache an dem bösen Menschen. Er wurde abends unter dem Vorwande aus seinem Hausse gelockt, dass ein mit Schweinen und Tarro beladenes Kanu gelandet sei und man diese Gegenstände an ihn abliefern wolle. Kaum hatte der Kapitän sein sicheres Haus verlassen, da fielen die Männer über ihn her, schlugen ihn mit einem Tomahawk nieder, und als er trotzdem noch lebte, wurde er mit einem großen Fliesenstein stückweise zermalmt und ins Meer versankt. Gott hat uns von dem bösen Geist befreit. –
Das also war das Ende des Mannes, der jahrelang einen unheilvollen Einfluss auf die Bewohner der Karolinen-Inseln ausgeübt, der zur Erreichung seiner unlauteren Absichten kein Mittel verschmäht, Weiße und Farbige, jeder der sich seinen herrschsüchtigen Gelüsten widersetzte, unerbittlich zu Grunde gerichtet hatte...
Die bevorzugte Begrüßung , welche mir der König und alle Eingeborenen nach dem Einlaufen meiner schönen VESTA erwiesen, gab mir volle Bürgschaft für das Gelingen meines geplanten Unternehmens. Weit achtunggebietender konnte ich jetzt mit der vorzüglichen Godeffroy’schen Ausrüstung meine früheren Handelsbeziehungen wieder aufnehmen...
Nachdem die Begrüßung beendet, die Verträge mit dem König formgerecht geschlossen, begann zunächst ein lebhafter, geschäftlicher Verkehr. Vom frühen Morgen bis zum späten Abend wurden mir nicht nur die gewünschten Produkte, sondern auch eine große Anzahl von Objekten eingeliefert, die ich für das Museum Godeffroy bestimmte. Nach dieser unerwartet großen Ansammlung schritt ich zur Ausführung meiner weiteren Pläne.
Die Palau- und diesen nächstgelegenen Inseln genügten mir nicht mehr für die Gewinnung des wertvollen Biche la mar und Schildpatts; ich beabsichtigte daher, die entfernteren, bislang nur selten von Europäern besuchten Inseln der Matelotas- oder Angelugruppe, die Mackenzie- oder Ulithi-, sowie Fais- und Wolea-Inseln in den Bereich meiner Ausbeute zu ziehen. Im Hafen von Korror verstärkte ich die Anzahl meiner Mannschaft durch zwei Engländer, drei Palau-Insulaner, vier Manilla-Leute, drei Chinesen und einen Westinder. Mit dieser gemischten Gesellschaft trat ich nach genügender Verproviantierung die beabsichtigte Reise an.
Auch Passagiere befanden sich an Bord der VESTA. Es waren zehn Eingeborene von Yap, die mit ihren auf Palau ausgehauenen großen Steinen, welche dort als Geldstücke von hervorragendem Wert dienen, in die Heimat zurückkehren wollten. Als Scheidemünzen werden daselbst große Perlmutterschalen benutzt. Da mir ein derartiges Zahlungsmittel nicht behagte, so gab ich den bittenden Geldfabrikanten freie Passage. Die aus weißem, glitzernden Gestein ausgehauenen Geldstücke, in deren Mitte sich ein fassgroßes Loch zur Aufnahme des Tragbalkens befindet, zeigen die Form eines großen Schweizerkäses. Von diesem Geldmittel darf nur stets eine bestimmte Anzahl angefertigt werden, was jedenfalls auf eine geregelte Finanzwirtschaft schließen lässt.
Nach einer kaum achttägigen Fahrt erreichten wir Yap und ankerten in dem mir bekannten Hafen Rulebay. Yap besteht aus zwei größeren, nur durch schmale Landwege miteinander verbundenen Inseln und hat einen Flächeninhalt von ungefähr vier deutschen Quadratmeilen. Die Einwohnerzahl der dicht bevölkerten Insel erreichte zu jener Zeit die Höhe von 6.000.
Wie fast alle Inseln der Karolinengruppe wird auch Yap von einem Korallenriff umschlossen; ein guter fahrbarer, freilich nur eine halbe Seemeile breiter Kanal führt bei den Hauptstädten Rul und Tomil in einen sicheren Hafen.
Die oberen Erdschichten des ungemein fruchtbaren Landes bestehen aus Tonmassen, während der felsige Untergrund vulkanischen Ursprungs zu sein scheint.
Die Insel Yap gewährt dem Beschauer einen höchst malerischen Anblick. Sanftgrüne, fruchttragende Flächen zieren die Spitzen der sanft ansteigenden Berge, in der Niederung erstrecken sich wunderbar dichte Kokoswälder, teils bis zum Ufer ausgedehnt. Die himmelblaue See, begrenzt von schneeweißem Sandstrande, erhöht den Reiz des von dichten Palmwäldern gebildeten Hintergrundes, aus welchem die Dörfer deutlich hindurchschimmern. Die Pracht dieses kleinen Paradieses ließ mich einen Augenblick meine wilde Umgebung vergessen.
Ein Kanonenschuss lockte einige Neugierige herbei, die, sobald sie mich erkannten, davoneilten und mit der ganzen Einwohnerschaft eiligst zurückkehrten. Bald herrschte auf dem Verdeck meines Schiffes ein geschäftiges Treiben. Alles, was für mich Wert besaß, schleppten die Wilden herbei und empfingen dagegen die verlockenden Tauschartikel.
Trotz der großen Freude meiner Lieferanten war doch Vorsicht geboten; in unbewachten Augenblicken sind die hinterlistigen, stets kampfbereiten Eingeborenen zu jeder Gewalttat geneigt. Bemerken sie indes, dass man ihr Tun aufmerksam verfolgt, dann wird der freundschaftliche Verkehr ohne Störung fortgesetzt. Überhaupt wird der blutdürstige Yapbewohner von allen tributpflichtigen Stämmen sehr gefürchtet und seinen Befehlen Gehorsam geleistet. Selbst die Bewohner einiger auf Yap gelegener Dörfer werden als Sklaven behandelt und müssen alle ihnen aufgetragenen Arbeiten ohne Entschädigung verrichten.
Viel Vergnügen bereitete mir das Wiedersehen der lieblichen Königstochter Kierko, die mir als sorgsame Hausfrau freudeglänzend entgegeneilte, damit Clow Rupack erkennen möge, dass man ihm von ganzem Herzen danke und ihn nicht vergessen habe.
Kierko hatte zwar ihre zierlichen Formen, ihre graziöse Haltung eingebüßt, dennoch erschien sie mir von allen Frauen nicht nur als die schönste, sondern auch als die klügste des ganzen Staates. Allein schon ihre kleinen, vollen Händchen, die sie nach der Sitte der Frauen geschmackvoll tätowiert hatte, so dass man sehr lebhaft an die Glacés der europäischen Damen erinnert wurde, verliehen der koketten Kierko ein schmuckes Äußeres.
Meine geschäftliche Tätigkeit erlaubte mir leider nicht, auf die vertraulichen Mitteilungen der glücklichen Hausfrau zu achten.
Wenige Tage später erhielt ich den Besuch des mir befreundeten Königs von Krurr, Fonnway, dessen Begleitungskanu große Quantitäten von Kokosnüssen, Hühnern, Yams und Malasses für mich als Geschenk brachte. Bereitwilligst gestattete der König meine Zweigniederlassung, die von einem Europäer und drei Palau-Insulanern geleitet werden sollte, während ich mit dem Schiffe die ferneren Inselgruppen besuchte.
Auf Befehl des Königs kamen 50 Eingeborene an Bord, die zum Fischfang auf den Matelotas-Inseln Verwendung finden sollten. Bei den starken Strömungen und den vielen unsichtbaren Riffen ist das ankergrundlose Fahrwasser dieser Gruppe eines der gefahrvollsten im ganzen Pazifischen Ozean. An der Ostseite des Riffes ist nicht einmal das Brechen der See bemerkbar, ein Schiff kann hier glücklich über dasselbe hinweggleiten, gerät aber dann in eine Lagune und ist am westlichen Riffe unrettbar verloren, wie die Strandung der „EBBA-BRAHE“, eines nach China bestimmten Vollschiffes, zur genüge beweist.
Meine Absicht, einige von dem gestrandeten Schiffe herrührende, dort vorgefundene Gegenstände einzutauschen, scheiterte leider an der Hartnäckigkeit der Eingeborenen. Die Kajütentüren, Paneele und Planken waren zum Bau einiger Häuser verwendet worden, in welchen Kisten, Tauwerk und mancherlei Schiffsgegenstände verwahrt waren.
Die von 80 bis 100 Eingeborenen bewohnte Insel bietet außer wenigen Kokosnüssen und Fischen kein weiteres Nahrungsmittel. Trotz dieser kargen Lebensweise zeigen die Eingeborenen ein gutes, kräftiges Aussehen. Ihre Toten versenken die Insulaner im Meere, damit der nach ihrem Glauben im Wasser befindliche Fischgott ihnen gut gesinnt bleibe.
Auch die Eingeborenen der wenige Tage später erreichten Insel Fais zeigten sich recht freundlich, brachten mir Fische und Kokosnüsse; da aber diese Insel weder geschäftliche noch ethnologische Ausbeute bot, setzte ich meinen Kurs fort und erreichte bald 25 kleine, nur teilweise bewohnte, sehr flache, hügellose Inseln, welche die Mackenzie-Gruppe bilden. Zu den bevölkertsten derselben gehören Moggomeng, Fallalep, Assur, Fandrée und Mongin.
Die beiden ersten Häuptlinge, Giurr und Ronnerné , welche diese Gruppe mit ihren kaum 700 Köpfe zählenden Einwohner beherrschen, haben ihren Wohnsitz auf der Insel Moggomeg. Die Männer der Mackenzie-Gruppe sind am ganzen Leibe tätowiert und trotz ihres unheimlichen Aussehens wohl friedfertige, aber sehr falsche Menschen. Die wenigen Eingeborenen von Yap, die sich hier aufhalten, üben noch außerdem einen sehr schlechten Einfluss auf die Bewohner dieser Gruppe in der Weise aus, dass sie, falls sich ihnen eine günstige Gelegenheit dazu bietet, einen Angriff auf Schiffe unternehmen. Nach mancherlei Schwierigkeiten erreichte die VESTA endlich guten Ankergrund in der Nähe der Insel Assur.
Zur Verhütung eines Angriffs wurden die Enternetze ausgespannt, die Kanonen geladen, Wachposten ausgestellt und alle Waffen in Bereitschaft gehalten. Die größte Abschreckung wurde indes durch die hellroten Mäntel unserer Schildwachen erreicht. Selbst die beiden Könige wurden beim Anblick dieser harmlosen Gewandung meiner Wachtposten so tief erschüttert, dass sie durch keinen Zuspruch zu bereden waren, an Bord zu erscheinen.
Erst beim Vorzeigen einer kleinen Muschel, die mir König Abba Thule für diesen Fall eingehändigt hatte, wurden sie zutraulicher und versprachen am nächsten Tage zu erscheinen. Dem Versprechen der Könige schenkte ich nur wenig Glauben, vielmehr erwartete ich einen Angriff während der Nacht und erhöhte meine Sicherheitsmaßregeln. Die Könige erfüllten jedoch ihr Versprechen und kamen zur bestimmten Zeit vertrauensvoll an Bord.
Mit Hilfe eines meiner Eingeborenen von Palau wurden die Landesherren von meiner beabsichtigten Geschäftsverbindung verständigt und jede sonstige Erklärung gegeben. Bevor sich jedoch die Könige zu einer eingehenden Besprechung entschlossen, stellten sie sich mir gegenüber und drückten zum Zeichen des Hungers mit beiden Händen auf die Magengegend. Auch ohne ihren kläglichen Ausruf: „I hat ge lock (wir sind hungrig)“ wäre jenes Zeichen verständlich gewesen. Sofort wurde ein respektables Quantum süßer Kartoffeln und Yams für die hungrigen Majestäten bereitet, das mit einem bewunderungswürdigen Appetit in die leeren Mägen meiner Gäste schon nach wenigen Minuten verschwunden war.
„Wir leben nur von Kokosnüssen und Toddy,“ erklärte der erste König, als habe er das Bedürfnis, seine außergewöhnliche Esslust zu entschuldigen, „das Meer liefert uns nur wenige Fische, wir leiden sehr oft Hunger, dem viele Männer und Frauen zum Opfer fallen.“
Die geschäftliche Verhandlung sollte auf Wunsch der Könige in Gegenwart aller Würdenträger am nächsten Tage auf Moggomeg stattfinden. Gut bewaffnet, aber ohne Begleitung, erreichte ich den großen, von Kokospalmen umrahmten Versammlungsplatz. In der Mitte des von 200 sitzenden Männern gebildeten Kreises standen die Häuptlinge zu meinem Empfange bereit.
Ein längeres Schweigen bezeichnete den Beginn der feierlichen Prozession. Nachdem die Könige meine Schultern mit ihrem Ehrengeschenk, zwei neuen Tapas, geschmückt hatten, wurde ich in die Mitte des Kreises geleitet und erhielt hier meinen Platz zwischen den beiden Monarchen. Während der abermals beobachteten, längeren Ruhezeit waren die Blicke der entsetzlich anzuschauenden Männer auf mich gerichtet, meine weiße Farbe, wie nicht minder meine europäische Bekleidung erregte ihre Aufmerksamkeit im höchsten Grade.
Unwillkürlich fasste ich an meinen in der Tasche verborgenen Revolver. – Endlich begannen die eigentlichen Verhandlungen, welche zu dem erwünschten Ergebnis führten, dass nicht nur meine Ansiedlung zur Gewinnung von Biche la mar gestattet wurde, sondern auch, dass sich die Eingeborenen zum Fangen der Holothurien verpflichteten. Zur Bekräftigung unseres Kontrakts musste ich den Königen einige Geschenke einhändigen und kehrte erfreut über meinen Erfolg, nachdem ich die Insel oberflächlich besichtigt, an Bord meiner VESTA zurück.
Am nächsten Tage begann sofort die Arbeit. Mein kleiner Dampfer kam hier zur vollen Tätigkeit; er nahm nicht nur die zahlreichen Fischerboote ins Schlepptau, ich konnte auch von jetzt an die verschiedenen Stationen besuchen und alle Anordnungen persönlich leiten. Leider wurde das Wetter ungünstig, so dass ich mich entschließen musste, eine Abteilung zuverlässiger Leute hier zurückzulassen und eine südlicher gelegene Inselgruppe aufzusuchen. Zunächst berührte ich wiederum die Insel Fais.
Die starke Brandung, die im Gegensatz zu den vielen anderen Inseln von keinem Korallenriff umschlossen ist, macht die Fahrten mit den Kanus unmöglich. Die Eingeborenen können sich daher nur mittels floßartig zusammengefügter, nicht ausgehöhlter Baumstämme auf die See hinauswagen.
Über die Entstehung der Insel Fais herrscht unter den Eingeborenen eine der polynesischen Mythe ziemlich verwandte Sage, deren Kernpunkt sich auf das Hervorangeln von festem Land durch die Göttin Loropp bezieht. Die Angel, mit welcher jene Göttin die Insel aus dem Meeresgrunde emporzog, ist nach mancherlei Wanderungen in den Besitz des Königs von Yap gekommen. Infolgedessen wurde die Insel tributpflichtig und Eigentum des Königs von Yap. Eine fernere Sage erzählt von einer Göttin Isserie und einem auf Yap vergrabenem Beile, bei dessen Ausgrabung die Ulithi-Inseln von der See verschlungen würden.
Infolge dieses unerschütterlichen Glaubens wird es den listigen Yapleuten sehr leicht, jene Inselgruppe in fortwährender Tributpflichtigkeit zu halten. Alle meine Bemühungen, die Könige von der Gehaltlosigkeit ihrer Sage zu überzeugen, waren fruchtlos, ja sie wurden sogar fast ungemütlich, als ich jenen Märchen keinen Glauben schenkte.
Wahrscheinlich ist es, dass aus diesem Grunde die ersten auf der Insel im Dienste der Zivilisation tätig gewesenen katholischen Missionare von den Eingeborenen ermordet wurden. Ein ähnliches Schicksal wurde fast allen Schiffsmannschaften bereitet, die jene Insel berührten; noch in der letzten Zeit hatte man hier die Besatzung einer Maleien-Práo niedergemetzelt; ein einziger Knabe wurde verschont und mir zum Geschenk gemacht; selbstverständlich gab ich dem Erlösten, auf Palau angekommen, die langersehnte Freiheit. Bei meinem Abschied wurden die Könige unerklärlich weichherzig, Tränen standen in den Augen der Wilden, unaufhörlich küssten sie meine Hände und gelobten feierlichst, angestrengt zu fischen und meine dort zurückgelassenen Leute gut zu behandeln.
Die späteren Ereignisse lieferten den Beweis, dass weder die Tränen noch die Freundschaftsversicherungen dieser Könige die geringste Bürgschaft bieten, dass hier vielmehr nur die sichtbare Gewalt zum Ziele führt.
Meine Hauptstation auf Yap war nach einer schwierigen Fahrt abermals erreicht. Von dieser Insel aus wurde nach Übernahme von 100 Eingeborenen mit ihren 25 Kanus nebst reichlichen Nahrungsmitteln die geplante Reise nach den l’Echiquier-Inseln , einer zu jener Zeit noch nicht von geschäftseifrigen Europäern besuchten Gruppe, nördlich von Neu-Guinea, fortgesetzt. Während der ersten Tage herrschte eine höchst fatale Windstille; später wurde die VESTA von starken, widrigen Strömungen widerstandslos fortgerissen und längs der Küste von Neu-Guinea getrieben. Endlich hatten wir mit großer Mühe unseren Bestimmungsort erreicht und einen guten Ankergrund gefunden, da brach ein furchtbarer Orkan herein, mit dem wir vier Tage und Nächte um Schiff und Leben rangen.
Bei Eintritt günstigen Wetters wurden sofort Boote ausgesetzt und von den Yapleuten das Fischen des Trepangs begonnen. Diese Arbeit lockte eine Anzahl Kanus der Eingeborenen herbei, die indes in einer ziemlichen Entfernung vom Schiffe Halt machten und unser Tun aufmerksam beobachteten.
Begleitet von fünf Mann ruderte ich den Eingeborenen entgegen. Sobald diese unsere Absicht bemerkten, eilten sie schleunigst zurück, schleppten ihre Fahrzeuge auf den Strand und erhoben ein entsetzliches Geheul. Dennoch drangen wir soweit vor, dass man unsere empor gehaltenen europäischen Sachen erkennen konnte. Unser friedliches Zeichen wurde verstanden.
Die Wilden schleppten Bananen und Kokosnüsse herbei und erwarteten schreiend und tanzend unsere Ankunft. Bald war der Austausch unserer Sachen beendet. Merkwürdigerweise schenkte man unserer weißen Hautfarbe am meisten Beachtung, die erstaunten Menschen bestrichen mit ihren Händen unsere entblößten Arme und als sie die vermeintliche Farbe nicht entfernen konnten, prüften sie mit ihrer ausgestreckten Zunge wiederholt die Echtheit derselben. Auch erreichten wir unseren geschäftlichen Erfolg insofern, als die Wilden durch Gebärden andeuteten, die von uns gewünschten Fische fangen und an das Schiff liefern zu wollen.
Je mehr wir unsere neuen Geschäftsfreunde kennen lernten, desto unheimlicher wurde es uns in ihrer Nähe. Allein schon die entsetzliche Gewohnheit der vollständig nackten Eingeborenen, das Haupthaar ihrer toten Verwandten oder das ihrer erschlagenen Feinde an dem eigenen Kopfhaar zu befestigen und wie eine Löwenmähne, teils auf der Brust, teils im Nacken flattern zu lassen, bewies zur Genüge, auf welcher niedrigen Kulturstufe diese Geschöpfe standen.
Bei meiner Wanderung durch ein im buschigen Unterholz erbautes Dorf erhielt ich die Gewissheit, dass wir uns tatsächlich unter Menschenfressern befanden. – Eine Menge Menschenschädel und –knochen waren unter den dichten Baumzweigen versteckt, die ganze Beschaffenheit jener menschlichen Überreste deutete darauf hin, dass ein Teil derselben erst seit wenigen Tagen hier gelagert haben konnte.
Als ich dem Ältesten dieser entmenschten Scheusale einen gefundenen Schädel zeigte, machte er mir durch untrügliche Zeichen verständlich, dass ihn der Anblick dieser Knochen erfreue. Die Hütten der l’Echiquier-Insulaner sind nur 3 ½ Fuß hoch und 8 bis 10 Fuß lang, so dass man nur kriechend hineingelangen kann; außerdem sind sie sehr schlecht gebaut, wie man es nur selten auf anderen Inselgruppen bemerkt.
Im Innern des Raumes befand sich nur ein Feuer- und Schlafplatz, beide ohne irgendwelche Einrichtung. Außer Fischspeeren und aus Stein gefertigten Beilen besitzen die Wilden keine Waffen. Bananen und Kokospalmen sind nur wenige vorhanden, dahingegen große mächtige Bäume, die sich als Nutzholz verwerten lassen. Die Einwohner fristen ihr Leben nur von Fischen, Schaltieren und verschiedenen Baumwurzeln.
Während der Gewinnung des Biche la mar ließ ich ein Stück Land urbar machen, säte verschiedene Gewächse und pflanzte süße Kartoffeln und Yams, die zur Freude der Wilden schon nach einer unglaublich kurzen Zeit großartig gediehen. Von der Tierwelt habe ich nur wilde Tauben und Ratten in großer Anzahl bemerkt. Während die ersteren sehr wohlschmeckend sind, verdienen die letzteren allein schon ihres eigenartigen Aussehens halber ein aufmerksames Betrachten.
Das einem Opossum ähnliche Tier von der Größe einer Katze trägt seine Jungen in einem Beutel, ist sehr scheu und wird nur während der Nacht auf Bäumen, wo es sich mit seinem langen Schwanze an die Zweige hängt, angetroffen. Der Kopf gleicht dem der Ratte; die Beine sind kurz und mit scharfen Krallen versehen. Leider ist das eine von den Yapleuten gefangene Exemplar nach kurzem Aufenthalt an Bord verendet.
Sobald wie unsere Bauten errichtet hatten, wurden die mitgeführten Schweine in Freiheit gesetzt, um selbst für ihre Nahrung sorgen zu können. Wollten wir nun frisches Fleisch genießen, so mussten wir zunächst eine Treibjagd auf die frei herumlaufenden Tiere unternehmen.
In der ersten Zeit wurde unser recht belangreicher Gewinn von Biche la mar und großen Perlmutterschalen durch nichts gestört; bald aber wurden unsere Kanus von den l’Echiquier-Insulanern beunruhigt und schließlich im offenen Kampfe angegriffen. Mehr als 100 bemannte Kanus zogen in Schlachtordnung heran. Meine kampfeslustigen Yapleute stürmten entschlossen gegen die Feinde.
Dieses Schauspiel machte mir viel Vergnügen; um so mehr, als meine mit dem Werfen der Speere viel geübteren Bundesgenossen unsere Gegner in die Flucht schlugen und mit mehreren erbeuteten Kanus und sonstigen Siegestrophäen zurückkehrten. Unsere Reise wurde nunmehr festgesetzt. Während der außergewöhnlich langen Dauer derselben wurde die Situation bedenklich, da die Ernährung meiner zahlreichen Gesellschaft mir viele Sorgen verursachte. Vorläufig mussten sich meine Yapleute mit kleinen Rationen begnügen, trotzdem waren sie recht vergnügt und freuten sich auf die baldige Heimkehr.
Insbesondere war es der Anblick der hohen, die Küste von Neu-Guinea einrahmenden Berge, welcher dieses freudige Erstaunen der Yapleute hervorrief und die gemütlichste, von dem entsetzlichen Gesange ihrer Lieder unterstützte Stimmung rege hielt, bis ihre Heimatinsel in Sicht kam.
Auf der Rückreise passierte ich die Insel Sonserol und war so glücklich, von den Eingeborenen Kokosnüsse und Fische als Nahrungsmittel für meine Leute einzutauschen. Nach meiner Ankunft auf Yap wurde zunächst sämtlicher Vorrat an Biche la mar und Kokosnussöl an Bord verladen. Der letztgenannte Artikel genügte indes in seiner Qualität nicht, weshalb ich mit Hilfe der Godefroy’schen Maschinen das Zerschneiden und Trocknen der Kokosnusskerne, also eine rationelle Bereitung des Copras, selbst ausführen ließ.
Eines Abends bei dieser angestrengten Arbeit beschäftigt, musste ich diese in Folge der bedenklichen Nachricht eines Angestellten , wonach die Yapleute in der Nacht mein Schiff angreifen würden, unterbrechen.
Ich ließ sofort Generalmarsch schlagen, alle Kanonen, Gewehre und Pistolen scharf laden, bewaffnete meine Leute und stand mit bereitgehaltener Lunte während der ganzen Nacht auf Posten, bereit, jeden Augenblick den Kampf aufzunehmen. Schon wollte ich meine Kampfbereitschaft einstellen und meiner Mannschaft die wohlverdiente Nachtruhe gönnen, als plötzlich mehrere Kriegskanus in ziemlicher Entfernung auftauchten. Trotz der Dunkelheit war das geschickte Herannahen derselben immer deutlicher bemerkbar.
Auf meinen strengen Befehl herrschte auf dem Schiffe die größte Ruhe. Niemand wagte, sich zu rühren. So waren die heimtückischen Wilden mit ihren Kanus bis auf annähernd 50 Schritte in gerader Linie herangekommen, als ich die absichtlich zu hoch gerichteten Geschütze abfeuern ließ.
Mit einem wahnsinnigen Geheul sprangen die erschrockenen Eingeborenen über Bord, ließen ihre sämtlichen Kanus im Stich und schwammen eiligst zum nahen, rettungsverheißenden Strande.
Diese recht belustigende Flucht entschädigte uns ein wenig für die gestörte Nachtruhe, aber sie bewies auch, dass man von diesen Insulanern jederzeit Angriffe erwarten durfte, welche, wenn solche nicht im Keime erstickt würden, einen sehr bedenklichen Ausgang nehmen könnten.
Bei Tagesanbruch erschienen einige Eingeborene, sobald sie indes meine Posten sahen, entflohen sie eiligst zur Stadt und verbreiteten dort die Nachricht, dass ich mit deren Bombardierung beginnen wolle. Infolge dieses Gerüchts flüchteten, wie ich später erfuhr, sämtliche Weiber mit ihren Kindern weiter landeinwärts.
Den später doch wieder herbeieilenden Eingeborenen verweigerte ich, obwohl sie sich den Anschein gänzlicher Unwissenheit zu geben versuchten, den Zutritt zum Schiffe. Nun traf sogar der König ein; trotz seiner bemerkbaren Erregung vergingen volle fünf Minuten, bevor er seine Friedens- und Freundschaftsversicherungen zu beteuern begann. Am Schlusse dieser längeren Auseinandersetzung versicherte der König bewegt: „Clow Rupack, mein Freund, man hat Dich getäuscht, keinem meiner Leute ist es in den Sinn gekommen, Dein Schiff zu nehmen, und bevor ich hierzu meine Einwilligung gebe, lasse ich mir lieber meinen Kopf abschlagen.“
„Wenn ich Dir auch volles Vertrauen schenke,“ antwortete ich, um die Eitelkeit des Königs nicht zu verletzen, „so weiß ich doch ganz bestimmt, dass man einen Angriff gegen mich beabsichtigte. Deine Leute werden mich stets zum Kampfe bereit finden, aber ich würde es Deinetwegen bedauern, wenn sie von meinen Kanonen in die Ewigkeit befördert werden müssten. Übrigens bin ich, wie Du auch weißt, als Freund hierher gekommen, besitze die schönsten Geschenke für Dich und werde Dein Volk ohne Veranlassung nicht angreifen; aber ich muss auf meiner Hut sein und kann fortan nur Dir und Deinen Häuptlingen gestatten, mein Schiff zu betreten.“
„Damit hast Du vollkommen Recht. Wir trennen uns also als gute Freunde, Clow Rupack, und nun sage, wie viel Frauen und Mädchen Du als Entschädigung haben willst.“
„Ich wäre kein guter Freund, wenn ich von Dir eine Entschädigung annehmen würde; außerdem bin ich im Begriff, eine längere Reise anzutreten und habe keinen Raum für Dein wertvolles Geschenk.“
Diese rücksichtsvolle Ablehnung erfreute den König ungemein, was zur Befestigung der Freundschaft wesentlich beitrug. Später habe ich durch die dankbare Kierko den Grund des beabsichtigten Überfalls erfahren. Danach geschah es aus Habsucht der Insulaner, um die von ihnen auf den l’Echiquier-Inseln gefischten Perlmutterschalen zu erobern. Schon beim Verlassen des Schiffes waren die Yapleute erbost, als ich ihnen die Mitnahme dieser auf der Insel als Scheidemünze geltenden Perlmutterschalen strengstens untersagte.
Zunächst musste ich nun mit der oft recht gefahrvollen Arbeit beginnen, die auf den verschiedenen Inseln errichteten Stationen zu besuchen und deren Ergebnis an Biche la mar an Bord zu nehmen. Allenthalben erschien ich meinen Leuten als Retter in der Not. Sobald die VESTA die Station verlassen hatte, änderten die Insulaner das mir zugesicherte, friedliche Verhalten, unterbrachen die Arbeit und gingen schließlich, nachdem ihre Überrumpelungsversuche an der Wachsamkeit meiner Leute gescheitert war, zum offenen Kampfe vor, dessen man sich nur mit der größten Anstrengung und unter schweren Verlusten erwehren konnte.
Waren die Wilden besiegt, dann suchten sie den Belagerten die Möglichkeit zu nehmen, sich zu verproviantieren. So hatte ich meine Leute hungernd, teils sogar dem Tode nahe, vorgefunden. Am schlimmsten war es auf der größten der Mackenzie-Inseln, Fallalep, ergangen. Hier hatte jedenfalls mein kleiner Dampfer die Habsucht der Eingeborenen gereizt und alle ihre Schurkenstreiche veranlasst.
Zunächst hatten sie große Feste abgehalten, welche jedoch von den vorsichtigen Weißen nicht besucht wurden; dann hatte die holde Weiblichkeit ihre bestrickenden Verführungskünste eine Zeitlang angewandt, und als auch dieses Manöver erfolglos blieb, hatte der offene Kampf begonnen. Schon der Umstand, dass kein Kanu bei meinem Eintreffen zu bemerken war, bewies die Furcht der abgefeimten Wilden.
Auch die beiden Könige besaßen kein gutes Gewissen; erst nach meiner nachdrücklichen, von einem Kanonenschuss begleiteten Aufforderung kamen sie zitternd an Bord. Dieselben erzählten, dass es nicht in ihrer Macht gelegen habe, das schlechte Benehmen ihrer Leute zu verhüten, dass aber nur einige Yap-Insulaner, die nach meiner Abreise eingetroffen seien, alles verschuldet hätten.
Ich verlangte die Auslieferung der Rädelsführer. Die Könige verkündeten meinen Willen, und sofort begann die allgemeine, leider vergebliche Suche. Die schlauen Yapleute hatten den Braten gerochen und sich eiligst mit ihrem Kanu in Sicherheit gebracht. Da aber, wie die Könige richtig erwarteten, eine Bestrafung eintreten musste, so wurden mir sofort 20 Männer und 10 Weiber zur beliebigen Verwendung überliefert.
So lange wir auf der Insel mit dem Bergen unserer Produkte und Gerätschaften beschäftigt waren, blieben die Gefangenen an Bord. Sie fanden sich willig in ihr Schicksal und erwarteten täglich die Vollstreckung des Todesurteils. Merkwürdigerweise benutzten sie ihre vermeintliche Frist dazu, sich Genüssen, nach ihrer Art höchsten Lebensfreuden, zur ausgelassenen Heiterkeit meiner Leute, unausgesetzt hinzugeben. Beim Anblick dieser eigenartigen Vorstellungen vergaßen meine Leute alle erlittenen Qualen. Selbstverständlich wurden die Gefangenen bei meiner Abfahrt nach Yap straflos entlassen.
Solange der Eingeborene die Macht empfindet, ist er meistens friedlich und fügsam, aber er achtet weder sein Versprechen noch irgend welche Verpflichtung, sobald der Weiße jede Machtmittel verloren hat. Bei scharfer Beobachtung und bestimmtem Auftreten kann sich der Europäer auch dann noch erfolgreich verteidigen; es kommt eben alles darauf an, zur rechten Zeit die erforderliche Energie zu zeigen.
Außer meiner ursprünglichen Besatzung hatte ich noch zehn Eingeborene der Insel Yap, unter denen sich der Sohn des Königs, Prinz Ligeser, befand, an Bord, um den Eingeborenen im Interesse der später weiter auszudehnenden Handelsbeziehungen die kultivierte Hafenstadt Hongkong zu zeigen.
Infolge der Unzuverlässigkeit meiner treulosen Lieferanten blieb meine Ausbeute an Biche la mar, Kokosnussöl und Schildpatt quantitativ hinter meiner Erwartung wesentlich zurück. Trotzdem musste die Ablieferung meiner gesammelten Schätze in Hongkong demnächst erfolgen, wollte ich nicht Gefahr laufen, auch noch Einbuße an der Qualität des bereiteten Biche la mar zu erleiden. Auch die für das Museum Godeffrey präparierten Gegenstände mussten nunmehr nach den Wünschen meines Hamburger Reeders eingeliefert werden. Nach Erledigung der notwendigen Vorkehrungen wurden die Anker gelichtet und die Reise nach China von den Palau-Inseln aus mit aller Beschleunigung angetreten.
Von einem starken Südwestwind begünstigt, bekamen wir schon am nächsten Morgen die Nordspitze der Palau-Gruppe in Sicht und segelten längs des sich dort befindlichen ausgedehnten Riffs. Ich konnte nunmehr mit Gewissheit feststellen, dass das auf den Karten verzeichnete Riff sich nicht 50 bis 60, sondern nur 17 bis 18 Meilen von der äußersten Nordspitze des Landes weiter nördlich ins Meer erstreckt. Außerdem entdeckte ich, dass noch eine sehr gute, 5 Meilen breite Passage unweit der Nordspitze Era Kalongs durch dieses Korallenriff führt. Die Benutzung dieser Passage empfiehlt sich für den Fall, dass die Nordwestspitze wegen etwaigen zu schralen Windes nicht umsegelt werden kann.
Nach dem Passieren der Palau-Inseln erhielten wir leider leichte, westliche Winde, die unseren Kurs wesentlich erschwerten. Das Bemerkenswerteste dieser Tage war das Begegnen eines Kanus, dessen Insassen von einer entfernt liegenden Inselgruppe gekommen waren, um ihren dem Yapkönige schuldenden Tribut auszuliefern.
Die Wilden hatten nicht die geringste Kenntnis, wo sie sich befanden, sie wussten nicht einmal, nach welcher Himmelsrichtung Yap zu erreichen wäre. So waren sie bereits fünf Tage hungernd und durstend auf dem Meere umhergetrieben. Mein Anerbieten, das Kanu ins Schlepptau der VESTA zu nehmen, wurde von den Wilden abgelehnt; ich konnte ihnen daher nur die Richtung andeuten, wo Yap lag, glaube aber kaum, dass sie ihren Bestimmungsort erreicht haben, sondern dass sie entweder dem drohenden Hunger oder den Wellen zum Opfer gefallen sind.
Vom Wetter begünstigt, gelangte ich sehr bald durch die nördlich von den Philippinen-Inseln führende Balintangstraße in das Chinesische Meer hinein. Nach zweitägiger Fahrt wurde die VESTA von einem entsetzlichen Taifun heimgesucht, dem wir nur mit genauer Not ohne Verlust der Masten entkamen. Gegen diesen unerwartet rasch hereinbrechenden , gefahrvollsten aller Stürme, dem viele Schiffe zum Opfer fallen, bietet nur die richtige Berechnung der Richtung und Fortbewegung des Zyklonenzentrums die einzige Möglichkeit einer Rettung.
Der Taifun, ein heftiger Wirbelwind oder Drehsturm, wütet besonders im Indischen Ozean und längs der Süd- und Ostküste von China. Von den alten Ägyptern als ein böser Gott bezeichnet, gilt er den Griechen als ein Ungeheuer. Nach Homer liegt es unter der Erde und wird von Zeus mit Blitzstrahlen niedergeschmettert.
Der Durchmesser eines solchen Sturmkreises schwankt zwischen 200 bis 600 Meilen, er besitzt eine rotierende Bewegung um ein gewisses Zentrum und das ganze Sturmgebiet bewegt sich in einer bestimmten Richtung vorwärts, wie es beispielsweise bei einer Windhose im kleineren Verhältnis geschieht. Während jener fürchterlichen Nacht heulte ein schauriger Wind, mit immer heftiger werdender Gewalt rollten die Wogen gegen die Schiffsplanken der in ihren Fugen krachenden VESTA.
Es war eine Sturmnacht im vollsten Sinne des Wortes. Tief herabhängende Wolken, welche sich fast mit dem vom Sturme gepeitschten Meere vermischten, verhüllten das anbrechende Morgenlicht. Das Auge vermocht dieses unheimliche Halbdunkel nur auf eine geringe Entfernung zu durchdringen, unaufhaltsam zerschellten die Wogen an der Schiffswand, und bis hoch in die Masten jagte der Sturmwind den schäumenden Gischt. Ein tiefer, fast metallisch klingender Ton, der sich vom Sausen und Pfeifen des Segelwerks merklich unterschied, hallte durch die Luft.
Nach einem angestrengten, ungemein aufregenden Manöver erhielt ich die Gewissheit, dass meine Berechnung bezüglich des Zyklonen-Zentrums sich als zuverlässig ergab; der Wind schralte aus Ost, wir befanden uns demnach am Nordrande des Sturmkreises und konnten sogar den gefürchteten Orkan zu einer raschen Fahrt benutzen.
In einer zauberischen Geschwindigkeit raste die VESTA dank des günstig benutzten Sturmes durch die Chinesische See. – Ohne weiteres Ungemach erreichten wir Hongkong.
Sprachlos vor Erstaunen betrachteten meine Yapleute die überwältigenden Wunder der zivilisierten Großstadt. Die große Anzahl der im Hafen liegenden Schiffe, der rege Verkehr einer zahlreichen Bevölkerung, die unabsehbaren Häuserreihen waren auch wohl geeignet, meine Insulaner in Erregung zu setzen.
Es war für mich hochinteressant, den Eindruck zu beobachten, welchen die geringfügigsten zivilisatorischen Einrichtungen auf meine überraschten Wilden machten. In ihrem bewundernden Entzücken gerieten sie aus Rand und Band und begannen sogar, zum Erstaunen der Passanten, in den Straßen ihre Jubeltänze aufzuführen.
Die komischen Fragen der Wilden zu beantworten oder ihren Ideengang zu verfolgen, war geradezu unmöglich. Beim Anblick eines Pferdes, das einen Wagen zog, musste ich alle Autorität aufbieten, um ein furchtbares Geheul zu verhindern. Zeitweilig folgten sie im eiligen Lauf diesem überwältigenden Wunderwerk.
Prinz Ligeser betrachtete am liebsten die vereinzelt bemerkbaren, mit einem Zylinderhut bekleideten englischen Kaufleute, die er trotz meiner genügenden Auseinandersetzung für hervorragende Häuptlinge erklärte. Die Vorliebe des Prinzen für jene schwarzpolierte Angströhre bestimmte mich, ihm ein fragwürdiges Exemplar jener Kopfbedeckung zu verehren.
Hatten die Insulaner bislang schon die Aufmerksamkeit des Publikums in hohem Maße auf sich gelenkt, so war es mir jetzt, da sich der wilde Prinz von der hochgeschätzten Kopfbedeckung nicht trennen wollte, fast unmöglich, meine Yapgesellschaft durch die Straßen zu führen. Der Anblick des nackten Prinzen mit seinem unvermeidlichen, aufs Haupt gequetschten Zylinderhute wirkte überaus drastisch. –
Eines Tages folgte ich mit meinen zur Sehenswürdigkeit gewordenen Eingeborenen von Yap der freundlichen Einladung der Herren Siemssen & Co., damaliger Geschäftsfreunde meiner Reeder. Im Hause jener Herren war eine auserwählte Gesellschaft der in Hongkong weilenden hervorragenden Deutschen und Engländer nebst ihren Damen versammelt.
Gegen Abend wurde ich von dem Hausherrn gebeten, meine Insulaner zu einem Tanze zu veranlassen. Dieselben erklärten sich sofort dazu bereit, um so mehr, da ihnen durch ein lecker bereitetes Mahl schon vorher Gelegenheit gegeben war, den regen Appetit zu befriedigen.
Die in den prachtvoll geschmückten Ballsaal geführten Krieger befanden sich gerade in der fröhlichsten Stimmung, ihren Dank für die freundliche Bewirtung nachdrücklichst abzutanzen. – Unter jubelnder Zustimmung aller Zuschauer, insbesondere der jungen Damenwelt, tanzten meine Wilden mit einer erstaunlichen Hingabe und leidenschaftlicher Erregung, wobei es allerdings recht oft vorkam, dass die nicht an das Parkett gewohnten Tänzer das Gleichgewicht verloren und in urkomischen Stellungen auf den Fußbuden stürzten. –
Im Taumel des Vergnügens begannen die rotbemalten, federgeschmückten Wilden schließlich ihren leidenschaftlichsten Kriegstanz mit Begleitung eines sinnbetäubenden Geheuls so wahr und naturgetreu auszuführen, dass ein immer stärkerer Aufschrei aus den Zuschauerreihen erschallte, und noch vor Beendigung des Tanzes der ganze Damenflor in wilder Flucht, schreiend und lachend, den Ballsaal verließ. – Die dankbaren Insulaner wähnten sich auf ihren einheimischen Tanzplätzen und hatten im gutgemeinten Eifer, nicht achtend der Gegenwart europäischer Damen, ganz ungeniert ihre Lendengürtel abgestreift.
Auch eine photographische Aufnahme von meinen Wilden ließ ich in Hongkong anfertigen und sandte diese dem Museum Godeffroy zur Benutzung. Nach Ablieferung meiner Ladung wurde die VESTA aufs neue ausgerüstet mit Tauschwaren und außerdem mit allerlei für die Kultivierung des Erdreichs erforderlichen Gerätschaften, Baumwollpressen usw. versehen...
Wenngleich das geschäftliche Ergebnis meiner ersten Expedition wenig befriedigte, so musste ich doch auf meinen gefahrvollen Posten wieder zurückkehren, um aufs neue mein Heil zu versuchen. Nach einer langen, mühevollen Fahrt ankerte ich wiederum im Hafen von Korror. Wie immer nach meiner Rückkehr, wurde die VESTA von zahlreichen Eingeborenen umlagert...
Mit frischer Kraft und rastlosem Eifer nahm ich meine geschäftliche Tätigkeit wieder auf. Alle von mir errichteten Stationen wurden abermals besichtigt und mit den zahlreichen Häuptlingen der verschiedenen Inselgruppen neue Verträge abgeschlossen, sowie alle Vorsichtsmaßregeln, wie sie im Verkehr mit den wilden Stämmen durchaus erforderlich sind, gewissenhaft beobachtet. Dieses Mal versprachen meine Anstrengungen von größerem Erfolg gekrönt zu werden. Zwar gab es unendlich viel Schwierigkeiten zu überwinden, hier und dort oft blutige Kämpfe zu bestehen, aber meine Ausbeute, namentlich an Kokosnussöl, mehrte sich so wesentlich, dass ich alle Verdrießlichkeiten frohen Sinnes ertrug.
Um immer mehr Inseln zu erschließen, unternahm ich demnächst die Fahrt nach den Hermit-Inseln. Von unausgesetzten Stürmen heimgesucht, erreichte die VESTA erst nach einer unverhältnismäßig langen Reise ihren Bestimmungsort. Ich ankerte in unmittelbarer Nähe einer kleinen Insel im Nordwesten der dicht mit Kokospalmen bewaldeten Gruppe.
Bald wurde mein Schiff von zahlreichen Kanus der Hermiten umringt, deren Bemannung zu meiner großen Freude allerlei Kostbarkeiten, wie Schweine, Kokosnüsse, Bananen, Tarro, Yams, Brotfrüchte und Papais mit sich führten und zum Tausch feilboten. Für einige Stückchen Bandeisen erhielt ich eine Menge dieser begehrenswerten Gegenstände. Meine Lieferanten waren nach Empfang der Eisenteile so erfreut, dass sie mir ihre Dankbarkeit durch einen mit Händeklatschen begleiteten Tanz, wie ich einen solchen noch nie bei den Eingeborenen der Südsee gesehen, bewiesen.
Unter Benutzung eines scharfen Steines versehen die Hermit-Insulaner ihre Kanus mit recht schönen, geschnitzten Verzierungen. Die Bauart ihrer Fahrzeuge weicht von denen ihrer Nachbarstämme wesentlich ab. Das mit zwei Masten und Segeln ausgerüstete Kanu gewährt für 40 bis 50 Mann genügend Raum und wird von den schifffahrtskundigen Wilden recht geschickt geleitet. Männer und Frauen sind auffallend muskulös entwickelt; ihre dunkelbraune Hautfarbe in Verbindung mit einer scheußlichen Tätowierung verleiht ihnen ein wildes Aussehen. Nicht selten unternehmen die Hermit-Insulaner eine Fahrt nach den l’Echiquier- und Anchoreten-Inseln, aber ihr Besuch dient nur dem Raube von Männern und jungen Frauen.
Diese Mitteilung verdankte ich einigen auf der Insel gefangenen, geistig entwickelten Anchoreten-Insulanern, die sich an Bord der VESTA flüchteten und mich flehentlich um Aufnahme baten. Die Erfüllung ihrer Bitte verursachte nur einen kleinen Streit mit den Hermit-Insulanern. Die entflohenen Männer wollte man mir nach längerer Verhandlung überlassen, nur die zwei schönen Frauen verlangten sie energisch zurück. Einige kleine Geschenke versöhnten jedoch sehr rasch die wilden Weiberfreunde.
Im westlichen Teile der Gruppe stehen die Eingeborenen auf einer noch niedrigeren Kulturstufe. Meiner Absicht, zu landen, widersetzten sich die heulenden, mit Speeren bewaffneten Männer so beharrlich, dass ich erst nach vielen Bemühungen das nächst gelegene größere Dorf betreten konnte. Nur durch die nachdrücklichsten Mittel konnte ich meine Yapleute von dem Kampfe mit den Wilden zurückhalten. War auch der Ausgang desselben mit Sicherheit vorauszusehen, so hätte doch ein gewaltsames Vorgehen jede Annäherung verhindert.
Die Bekleidung der Männer ist die denkbar einfachste; etwas komplizierter und recht eigentümlich ist die der Frauen. Ein kurzes, aus Gras und Blättern verfertigtes Röckchen bedeckt nur teilweise die Vorderseite des Körpers, während hinten ein schmaler, bis zur Erde reichender Schweif getragen wird. Das Haupthaar ist kurz geschoren und die Stirne mit tiefschwarzer Farbe bemalt. Dennoch ist diese eigenartige Toilette gegen die auf den Anchoreten-Inseln übliche als eine wahrhaft luxuriöse zu bezeichnen.
Das Äußere der Anchoreten-Frauen, die ich später sah, erweckt einen unbeschreiblich widerwärtigen Eindruck. Die bereits in der Kindheit abgeschnittenen und nur noch oben und unten festsitzenden äußeren Ohrränder, die durch eingezwängte runde Holzscheiben allmählich mehr ausgedehnt werden und schließlich eine erstaunliche Weite erreichen, sind mit einer Menge kleiner Schildpattringe bekleidet, so dass sie einen fest geschlossenen, bis zur Schulter reichenden Ring bilden; außerdem tragen sie 8 bis 10 Zoll lange, wie Ochsenhörner geformte Schildpattstücke als Zierrat quer durch die mittlere Nasenwand. Einen so unangenehmen Eindruck dieser unheimliche Schmuck auch hervorruft, so erregt doch die Tragfähigkeit des schwer belasteten Riechorgans die Bewunderung des europäischen Beschauers. Das hässliche Aussehen der Weiber wird noch dadurch erhöht, dass die entblößten Oberkörper der meisten Frauen mit zahlreichen, großen Narben bedeckt sind.
Diese sichtbaren Zeichen weiblicher Entschlossenheit erklären sich durch einen eigentümlichen Kampf. Unter den Stämmen der Anchoreten-Insulaner herrscht nämlich die eigenartige Sitte, dass sich heiratsfähige Mädchen ihren Ehegatten tatsächlich mit der Waffe in der Hand erkämpfen müssen. Während es bei allen anderen Südseevölkern gebräuchlich ist, die Tochter vom Vater zu erkaufen, gebietet die Sitte der Anchoreten freie Damenwahl. Sobald die heiratslustige Jungfrau dem Häuptling mitteilt, dass sie dem bezeichneten Manne als Frau angehören will, wird die Anmeldung zur öffentlichen Kenntnis des Dorfes gebracht.
An einem festgesetzten Tage treffen auf einem freien Platze sämtliche Eingeborene zusammen, bilden einen großen Kreis, in dessen Mitte die kampfbereite Braut ihre etwaigen Nebenbuhlerinnen erwartet. Ist ihre Wahl auf einen wenig begehrenswerten Mann gefallen, so wird der Ehebund ohne Kampf in Gegenwart der Versammlung geschlossen. Wird indes von einer Rivalin Einwand erhoben, so tritt sie stillschweigend in die Arena und bekundet durch Emporhalten ihres armlangen Speeres die Bereitwilligkeit zum Kampfe. Die minnesüchtigen Schönen kämpfen um ihren Erkorenen mit einer so andauernden Hartnäckigkeit, dass das Ergebnis des erbitterten Streites meistens erst nach zahlreichen, oft lebensgefährlichen Verwundungen vom Häuptling verkündet werden kann. Sooft eine neue Bewerberin auf dem Plane erscheint, muss die Siegerin ihren Herrenpreis aufs neue verteidigen. Ein furchtbares Geheul des bislang teilnahmslos dreinblickenden Volkes bezeichnet den Schluss des Kampfes. Der erstrittene Mann empfängt aus den Händen seines mutigen Weibes die siegreiche Waffe und bestreicht mit dem Safte einer Wasserpflanze die Wunden seiner jungen Frau, damit deren Narben möglichst stark sichtbar bleiben. – Je zahlreicher die Brust von Kampfeszeichen bedeckt ist, desto größeres Ansehen ist dem Weibe beschieden. Trotz dieser mutvollen Liebesbezeugung erlangt die Frau in ihrer Hütte nicht die geringste Gleichberechtigung, wird vielmehr zum Danke für ihr tapferes Verhalten als Sklavin betrachtet. Warum sie trotzdem ihr Blut für den undankbaren Mann vergießen und Sehnsucht nach dem Ehejoche empfinden, ist mir stets ein psychologisches Rätsel geblieben.
In der Nacht vor meiner Abreise kam ein annähernd 12jähriger Knabe an Bord, der mich flehentlich bat, ihn mit fort zu nehmen. Nach der Erzählung des intelligenten Jungen war er von den Eingeborenen, nachdem sie seinem Vater den Kopf abgeschlagen, von den Anchoreten-Inseln mit fortgeschleppt worden. Der Hilfesuchende wurde freundlich aufgenommen und ihm versichert, dass für sein Fortkommen gesorgt werden solle, wenn er sich treu und fleißig zeigen würde. Zunächst wurde mein Schützling in Anwesenheit aller Europäer feierlich getauft und erhielt zum Andenken an die Hermit-Inseln und an die Brigg VESTA den Namen Hermann Vesta. Viel Freude hat mir aber mein Täufling nicht gemacht; sobald ich die nächsten Inseln erreicht hatte, war Hermann Vesta auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Wahrscheinlich hatte dem kleinen Wilden das geordnete Leben auf dem Schiffe nicht gefallen, aber jedenfalls war er den brutalen Hermiten entkommen.
Beim Anlaufen der Hauptinsel der Hermit-Gruppe war es mir unmöglich, den drohenden Kampf mit den Eingeborenen zu vermeiden. Jeder Versuch, die Wilden von unserer Friedfertigkeit zu überzeugen, blieb erfolglos. Schließlich bemannte ich meine drei Boote und landete trotz des wütenden Geheuls der speerschwingenden Insulaner. Nach meinem bisherigen, stets erfolgreichen Verfahren schritt ich allein vorauf und zeigte meinen etwas beruhigten Gegnern die beliebtesten europäischen Geschenke. Kaum war ich jedoch in ihre Nähe gekommen, da schwirrten mir zahlreiche Speere entgegen; plötzlich fühlte ich einen stechenden Schmerz im rechten Oberschenkel, aber meine Lage war zu kritisch, um darauf achten zu dürfen. Sobald ich meinen Revolver abgefeuert, um mich der nächsten daherstürmenden Wilden zu erwehren, eilten meine Leute herbei und es entspann sich vor meinen Augen ein regelrechter Kampf. Obgleich die Insulaner uns wohl zwanzigfach überlegen waren, wurden sie doch trotzt verzweifelter Gegenwehr zurückgeschlagen und ihre Stadt erstürmt.
Während des Kampfes hatten sich die älteren Männer und sämtliche Frauen und Kinder in große Kanus geflüchtet und suchten eine der befreundeten Nachbarinseln zu erreichen. Von meinen Leuten waren neun leicht und drei schwer verwundet. Als einer der Mutigsten und Gewandtesten hatte sich ein Malaie gezeigt. Mit einer erstaunlichen Geschicklichkeit fing er die gegen ihn geschleuderten Speere auf und warf sie im selben Augenblick wieder zurück, ohne sein Ziel zu verfehlen. Trotz mehrfacher Verwundungen kämpfte der Malaie bis zum Ende des Treffens mit dem Mute eines Löwen und der Gewandtheit eines Tigers.
Selbst die mutigen, auf ihre Tapferkeit sehr stolzen Yapleute konnten ihr Erstaunen nicht verhehlen, als sie das ihnen unbekannte Auffangen der Speere bemerkten. Nach Beendigung des Kampfes musste ich meine ganze Autorität über die blutdürstigen Yapleute aufbieten, um das Töten der Verwundeten und Gefangenen zu verhüten. Die Freude am Siege ging für die Leute verloren, da es ihnen nicht gestattet war, die Köpfe ihrer erlegten Feinde mitzuführen. Der Sohn des Königs von Rul, Prinz Runningebay, der zu meiner Begleitung auf dieser Reise von seinem Vater auserwählt war und den ich natürlich standesgemäß an Bord bewirtete und zuvorkommend behandelte, meinte ebenfalls missgestimmt: „Wenn Du meinen Leuten nicht mal die Köpfe ihrer Opfer überlässt, dann hat der Kampf für uns keinen Wert; erfülle den Wunsch meines Volkes, sonst werden sie ferner für Dich nicht kämpfen.“ - „Wehrlose zu töten, verbietet mein Gott.“ - „Hast Du denn keinen Gott, der die Köpfe Deiner Feinde verlangt?“ – „Nein, Prinz, einen solchen Gott gibt es nicht.“ Der Prinz schwieg; aus seinen Blicken sprach ein lebhaftes Bedauern, weil nach seiner Meinung das Recht der Yapleute verkümmert war. Mein zivilisatorischer Einfluss auf den Prinzen hatte danach keine allzu tiefe Wurzel geschlagen.
Bei diesem Treffen wurden mancherlei interessante Gegenstände, namentlich verschiedene Speere der Eingeborenen erbeutet, die ich für das Museum bestimmte. Als Siegespreis erreichten wir endlich das lang entbehrte, frische Trinkwasser, dessen Verweigerung die Ursache des Zusammenstoßes gebildet hatte, und das nunmehr von meinen durstigen Leuten geschöpft werden konnte. Sobald meine Speerwunde mit kühlem Wasser gereinigt und von einem Malaien kunstgerecht verbunden war, konnte ich meine Wanderung antreten und dabei die charakteristischen Merkmale der überwältigten Insulaner zum Teil beobachten und erkunden.
Die Eingeborenen dieser Gruppe verbrennen ihre Toten. Nur der Schädel wird sorgsam geschützt und, nachdem er mit Erde und Blumenpflanzen ausgefüllt ist, zum Andenken an den Stamm eines dicken Baumes befestigt. Am Tage wird der unheimliche Anblick dieser Totenkopfsammlung durch die blühenden Pflanzen wesentlich gemildert, allein zur Nachtzeit, wenn das fahle Mondlicht die gebleichten Schädel trifft, erzeugen die Erinnerungszeichen der Wilden einen schaurigen Eindruck. Die Unterkinnladen dieser Köpfe werden an einer Schnur befestigt und entweder auf der Brust der Insulaner getragen oder vor dem Eingange ihrer Hütten aufbewahrt.
Meine teilweise aus Malaien bestehende Mannschaft fand hier Gelegenheit, einige Haifische zu fangen und deren Fleisch mit großem Appetit zu verspeisen. Den armen Leuten war diese langentbehrte Fleischnahrung, da ihre Religion ihnen den Genuss des Schweinefleisches strengstens verbietet, wohl zu gönnen. Nur schwer trennten sich die ihren Satzungen treu bleibenden Männer von der Insel, die ihnen die größten Leckerbissen gewähren konnte.
Weit friedfertiger als diese besiegten Insulaner zeigten sich die Eingeborenen der auf meiner Rückreise berührten Uliei-Inseln; die schönen, muskulösen Männer sind am ganzen Körper sehr geschmackvoll tätowiert. Ohren und Hals sind mit vielen Verzierungen versehen und in dem wolligen Kopfhaar prangt ein Büschel emporstrebender Federn. Unter den jungen Frauen und Mädchen erblickt man viele, deren hervorragende Schönheit leider durch die auf der Brust tätowierten hässlichen Figuren, meist Fisch- und Vogelköpfe, wesentlich beeinträchtigt wird.
Ich erhielt den Besuch des verhältnismäßig sehr gesitteten und intelligenten Königs Jogelock, der eine besondere Teilnahme für mein Schiff und sonstiges Eigentum bekundete und sich überhaupt sehr manierlich benahm. Die in seiner Begleitung befindlichen Frauen zeigten freilich eine belästigende Neugierde. Die Erwähnung dieser Uliei-Insulaner dürfte schon deshalb berechtigt sein, weil sie als die besten Schifffahrtskundigen der Karolineninseln bezeichnet werden dürfen. Sie unternehmen mit ihren Kanus für dortige Verhältnisse sehr weite Reisen, auf denen sie sogar die Mariannen-Inseln berühren; dabei dienen ihnen nur die Sterne als Richtschnur, und trotzdem wissen sie jederzeit sehr genau, auf welchem Punkt sie sich befinden. Das Süßwasser auf der Ulici-Insel ist ungenießbar; die Eingeborenen nehmen daher ihre Zuflucht zur Milch der jungen Kokosnuss oder trinken den aus den Kokosnusspalmengewonnenen Extrakt, den sogenannten Toddy. In Tracht und Sitten von den Eingeborenen der Mackenzie-Inseln nicht abweichend, gewähren ihre reinlichen, höchst sinnreich erbauten Häuser einen sehr freundlichen Anblick, wie überhaupt der ganze Stamm am geeignetsten erscheint, die europäische Kultur in der Südsee zu fördern. Die meisten Völker der Karolineninseln sind vollkommen entartet und werden in nicht zu ferner Zeit der immer mehr vorwärtsdringenden Kultur weichen müssen.
Eingangs des Hafens von Rul verließ ich die VESTA und unternahm eine Bootsfahrt nach Tomil. Nach längerem Aufenthalt diesen Ort wieder verlassend, erhielt ich bei meiner Ankunft in Rul einen besonders glänzenden Empfang. Der König an der Spitze seiner Häuptlinge bat mich, dem mir zu Ehren gegebenen Feste beizuwohnen. Nachdem man mich reichlich beschenkt, wurde ich auf eine kleine Anhöhe geführt, an deren Fuße hundert Mädchen einen Tanz, der sich von den früher geschilderten nur wenig unterschied, aufführten. Entgegen der früher bemerkten Gewohnheit wurde die Aufmerksamkeit der Zuschauer durch meine Anwesenheit wesentlich beeinträchtigt. Ich vertrat hier entschieden die Rolle eines Schaustückes, das man unausgesetzt begaffte; dennoch hielt ich standhaft aus, um das eigenartige Vergnügen meiner Verehrer nicht zu stören.
Sobald der Tanz zu meiner Freude beendet und eine feierliche Stille eingetreten war, erhob sich der König und begann eine friedliche Ansprache, in welcher er die Freundschaft seines ganzen Volkes zu mir hervorhob und mit überschwänglichen Worten die Freude über unser unerwartetes Wiedersehen zum Ausdruck brachte. Ich dankte dem König und seinem Volke verbindlichst, ohne eigentlich zu wissen, was jene Versicherung bedeutete und war recht froh, als der König den Schluss des Festes verkündete und an der Spitze seiner Getreuen an mir vorüberzog.
Erst nachdem der letzte Festgenosse verschwunden war, erhielt ich von meinen Leuten die langersehnte Aufklärung dieser sonderbaren Auszeichnung.
„Es war hier das Gerücht verbreitet,“ berichtete der Steuermann noch erregt, „dass man Sie bei Ihrer Bootfahrt nach Tomil ermordet habe. Eine große Aufregung hatte sich unserer bemächtigt. Sämtliche Eingeborenen von Rul griffen zu den Waffen und beschlossen, sofort erstgenannte Stadt zu stürmen und in Brand zu setzen, um Ihren vermeintlichen Tod zu rächen. Auch die Palau-Insulaner gerieten in Wut und waren kaum noch zu zügeln, so dass ich das Schlimmste befürchten musste. Gott sei Dank, dass Sie noch rechtzeitig eintrafen.“
Nun war mir sowohl die Freude des Königs, wie auch die Erregung meines Steuermannes vollkommen klar. Ganz gewiss war die Situation für meine Schiffsmannschaft recht bedenklich gewesen. Jedenfalls hätte der beabsichtigte Angriff den Verlust meines Schiffes herbeiführen können, um so mehr, als die Wilden, sobald sie einmal in Aufregung geraten, sehr schwer zu beherrschen sind.
Wenige Tage nach diesem Vorfall warfen wir Anker im Hafen der Hauptstadt Korror...
Ich traf die notwendigen Verfügungen, sämtliche Vorräte an Biche la mar, Schildpatt und Korallen ins Schiff zu befördern und die programmmäßige Reise nach Hongkong abermals anzutreten.
Mit Ausnahme weniger Tage wurde unsere Fahrt von guten Winden und schönstem Wetter begünstigt, so dass die VESTA schon am sechzehnten Tage nach ihrem Auslaufen den Hafen von Hongkong erreichte... Da sich ... meine Erwartungen bezüglich der geschäftlichen Ausbeute erfüllten, so durfte ich mit dem Ausgange dieser zweiten Expedition vollkommen zufrieden sein.
Zum dritten Male wandte sich die VESTA nach den bekannten Gewässern des Pazifischen Ozeans. Mit frohem Mut wurden die letzten Vorbereitungen getroffen; ich ahnte ja nicht, dass ich die letzte meiner selbständigen Fahrten antrat. Galt es doch, noch neue, weitreichende Pläne, deren Gelingen einen großen zivilisatorischen Fortschritt auf den Karolineninseln herbeiführen mussten, auszuführen.
In erster Reihe sollte die Anlage großer Baumwollplantagen erfolgen. Zu diesem Zwecke nahm ich 50 Chinesen nebst allen für Baumwollplantagen erforderlichen Gerätschaften an Bord. Anfänglich beabsichtigte ich, durch die San Bernardino-Straße zu segeln, als ich aber der Küste schon ziemlich nahe gekommen, zwangen mich widrige Winde, wieder nordwärts zu halten und um die Nordküste von Luzon zu segeln. Nach einer sehr langwierigen, mit vielen Windstillen verbundenen Reise, erreichten wir endlich die Palau-Inseln.
Während die ganze Fahrt bei normalem Wetter in höchstens 18 Tagen zurückgelegt werden kann, wurden wir fast zwei Monate von einem die Geduld des Seemannes erschöpfenden Gegenschlag heimgesucht. Ganz abgesehen davon, dass meine lange Abwesenheit die Freundschaft mit meinen Insulanern erfahrungsgemäß sehr beeinträchtigte, hatte ich meine liebe Not, den Hunger meiner 50 chinesischen Arbeiter zu stillen. Sobald wir im Hafen von Malaccan Anker warfen und von den Eingeborenen allerlei Lebensmittel empfingen, war wenigstens die größte Sorge beseitigt.
Am nächsten Tage besuchte ich den König von Korror, um mit ihm und seinen Häuptlingen die zur Anlage größerer Baumwollplantagen erforderlichen Bestimmungen zu treffen. Der König war über meinen Besuch sehr erfreut... und erfüllte bereitwillig alle meine Wünsche. Nur die rechtsgültige Erwerbung der mir für meine Baumwollplantagen überwiesenen Landstriche wollte er unter keinen Umständen zugestehen...
Dennoch würde es mir nach einem gewissen Zeitraum ohne Zweifel gelungen sein, jenes wertvolle Land rechtsverbindlich zu erwerben, wenn mich nicht ein trauriges Schicksal daran verhindert hätte. –
Bald waren meine Chinesen in voller Tätigkeit, das mir überlassene Land zu kultivieren; eiligst wurden Wohnhäuser und Räume für die Baumwollpressen und Reinigungsmaschinen erbaut. Von der Fruchtbarkeit des Bodens konnte ich mich schon nach drei Tagen zu meiner großen Freude hinreichend überzeugen. Die zur Ernährung der Chinesen bestimmten Gemüse, wie auch die wertvollen Baumwollpflanzen ragten bereits zolllang aus der Erde. Der Anblick dieser, der Wildnis entrissenen, saatbedeckten Felder erfüllte mich mit großer Befriedigung und berechtigter Hoffnung. Dennoch durfte ich meine vorläufige Hauptaufgabe, den Handel mit den verschiedenen Inselgruppen zu unterhalten, nicht vernachlässigen. Sobald ich daher mit den Korror-Leuten Kontrakte zur Lieferung der notwendigsten Lebensmittel für meine Chinesen geschlossen und dem mich vertretenden Steuermann gemessene Instruktionen erteilt, begann ich meine gewöhnlichen Reisen nach den entfernt liegenden, mir schon bekannten Inselgruppen.
Oft mit großer Zuvorkommenheit und Freundschaft auf einer Insel empfangen, dann wieder gewaltsam am Landen verhindert, so wechselte es bei dem Besuch der zahllosen Stämme fast täglich...
...Nach einer monatelangen Fahrt kehrte die VESTA in die heimischen Gewässer der Insel Yap zurück. Aber welch entsetzliche Überraschung wurde mir beim Eintreffen geboten! Auf der ganzen Insel herrschte eine ungeheure Aufregung, die kampfeslustigen Eingeborenen befanden sich im Kriege mit ihren Nachbarn. Wohin mein Auge blickte, überall waren die Spuren eines erbitterten Kampfes bemerkbar, Häuser lagen in Trümmern, verstümmelte Leichen füllten die Straßen, Weiber und Kinder rannten heulend umher; die herrliche Landschaft war verwüstet, auf Jahre ihres Baumschmuckes beraubt.
Unter solchen Verhältnissen war natürlich an eine geschäftliche Ausbeute nicht zu denken, ich beschloss daher, um einer gefahrdrohenden Verwicklung zu entgehen, einen Ausflug zu dem mir befreundeten, am südlichen Teil der Insel Yap wohnenden Stamme, welcher von dem intelligenten Könige Fonneway beherrscht wird, zu unternehmen. Da ich bei solchen Streifzügen genötigt war, verschiedene Küstenstrecken mir feindlich gesinnter Stämme zu passieren, so beobachtete ich stets die überaus notwendige Vorsicht, eine genügende Anzahl Waffen im Boote mitzuführen, wobei ich jedoch darauf bedacht blieb, dass dieselben zur Vermeidung von Unglücksfällen sowie auch, um das Misstrauen befreundeter Insulaner nicht zu erregen, stets unter meinem Sitze im Boote gelagert wurden.
Ich hatte meine Handelsangelegenheiten in der mir befreundeten Stadt Krurr beendet und befand mich bereits auf der Rückkehr zum Schiffe unter Segel, als ich bemerkte, dass mein mit 10 Spitzkugeln geladener Spencers-Rifle von einem meiner Leute schräge gegen meine Ruderbank , mit der Mündung gegen mich gerichtet, hingestellt war, und dass der Kolben des Gewehrs am Boden des Bootes im Wasser stand. Vorsichtigerweise wollte ich die gefahrdrohende Richtung des Laufes verändern und das Gewehr wieder auf seinen ursprünglichen sicheren Platz legen, als es sich plötzlich mit lautem Knall entlud. Wahrscheinlich hatte sich der Hahn der Büchse zwischen die im Boote lagernden, grünen Kokosnüsse festgeklemmt und so die Entladung bewirkt. Das Geschoss hatte meine Hand gestreift und war dann in gerader Richtung in meinen Oberschenkel eingeschlagen.
Wohl fühlte ich eine heftige Erschütterung, eine unerklärliche Erregung, aber ich konnte trotzdem nicht glauben, dass ich verwundet sei. Neugierig bog ich mich zur Seite, um die Stelle im Boote zu entdecken, wo die Kugel nach meiner Annahme hätte hindurchfliegen müssen. Bei dieser Wendung fühlte ich einen entsetzlichen Schmerz, der mir die Gewissheit gab, dass ich verwundet sei und die Kugel im Beine sitze. Mit aller Anstrengung versuchte ich mich emporzuheben, brach aber im selbigen Augenblick besinnungslos zusammen. Zuweilen kehrte das Bewusstsein zurück. Dann trat das Bild meiner Mutter deutlich vor meine Seele, auf meinen Lippen erstarb die Frage: „Werde ich sie wiedersehen?“ – Die Gewehrkugel hatte nicht nur den Schenkelknochen zerschmettert, sondern auch die Hauptsehnen und Nerven zerrissen, wie leblos hing das Bein am Körper. Was sollte ich nun in meinem trostlosen Zustande beginnen? Bis zum Schiffe gegen den Wind zu kreuzen, hätte eine allzu lange Zeit erfordert; ich entschloss mich daher, nach der Stadt Krurr, von wo ich vor einer Stunde abgesegelt, vor dem Winde zurückzukehren.
Hier wohnte seit vielen Jahren ein früherer Matrose eines Walfischfängers, der einzige Europäer, von dem ich Hilfe erwarten durfte. Während ich allein im Boot lag, eilte mein Begleiter, Prinz Ligefer, in den Ort, um dem mir bekannten Engländer von meiner Verwundung zu berichten. In Begleitung des herbeieilenden Matrosen befanden sich wohl zwanzig Eingeborene, die mir in der teilnehmendsten Weise jede Hilfeleistung zusagten. Bald war eine aus Bambusstäben verfertigte Tragbare herbeigeschafft, auf welche ich unter unsäglichen Schmerzen gehoben und dann so sorgsam wie irgend möglich in einem dem Könige Fonneway gehörige Hütte getragen wurde. Am Fußboden auf einer Matte hingestreckt, konnte ich durch Betasten den Punkt bestimmen, wo die Bleikugel festsaß. Nur eine einzige Möglichkeit war geblieben, um die Verschlimmerung der Wunde zu verhüten, sowie auch die heißersehnte Heilung zu ermöglichen. Das war die Entfernung der Kugel. Auf meinen dringenden Wunsch entschloss sich der Engländer zu der notwendigen Operation. – Während mich sechs Eingeborene festhielten, um stets die notwendige Lage innezuhalten, schnitt der Engländer mit einem gewöhnlichen, nicht gerade sehr scharfen Taschenmesser an der meiner Schusswunde entgegengesetzten Seite des Oberschenkels, wo ich im Fleische den Sitz der Kugel bestimmen konnte, ein tiefes Loch, bis die Messerspitze das unheilvolle Geschoss berührte. In wahnsinnigem Schmerze presste ich die Lippen krampfhaft zusammen; allein die entsetzliche Qual war kaum zu ertragen, als jetzt das Messer seitwärts gedrückt, mehrere Male von der Kugel abglitt, und endlich mit vieler Mühe leider nur ein Drittteil des Geschosses quer durch die Wunde herausgezwängt wurde. Dreimal fuhr das Messer bis zum Heft in die stetig vergrößerte Wunde; kalter Schweiß rann von meiner Stirn, meine Lippen bluteten, dennoch bat ich meinen zaghaft gewordenen Helfer, noch einmal zu versuchen, den noch zurückgebliebenen Teil der Kugel herauszuziehen. Jeder Versuch war vergeblich, das letzte Stück Blei saß zu tief in der Wunde, um mit Hilfe eines gewöhnlichen Taschenmessers entfernt werden zu können. Erschöpft sank ich auf mein Lager zurück. Nach Möglichkeit wurde das verwundete Bein gerade gestreckt, mit mehreren aus gespaltenem Bambusrohr verfertigten Schienen versehen und, soweit das Verständnis meines Engländers reichte, in die ursprüngliche Lage gebracht, das Blut gestillt und fortwährend kalte Wasserumschläge zur Verhütung der gefahrvollen Entzündung angewandt.
Ich musste mich in mein Schicksal finden und meinem Steuermann die Führung des Schiffes anvertrauen, damit die eingeleiteten Geschäfte rechtzeitig erledigt und die Verbindung mit den befreundeten Eingeborenen aufrechterhalten blieb. Noch ahnte ich ja nicht den traurigen Ausgang meiner Verwundung. Mit Eintritt des Wundfiebers wurde der Schmerz unerträglich. Während der Dauer von 22 Tagen hatte ich nicht die geringste feste Nahrung zu mir genommen und in 42 Tagen und Nächten in Folge der entsetzlichen Schmerzen kaum die Augen geschlossen. So unglaublich diese Mitteilung dem Leser auch erscheinen mag, so entspricht sie doch den wirklichen Tatsachen. Noch heute nach Verlauf vieler Jahre überläuft mich ein eisiger Schauer, wenn ich an diese grauenvollste Zeit meines Lebens denke. Einem Skelette gleich, unfähig, ein Glied zu rühren, so lag ich auf dem entsetzlichen Lager. Nicht einmal die lästigen Insekten vermochte ich von meiner brandigen Wunde zu entfernen. Noch weit größere Qualen sollte ich erdulden. Der zwischen den Wilden der Insel entbrannte Vernichtungskrieg wurde in mein Dorf getragen. Sämtliche Eingeborene waren plötzlich verschwunden, um den geschlagenen Feind zu verfolgen. Nun war ich hilflos und verlassen in der armseligen Hütte. Volle vier Monate habe ich dieses grauenvolle Elend erduldet; nur selten kehrte mein Pfleger zurück, um mir frisches Wasser zu reichen und die Wunde von Ameisen und sonstigem Getier zu reinigen. Meine Lebenskraft schien erschöpft. Das leiseste Geräusch, das Zwitschern eines Vogels machte mich rasend, ich wollte schreien, aber kein Ton kam über meine Lippen. Nicht mehr der geringsten Bewegung fähig, flehte ich zu Gott um Erlösung. Aber ich musste den Kelch des Leidens bis zur Neige leeren. Bei gänzlicher Vernachlässigung der Wunde stellten sich in diesem tropischen Klima die unvermeidlichen Folgen ein und es galt die letzte Willenskraft aufzubieten, um nicht dem Wahnsinn anheim zu fallen, dessen Zerrbilder mein Schmerzenslager umgaben. In dieser Hütte habe ich erfahren, welche Qualen ein Mensch erdulden kann.
Oft drang das wütende Kampfgeheul der Wilden an mein Ohr. Mit abwechselndem Glück schwankte der Sieg zwischen den Kämpfenden hin und her. Die Eingeborenen meines Dorfes kamen immer von ihren Streifzügen mit den getöteten Gegnern zurück. Das lange Kopfhaar der Toten um die Hände der Wilden geschlungen, so wurden die entseelten Körper vor meinen Blicken vorübergeschleift. Mit diesem grausamen Schauspiel war es nicht genug, auch die Siegestänze wurden in der Nähe meiner Hütte vollführt.
Dann wieder stürmten die rachsüchtigen Feinde das Dorf und schlugen die Verteidiger in die Flucht, töteten, was sie an lebenden Geschöpfen fanden und steckten die Hütten in Brand. Das dämonische Wutgeheul der Krieger verwirrte fast meine Sinne. Von Speeren durchbohrte Körper, verstümmelte Leichen der Erschlagenen wurden von den grausamen Siegern unter dem Geheul ihrer Siegeslieder vor meinen Augen herumgezerrt. – So rätselhaft es auch scheinen mag, ich hegte in solchem Augenblick das sehnsüchtige Verlangen, die mordenden Wilden möchten mich hier finden und meinem Leiden ein Ende machen. Das Schicksal hat es nicht gewollt. Die Sieger zogen fort, allein die von ihnen entzündeten Hütten bereiteten mir eine neue Gefahr. Ein ungünstiger Wind trieb die verheerende Flamme nach der Richtung meiner Wohnung. Schon sah ich den rötlichen Schein in meiner Nähe leuchten, qualmender Rauch drang durch die Öffnung meiner Hütte; immer höher loderte die Flamme empor. Heißer wurde die Luft, schon hörte ich das Knistern im Dache des Nebenhauses, sah, wie die züngelnde Flamme die trockenen Bambusstäbe der gegenüberliegenden Hütte erreichte – aber es war mir nicht möglich, mein flammenbedrohtes Lager zu verlassen. Mit jedem Augenblick vergrößerte sich die Gefahr, von den Flammen ergriffen zu werden.
Gott erhörte mein heißes Flehen und bewahrte mich vor dem entsetzlichen Feuertode; plötzlich drehte der Wind und trieb die Flammen nach der entgegengesetzten Richtung. In dieser fürchterlichen Nacht kehrten die mir befreundeten Eingeborenen zurück und löschten das Feuer, der Kampf war endlich beende. Andauernde Pflege belebte aufs Neue meine zerstörte Hoffnung, Vertrauen und Zuversicht zog wieder durch meine Seele. Endlich stellte sich auch die Esslust wieder ein. Meine Speisen bestanden aus jungen Kokosnüssen und Arrowroot; nach weiteren acht Tagen erhielt ich junge Hühner und Kartoffeln, ganz allmählich kehrten meine Kräfte zurück. Bald traf auch die VESTA von ihrem Ausfluge wieder ein; allein meine Wunde befand sich noch in einem so gefahrvollen Zustande, dass meine Überführung zum Schiffe unmöglich war. Mein Steuermann erhielt daher die Weisung, inzwischen nach den Hermit- und l’Echiquier-Inseln zu segeln, um die üblichen Produkte einzutauschen und die dort gelassenen Agenten und Subagenten zurückzuholen. In Folge der dort herrschenden Kriege war der Verkehr sehr erschwert, und da die Eingeborenen deshalb gezwungen waren, ihre Arbeit einzustellen, so war die geschäftliche Ausbeute sehr gering.
Zu diesem Misserfolg gesellte sich noch ein neues Unglück. Bei ihrer Heimfahrt war die VESTA auf ein Riff geraten, nur mit genauer Not wieder abgekommen und lag nun, unfähig weiter zu segeln, leck vor Anker. War es noch nicht genug der Qualen? Nun litt es mich nicht länger auf meinem Lager, meine ganze Kraft galt der Sicherheit des Schiffes. Mit Hilfe meines Zimmermanns wurde ein Floß errichtet, das mich, von 20 Eingeborenen gerudert, zur VESTA brachte. Nach tagelanger Mühe gelang es, die Brigg notdürftig zu kalfatern. Zur Ermöglichung meiner Mitreise wurde eine Plattform auf Deck errichtet; außerdem umschloss ein Bretterkasten mein verwundetes Bein, um die durch das Rollen des Schiffes verursachte heftige Bewegung nach Möglichkeit zu mildern.
Beim Verlassen der Insel waren fast alle Eingeborenen, in deren Mitte ich die entsetzlichste Zeit meines Lebens verbracht, tief bewegt. Mein Pfleger wie auch die nächsten Bekannten vergossen Tränen, als ich ihnen die Hand zum Abschied reichte. Eiligst verließ ich die Insel, um Hongkong so rasch wie möglich zu erreichen. Das Leck des Schiffes machte sich immer bedrohlicher bemerkbar, unausgesetzt war die Mannschaft bei den Pumpen beschäftigt. Trotz dieser gefahrvollen Situation wollte ich die Karolinengruppe nicht verlassen, ohne noch einmal die Palau-Inseln zu berühren und mich von dem Stande meiner Baumwollpflanzungen zu überzeugen. Dieser langersehnte Anblick war mir nicht beschieden. In meinem trostlosen Zustand war es mir unmöglich, das Schiff zu verlassen, ich musste mich deshalb mit dem Bericht meines Untersteuermanns begnügen.
Dem teilmannsvollen Seemanne standen die Tränen in den Augen, als er die traurige Lage seines Kapitäns erkannte. Gewaltsam seine Erregung bekämpfend, begann der Steuermann: „Es geht alles nach Wunsch, Herr Kapitän, die Baumwollplantage gedeiht vorzüglich; an einer Anzahl der von den Chinesen gepflanzten Bäume zeigen sich schon aufspringende Kapseln der Baumwolle, die Bäume selbst haben schon einen beträchtlichen Umfang und bilden bereits einen kleinen, schattenspendenden Wald. Allein die Chinesen haben sich während Ihrer Abwesenheit sehr schlecht betragen, sie haben die Eingeborenen bestohlen und betrogen, jede ihnen zugewiesene Arbeit verweigert und mehrere Male Mordversuche gegen mich und meine Leute geplant; es hat mir viele Mühe verursacht, dem König und seinen Häuptlingen vom offenen Kampfe gegen die Chinesen abzuraten.“
Eine Stunde später kam auch König Abba Thule mit seinem Gefolge an Bord, wiederholte die berechtigten Klagen und bat, seine Insel von den Chinesen zu befreien.
„Da Du uns leider verlassen musst, Clow Rupack,“ schloss der König bittend, „so wirst Du uns von diesen schlechten Menschen gewiss befreien. Erfülle unsere gerechte Bitte, und mein Volk wird die gewünschte Arbeit in Deinen Baumwollplantagen gerne ausführen; jetzt, wo Deine Pflanzen eine reiche Ernte versprechen, erkennen wir wieder Deine erfahrene Umsicht und Teilnahme für unsere Insel.“
Unter diesen Umständen blieb mir kein anderer Ausweg, als sämtliche Chinesen sofort an Bord zu nehmen und nach Hongkong zurückzuführen.
Der König und alle Eingeborenen erwiesen sich für diese notwendige Verfügung sehr dankbar; auch die chinesischen Arbeiter freuten sich, ihre Heimat bald wieder zu erreichen.
Nachdem ich dem Könige noch einmal die Pflege der Baumwollpflanzungen dringend empfohlen, zur Anleitung und Beaufsichtigung derselben einige der Erfahrensten meiner Leute auf den Palauinseln zurückgelassen hatte, wurden die Anker gelichtet und die Reise nach Hongkong fortgesetzt.
Der Abschied von diesen Inseln wurde mir schwer. Mit froher Hoffnung und bester Zuversicht war ich einst hier eingezogen, eine schwere, schicksalsreiche Zeit lag hinter mir. Keine Gefahr scheuend, hatte ich jahrelang in harter Arbeit gerungen, und jetzt, wo der Lohn meiner Anstrengung fast greifbar ward, das lang ersehnte Ziel erreicht schien, war meine Hoffnung vernichtet. Schwer verwundet, bedrückt von namenloser Sorge um meine Zukunft blickte ich wehmütig zum fernen, immer mehr zurücktretenden Gestade. Auf dem Halbdeck liegend, kommandierte ich mein Schiff während seiner Reise nach Hongkong. Stundenlang beschäftigten mich trübe Gedanken, wenn aber die Nacht heraufzog, Myriaden Sterne am unermesslichen Himmelsdome in blendender Helle strahlten, da wurde es ruhig in meiner Brust, der Glaube an Gottes unerforschlichen Willen gab mir die Kraft, dem unbekannten Schicksal mit Zuversicht entgegenzuziehen. –
Nach der Ankunft in Hongkong wurde sofort eine Konsultation von fünf Ärzten abgehalten, deren Ergebnis war, dass eine endgültige Entscheidung darüber, ob das Bein amputiert werden müsse oder nicht, zur Zeit nicht abgegeben werden könne; man verwies mich nach Paris an den Doktor Nelaton.
Sobald ich meine geschäftlichen Verpflichtungen erledigt, die reparaturbedürftige VESTA meinem Obersteuermann überantwortet hatte, erhielt ich im Hause einer mir bekannten Familie eine so überaus sorgsame Pflege, dass ich schon nach sechswöchentlichem Aufenthalt, obwohl noch sehr schwach und kümmerlich, doch mittelst zweier Krücken mich allein langsam fortbewegen konnte. Bei dieser Gewissheit litt es mich nicht länger im Hause jener hochherzigen Menschen, denen ich an dieser Stelle noch einmal meinen wärmsten Dank abstatte; gewaltsam unterdrückte ich die namenlosen Schmerzen und ließ mich an Bord des französischen Postdampfers „L’IMPÉRATRICE“ befördern. Nicht nur der Kapitän und alle Offiziere, auch viele Passagiere jenes Schiffes erwiesen mir in meiner hilflosen Lage so viele liebenswürdige Aufmerksamkeiten und Erleichterungen, dass ich die Anstrengungen der Reise verhältnismäßig glücklich überwinden konnte.
Nach achtundzwanzigtägiger Fahrt wurde Suez erreicht. Ungeachtet der mit einer Eisenbahnfahrt durch die Wüste verbundenen erhöhten Anstrengung beschloss ich, die Städte Kairo und Alexandrien mit all ihren Sehenswürdigkeiten in Augenschein zu nehmen. Die mir dort gebotenen, interessanten Eindrücke entschädigten mich für meine ertragenen Strapazen.
Kurze Zeit später landete ich in Marseille. Meine überschätzte Kraft war jetzt erschöpft, die Fortsetzung der Reise war nach Ausspruch des zu Rate gezogenen Arztes nur dann möglich, wenn ich mich einer mehrtägigen Ruhe hingeben würde. Mit schwerem Herzen musste ich in diese unabweisbare Verzögerung willigen. Nach wenigen Tagen raffte ich mich gewaltsam auf, ließ mich ins Eisenbahncoupé tragen und brach hier, zum ersten Male in meinem Leben, ohnmächtig nieder. Welche Qualen ich während der vierundzwanzigstündigen Fahrt erlitten habe, kann ich nicht beschreiben. Zum Tode erschöpft, unfähig, meinen Körper zu bewegen, erreichte ich Paris.
Hier wurde ich von meinem Bruder Emil empfangen. Welch’ Wiedersehen! Als kräftiger, gesunder Mann war ich in die weite Welt gezogen und jetzt, kaum erkennbar für den Bruder, eine hilflose, körperlich und geistig gebrochene Gestalt. Doch erkannte mich mein Bruder, der sichtlich über mein Aussehen erschrocken war.
Auf zwei Krücken mich mühsam fortbewegend, wurde ich von ihm zu dem Doktor Nelaton geführt, der nach Untersuchung meines Beines erklärte, dass ich den Gebrauch desselben im Laufe der Zeit wiedererlangen, bis dahin aber noch viele Schmerzen zu erdulden haben würde. Nach Vorschrift des genannten Arztes wurde mir eine besondere Beinschiene konstruiert.
Durch die liebevolle Pflege meiner in Paris wohnenden Schwägerin machte die Zunahme meiner Kräfte rasch gute Fortschritte, so dass ich schon nach vier Wochen stundenlange Fahrten unternehmen konnte.
Alsdann erlangte ich später meine volle Gesundung in den Heilquellen von Teplitz. Aber trotz aller Badekuren war ich gezwungen, dem mir lieb gewordenen, mit meiner innigsten Neigung verwachsenen, seemännischen Beruf zu entsagen. Meine achtzehnjährige, wechselreiche Tätigkeit, während welcher ich so manchen bedrohlichen Stürmen und Gefahren in treuer Pflichterfüllung glücklich widerstanden, zu jeder Zeit nach bestem Wissen und Gewissen meine Schuldigkeit erfüllt zu haben glaube, war nunmehr beendet.
Sehnsuchtsvoll zog es mich nach dem geliebten Hamburg, meiner zweiten Heimat. Hier erwarb ich, um mir eine Existenz zu schaffen, den Verlag und die Redaktion der Hansa, einer Zeitschrift für Seewesen und derzeitigen Organs der deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Wenn auch meiner seemännischen Laufbahn für immer ein Ziel gesetzt war, so ergriff ich mit um so größerer Freude die angebotene Gelegenheit, mit allen die Schifffahrt berührenden Dingen in reger Verbindung zu bleiben, um wenigstens mit ungeschwächter geistiger Kraft meine lebhafte Teilnahme für das deutsche Seewesen betätigen zu können.
Ein unerwartet freudiger Wendepunkt in meinem Leben trat wenige Monate später ein. Laut Beschluss der Deputation für Handel und Schifffahrt, an deren Spitze die unvergesslichen Senator Hübener und Bürgermeister Dr. Kirchenpauer standen, wurde ich zum Wasserschout von Hamburg ernannt. Mit freudeerfülltem Herzen trat ich nach feierlicher, in Gegenwart eines versammelten hohen Senats erfolgten Vereidigung, am 1. Juni 1870 mein neues Amt an. Ein wohlwollendes Schicksal hatte das letzte Gewölk zerteilt, klar und deutlich lag meine Zukunft, meine offizielle Tätigkeit, die ehrenvollste, welche der Hamburger Staat einem Kauffahrteikapitän zuweisen kann, vor mir...
Das Glück und die Zufriedenheit, welche mir meine achtzehnjährige amtliche Tätigkeit gebracht hat, versöhnte mich mit dem erduldeten Schicksal früherer Zeiten...
Die Bezeichnung Wasserschout ist der holländischen Sprache entlehnt und entspricht in deutscher Übersetzung: Magistratsperson für Seeleute. Die amtliche, mit richterlicher und polizeilicher Gewalt verbundene Tätigkeit des Wasserschouts erstreckte sich auf alle auf hoher See sich ereignenden Vorfälle und auf die unter der Mannschaft der im Hafen vor Anker liegenden Schiffe stattfindenden Vorgänge, Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Kapitän und Mannschaft, Militär-Kontrolle der Seeleute, Abschluss des Heuervertrages sowie Auflösung des Dienstverhältnisses, Auszahlung der Löhne, Erbschaftsregulierung, Heimschaffung hilfsbedürftiger Seeleute, Seeberufsgenossenschafts-Untersuchungen von Unfällen auf See, Registrierung sämtlicher Seeleute. Auch hatte der Wasserschout von Hamburg eine gewisse fürsorgliche Stellung inne, als Mit-Verwalter der Seemannskasse und Verteiler von Unterstützungen an Witwen und Waisen von im Beruf umgekommenen Seeleuten. Ferner war derselbe Mitglied der Mobilmachungs- und Schiffsrequisitions-Kommission und seit dem Jahre 1873 bei Einführung der Reichsseemannsordnung auch Vorstand des Seemannsamtes. Der rege Verkehr im Hamburgischen Seemannsamte dürfte durch die An- und Abmusterung beispielsweise im Jahre 1887 von insgesamt 48.000 Mann und eine Lohnauszahlung, die annähernd fünf Millionen Mark betrug, am besten veranschaulicht werden.0
Alfred Tetens starb am 13.01.1903.
1) Laut Internetsite: www.micsem.org/pubs/articles/historical/bcomber/sources.htm
Andrew Cheyne Palau, Pohnpei (1842-1866)
Andrew Cheyne was an English trader who first came to Pohnpei in 1842 as captain of a trading vessel. Between 1842 and 1844 Cheyne visited Pohnpei four times spending nearly a total of 12 months on the islands. Cheyne was trading in shell and beche-de-mer on Pohnpei at this time. He also visited Palau to set up trade stations on that island. When he moved out of Pohnpei in 1844, Cheyne set up headquarters in Palau and made a brief trading visits to Yap. After surviving an attempt on his ship in Yap, Cheyne left Micronesia in 1846.
Cheyne returned again in 1859. He established headquarters in Palau and went into partnership first with Edward Woodin and then with Alfred Tetens. He acquired 10,000 acres of land and established sugar, coffee and tobacco plantations on Palau with the intentions of importing Chinese labor to cultivate his plantations. Meanwhile, he continued trading in beche-de-mer and shell. Cheyne's relationship with the Koror people deteriorated because of his insistence on trading with their rivals in Balbeldaop. Finally, on February 6, 1866, Cheyne was clubbed to death by some local people.
Sources: Shineberg 1971: 20-4
Cheyne, Andrew. 1866 Journal Aboard the Brigantine Acis, November 1863 - February 1866. Private journal in the possession of Sir Joseph Cheyne, Rome. (Notes taken by Dorothy Shineberg, School of General Studies, Australian National University, Canberra).
2) Diese Internetseite gibt Auskunft über Alfred Tetens’ Wirken in der Südsee:
www.micsem.org/pubs/articles/historical/bcomber/sources.htm
Alfred Tetens Yap, Palau (1862-1867)
Alfred Tetens was a German sea captain from Hamburg. Andrew Cheyne met him in Manila and hired him to serve as a master of his ship "Acis". Tetens also served as a captain of another of Cheyne's vessels, the "Perseverancia" in 1862-1863. Tetens was homeported in Palau and spent most of his time there during this period. Tetens oversaw the cotton and tobacco plantations in Palau. In 1865, he went to work with Godeffroy & Son and was put in command of the brig "Vesta". He traded throughout the Carolines at this time visiting Palau frequently. In 1867 he left the Pacific to return to Hamburg. Sources: Tetens 1958
3) Laut www.micsem.org/pubs/articles/historical/bcomber/sources.htm
Semper, Karl. 1873 Die Palau-Inseln im Stillen Ocean. Leipzig: F A Brockhaus.
4) Laut www.micsem.org/pubs/articles/historical/bcomber/sources.htm :
Henry Wilson Palau (1783) Captain Henry Wilson and the crew of the British East India Company ship "Antelope" was wrecked in Palau in August 10, 1783. Wilson and the English sailors -- 50 men in all -- remained in Palau until November 12. During this time they assisted Ibedul in his wars against his traditional enemies. They left the island in a small schooner built from the wrecked. Sources: Keate 1789
Alfred Tetens im Internet:
Deszendenz, politische Macht und ...
Einflußreich in wirtschaftlicher Hinsicht waren die Deutschen, die 1869 den ersten permanenten Sitz des Hamburger Handelshauses Godeffroy unter Leitung von Alfred Tetens auf Yap errichteten. Das wichtigste Handelsprodukt war Kopra.
Beachcombers, Traders & Castaways in Micronesia :
Alfred Tetens Yap, Palau (1862-1867)
Alfred Tetens was a German sea captain from Hamburg. Andrew Cheyne met him in Manila and hired him to serve as a master of his ship "Acis". Tetens also served as a captain of another of Cheyne's vessels, the "Perseverancia" in 1862-1863. Tetens was homeported in Palau and spent most of his time there during this period. Tetens oversaw the cotton and tobacco plantations in Palau. In 1865, he went to work with Godeffroy & Son and was put in command of the brig "Vesta". He traded throughout the Carolines at this time visiting Palau frequently. In 1867 he left the Pacific to return to Hamburg.
Yap Ships [PDF] MICRONESICA 34(1) 2001 new Bauer et al. - U. of Western Ontario /Weldon - ANASTACIO - TodoCine: Su majestad de los mares del Sur Palau: Airai -- Memories: Chronology - His Majesty O'Keefe @ Hollywood.com. Movie synopsis, review, ... - Celebrities @ Hollywood.com-Featuring Andre Morell. Celebrities, ... - Hezel: Foreign Ships in Micronesia - Geschichte der Seemannsmission in Hamburg - Robert Hughes Pacificana (US publ. before 1999) - The Role Of The Beachcomber In The Carolines -
noch ein Segelschiff-Seemann
Schiffsbilder
maritime Buchreihe
Seeleute
Seefahrtserinnerungen - Seefahrtserinnerungen - Maritimbuch
Informationen zu den maritimen Büchern des Webmasters finden Sie hier:
zur gelben Zeitzeugen-Bücher-Reihe des Webmasters:
© Jürgen Ruszkowski

zur gelben Zeitzeugen-Bücher-Reihe des Webmasters:
© Jürgen Ruszkowski
Maritime books in German language: fates of international sailors
Los libros marítimos en el idioma alemán: los destinos de marineros internacionales:
zu meiner maritimen Bücher-Seite
navigare necesse est!
Maritime books in German language: fates of international sailors
Los libros marítimos en el idioma alemán: los destinos de marineros internacionales:
Diese Bücher können Sie direkt bei mir gegen Rechnung bestellen: Kontakt:
Zahlung nach Erhalt der der Ware per Überweisung.
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
Zahlung nach Erhalt der der Ware per Überweisung.
Bücher in der gelben Buchreihe" Zeitzeugen des Alltags" von Jürgen Ruszkowski:
|
Seemannsschicksale
Band 1 - Band 1 - Band 1 - Band 1
Begegnungen im Seemannsheim
ca. 60 Lebensläufe und Erlebnisberichte
von Fahrensleuten aus aller Welt

http://www.libreka.de/9783000230301/FC
libreka.de: unter Ruszkowski suchen!
13,90 € - Bestellung -
|
Seemannsschicksale
Band 2 - Band 2
Lebensläufe und Erlebnisberichte

Lebensläufe und Erlebnisberichte von Fahrensleuten, als Rentner-Hobby aufgezeichnet bzw. gesammelt und herausgegeben von Jürgen Ruszkowski
http://www.libreka.de/9783000220470/FC
libreka.de: unter Ruszkowski suchen!
13,90 € - Bestellungen -
|
Seemannsschicksale
Band_3
Lebensläufe und Erlebnisberichte

Lebensläufe und Erlebnisberichte von Fahrensleuten
http://www.libreka.de/9783000235740/FC
libreka.de: unter Ruszkowski suchen!
13,90 € - Bestellungen -
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
|
|
Edition 2004 - Band 4
Seemannsschicksale unter Segeln

Die Seefahrt unserer Urgroßväter
im 19. Jahrhundert und am Anfang des 20. Jahrhunderts
13,90 €
- Bestellungen -
|
Band 5
Capt. E. Feith's Memoiren:

Ein Leben auf See
amüsant und spannend wird über das Leben an Bord vom Moses bis zum Matrosen vor dem Mast in den 1950/60er Jahren, als Nautiker hinter dem Mast in den 1970/90er Jahren berichtet
http://www.libreka.de/9783000214929/FC
libreka.de: unter Ruszkowski suchen!
13,90 € - Bestellungen -
|
Band 6 ist geplant
Leseproben und Bücher online
Seemannsschicksale
maritimbuch
Schiffsbild - Schiffsbild
Schiffsbild
erwähnte Personen
- erwähnte Schiffe -
erwähnte Schiffe E - J
erwähnte Schiffe S-Z
|
|
Band 7
in der Reihe Seemannsschicksale:
Dirk Dietrich:
Auf See
ISBN 3-9808105-4-2
Dietrich's Verlag
Band 7
Bestellungen
Band 8:
Maritta & Peter Noak
auf Schiffen der DSR
ISBN 3-937413-04-9
Dietrich's Verlag
Bestellungen
|
Band 9
Die abenteuerliche Karriere eines einfachen Seemannes
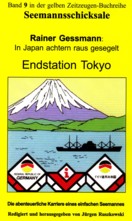
Endstation Tokyo
12 € - Bestellungen
|
Band 10 - Band 10
Autobiographie des Webmasters
Himmelslotse
Rückblicke: 27 Jahre Himmelslotse im Seemannsheim - ganz persönliche Erinnerungen an das Werden und Wirken eines Diakons

13,90 € - Bestellungen -
|
|
- Band 11 -
Genossen der Barmherzigkeit

Diakone des Rauhen Hauses
Diakonenportraits
13,90 € - Bestellungen -
|
Band 12 - Band 12
Autobiographie:
Diakon Karlheinz Franke

12 € - Bestellungen -
|
Band 13 - Band 13

Autobiographie:
Diakon Hugo Wietholz
13,90 € - Bestellungen -
|
|
Band 14
Conrad H. v. Sengbusch

Jahrgang '36
Werft, Schiffe, Seeleute, Funkbuden
Jugend in den "goldenen 1959er Jahren"

Lehre als Schiffselektriker in Cuxhaven
13,90 € - Bestellungen -
|
Band 15
Wir zahlten für Hitlers Hybris
mit Zeitzeugenberichten aus 1945 über Bombenkrieg, Flucht, Vertreibung, Zwangsarbeit und Gefangenschaft

Ixlibris-Rezension
http://www.libreka.de/9783000234385/FC
libreka.de: unter Ruszkowski suchen!
13,90 € - Bestellungen -
|
Band 16
Lothar Stephan
Ein bewegtes Leben - in den Diensten der DDR - - zuletzt als Oberst der NVA
ISBN 3-9808105-8-5
Dietrich's Verlag
Bestellungen
Schiffsbild
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
|
|
Band 17
Als Schiffskoch weltweit unterwegs


Schiffskoch Ernst Richter
http://www.libreka.de/9783000224713/FC
13,90 € - Bestellungen -
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seit
|
Band 18
Seemannsschicksale
aus Emden und Ostfriesland

und Fortsetzung Schiffskoch Ernst Richter auf Schleppern

http://www.libreka.de/9783000230141/FC
libreka.de: unter Ruszkowski suchen!
13,90 € - Bestellungen -
|
Band 19
ein Seemannsschicksal:
Uwe Heins

Das bunte Leben eines einfachen Seemanns
13,90 € - Bestellungen -
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
|
|
Band 20
ein Seemannsschicksal im 2. Weltkrieg

Kurt Krüger
Matrose im 2. Weltkrieg
Soldat an der Front
- Bestellungen -
|
Band 21
Ein Seemannsschicksal:
Gregor Schock

Der harte Weg zum Schiffsingenieur
Beginn als Reiniger auf SS "RIO MACAREO"
13,90 € - Bestellungen -
|
Band 22
Weltweite Reisen eines früheren Seemanns als Passagier auf Fähren,
Frachtschiffen
und Oldtimern
Anregungen und Tipps für maritime Reisefans

- Bestellungen -
|
|
Band 23
Ein Seemannsschicksal:
Jochen Müller

Geschichten aus der Backskiste
Ein ehemaliger DSR-Seemann erinnert sich
12 € - Bestellungen -
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
|
Band 24
Ein Seemannsschicksal:
Der maritime Liedermacher
Mario Covi: -1-
Traumtripps und Rattendampfer

Ein Schiffsfunker erzählt
über das Leben auf See und im Hafen
http://www.libreka.de/9783000221460/FC
libreka.de: unter Ruszkowski suchen!
13,90 € - Bestellungen -
|
Band 25
Ein Seemannsschicksal:
Der maritime Liedermacher
Mario Covi: -2-
Landgangsfieber und grobe See

Ein Schiffsfunker erzählt
über das Leben auf See und im Hafen
http://www.libreka.de/9783000223624/FC
libreka.de: unter Ruszkowski suchen!
13,90 € - Bestellungen -
|
|
Band 26
Monica Maria Mieck:


Liebe findet immer einen Weg
Mutmachgeschichten für heute
Besinnliche Kurzgeschichten
auch zum Vorlesen
- Bestellungen -
|
- Band 27 -
Monica Maria Mieck


Verschenke kleine
Sonnenstrahlen
Heitere und besinnliche Kurzgeschichten
auch zum Vorlesen
- Bestellungen -
|
- Band 28 -
Monica Maria Mieck:


Durch alle Nebel hindurch
erweiterte Neuauflage
Texte der Hoffnung
besinnliche Kurzgeschichten und lyrische Texte
ISBN 978-3-00-019762-8
- Bestellungen -
|
|
Band 29

Logbuch
einer Ausbildungsreise
und andere
Seemannsschicksale
Seefahrerportraits
und Erlebnisberichte
ISBN 978-3-00-019471-9
http://www.libreka.de/9783000194719/FC
13,90 € - Bestellungen -
|
Band 30
Günter Elsässer

Schiffe, Häfen, Mädchen
Seefahrt vor 50 Jahren
http://www.libreka.de/9783000211539/FC
- Bestellungen -
13,90 €
- Bestellungen -
|
Band 31
Thomas Illés d.Ä.
Sonne, Brot und Wein

ANEKIs lange Reise zur Schönheit
Wohnsitz Segelboot
Reise ohne Kofferschleppen
Fortsetzung in Band 32
13,90 €
- Bestellungen -
|
|
Band 32
Thomas Illés d.Ä.
Sonne, Brot und Wein
Teil 2

Reise ohne Kofferschleppen
Fortsetzung von Band 31 - Band 31
13,90 € - Bestellungen -
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
|
Band 33
Jörn Hinrich Laue:
Die große Hafenrundfahrt in Hamburg
reich bebildert mit vielen Informationen auch über die Speicherstadt, maritime Museen und Museumsschiffe

184 Seiten mit vielen Fotos, Schiffsrissen, Daten
ISBN 978-3-00-022046-3
http://www.libreka.de/9783000220463/FC
- Bestellungen -
|
Band 34
Peter Bening
Nimm ihm die Blumen mit

Roman einer Seemannsliebe
mit autobiographischem Hintergrund
http://www.libreka.de/9783000231209/FC
- Bestellungen -
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
|
|
Band 35
Günter George

Junge, komm bald wieder...
Ein Junge aus der Seestadt Bremerhaven träumt von der großen weiten Welt
http://www.libreka.de/9783000226441/FC
13,90 € - Bestellungen -
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
|
Band 36
Rolf Geurink:

In den 1960er Jahren als
seemaschinist
weltweit unterwegs
http://www.libreka.de/9783000243004/FC
13,90 €
- Bestellungen -
libreka.de: unter Ruszkowski suchen!
meine google-Bildgalerien
realhomepage/seamanstory
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
|
Band 37
Schiffsfunker Hans Patschke:


Frequenzwechsel
Ein Leben in Krieg und Frieden als Funker auf See
auf Bergungsschiffen und in Großer Linienfahrt im 20. Jahrhundert
http://www.libreka.de/9783000257766/FC
13,90 € - Bestellungen -
|
|
Band 38 - Band 38
Monica Maria Mieck:

Zauber der Erinnerung
heitere und besinnliche Kurzgeschichten
und lyrische Texte
reich sw bebildert
12 € - Bestellungen -
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
|
Band 39
Hein Bruns:


In Bilgen, Bars und Betten
Roman eines Seefahrers aus den 1960er Jahren
in dieser gelben maritimen Reihe neu aufgelegt
kartoniert
Preis: 13,90 €
Bestellungen
|
Band 40
Heinz Rehn:


von Klütenewern und Kanalsteurern
Hoch- und plattdeutsche maritime Texte
Neuauflage
13,90 € - Bestellungen -
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
|
|
Band 41
Klaus Perschke - 1 -
Vor dem Mast
1951 - 1956
nach Skandinavien und Afrika

Ein Nautiker erzählt vom Beginn seiner Seefahrt
Preis: 13,90 € - Bestellungen
|
Band 42
Klaus Perschke - 2 -
Seefahrt 1956-58

Asienreisen vor dem Mast - Seefahrtschule Bremerhaven - Nautischer Wachoffizier - Reisen in die Karibik und nach Afrika
Ein Nautiker erzählt von seiner Seefahrt
Fortsetzung des Bandes 41
13,90 € - Bestellungen
|
Band 43
Monica Maria Mieck:

Winterwunder

weihnachtliche Kurzgeschichten
und lyrische Texte
reich sw bebildert
10 € - Bestellungen -
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
|
|
Band 44
Lothar Rüdiger:

Flarrow, der Chief 1
Ein Schiffsingenieur erzählt
Maschinen-Assi auf DDR-Logger und Ing-Assi auf MS BERLIN
13,90 € - Bestellungen
Band 47
Seefahrtserinnerungen

Ehemalige Seeleute erzählen
13,90 € - Bestellungen
Band 50
Jürgen Coprian:
Salzwasserfahrten 2
Trampfahrt worldwide
mit
FRIEDERIKE TEN DOORNKAAT

- - -
Band 53:
Jürgen Coprian:
MS COBURG

Salzwasserfahrten 5
weitere Bände sind geplant
13,90 € - Bestellungen
|
Band 45
Lothar Rüdiger:

Flarrow, der Chief 2
Ein Schiffsingenieur erzählt
Fortsetzung des Bandes 44
Flarrow als Wachingenieur
13,90 € - Bestellungen
Band 48:
Peter Sternke:
Erinnerungen eines Nautikers

13,90 € - Bestellungen
Band 51
Jürgen Coprian:
Salzwasserfahrten 3

- - -
Jürgen Coprian:
Salzwasserfahrten 6
weitere Bände sind geplant
alle Bücher ansehen!
hier könnte Ihr Buch stehen
13,90 € - Bestellungen
|
Band 46
Lothar Rüdiger:

Flarrow, der Chief 3
Ein Schiffsingenieur erzählt
Fortsetzung des Bandes 44 + 45
Flarrow als Chief
13,90 € - Bestellungen
Band 49:
Jürgen Coprian:
Salzwasserfahrten 1

Ostasienreisen mit der Hapag
13,90 € - Bestellungen
- - -
Band 52 - Band 52
Jürgen Coprian:
Salzwasserfahrten 4
MS "VIRGILIA"
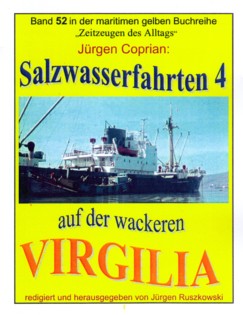
---
Band 56
Immanuel Hülsen
Schiffsingenieur, Bergungstaucher

Leserreaktionen
- - -
Band 57
Harald Kittner:

zeitgeschichtlicher Roman-Thriller
- - -
Band 58

Seefahrt um 1960
unter dem Hanseatenkreuz
weitere Bände sind in Arbeit!
|
Viele Bände sind jetzt auch als amazon-Direktdruck-Printbücher zu erhalten:
Band 1 - Band 2 - Band 4-1 Alfred Tetens - Band 4-b Anthologie 2015 - Band 5 - Band 6 - Band 13 - Band 15 - Band 17 - Band 18 - Band 19 - Band 20 - Band 21 - Band 22 - Band 26 - Band 27 - Band 30 - Band 31 - Band 32 - Band 33 - Band 37 - Band 39 - Band 40 - Band 41 - Band 42 - Band 44 - Band 45 - Band 46 - Band 48 - Band 58 - Band 59 - Band 60 - Band 64 - Band 65 - Band 68 - Band 69 - Band 70 - Band 71 - Band 73 - Band 76 - Band 78 - Band 79 -
Diese Bücher können Sie für direkt bei mir gegen Rechnung bestellen: Kontakt:
Zahlung nach Erhalt der der Ware per Überweisung.
|
Meine Postadresse / my adress / Los orden-dirección y la información extensa:
Jürgen Ruszkowski, Nagelshof 25,
D-22559 Hamburg-Rissen,
Telefon: 040-18 09 09 48 - Anrufbeantworter nach 30 Sekunden -
Fax: 040 - 18 09 09 54
Bestellungen am einfachsten unter Angabe Ihrer Anschrift per e-mail: Kontakt
|

|
Bücher in der gelben Buchreihe" Zeitzeugen des Alltags" von Jürgen Ruszkowski:
Wenn Sie an dem Thema "Seeleute" interessiert sind, gönnen Sie sich die Lektüre dieser Bücher und bestellen per Telefon, Fax oder am besten per e-mail: Kontakt:
Meine Bücher der gelben Buchreihe "Zeitzeugen des Alltags" über Seeleute und Diakone sind über den Buchhandel oder besser direkt bei mir als dem Herausgeber zu beziehen, bei mir in Deutschland portofrei (Auslandsporto: ab 3,00 € )
Bestellungen am einfachsten unter Angabe Ihrer Anschrift per e-mail: Kontakt
Sie zahlen nach Erhalt der Bücher per Überweisung.
Maritime books in German language: fates of international sailors
Los libros marítimos en el idioma alemán: los destinos de marineros internacionales:
Los libros en el idioma alemán lo enlatan también, ( + el extranjero-estampilla: 2,70 €), directamente con la editor Buy de.
Bestellungen und Nachfragen am einfachsten über e-mail: Kontakt
Wenn ich nicht verreist bin, sehe ich jeden Tag in den email-Briefkasten. Dann Lieferung innerhalb von 3 Werktagen.
Ab und an werde ich für zwei bis drei Wochen verreist und dann, wenn überhaupt, nur per eMail: Kontakt via InternetCafé erreichbar sein!
Einige maritime Buchhandlungen in Hamburg in Hafennähe haben die Titel auch vorrätig:
HanseNautic GmbH, Schifffahrtsbuchhandlung, ex Eckardt & Messtorff, Herrengraben 31, 20459 Hamburg, Tel.: 040-374842-0 www.HanseNautic.de
WEDE-Fachbuchhandlung, Hansepassage, Große Bleichen 36, Tel.: 040-343240
Schifffahrtsbuchhandlung Wolfgang Fuchs, Rödingsmarkt 29, 20459 Hamburg, Tel: 3193542, www.hafenfuchs.de
Ansonsten, auch über ISDN über Buchhandlungen, in der Regel nur über mich bestellbar.
Für einen Eintrag in mein Gästebuch bin ich immer dankbar.
Alle meine Seiten haben ein gemeinsames Gästebuch. Daher bitte bei Kommentaren Bezug zum Thema der jeweiligen Seite nehmen!
Please register in my guestbook
Una entrada en el libro de mis visitantes yo agradezco siempre.
Za wpis do mej ksiegi gosci zawsze serdecznie dziekuje.
erwähnte Personen
Leseproben und Bücher online

meine websites bei freenet-homepage.de/seamanstory liefen leider Ende März 2010 aus! Weiterleitung!
Diese website existiert seit 2003 - last update - Letzte Änderung 20.08.2015
Jürgen Ruszkowski © Jürgen Ruszkowski © Jürgen Ruszkowski
|

