 |
Capt. E. Feith - 3 - Hinter dem Mast

Zugriffszähler seit 26.12.2010
| Ein Leben auf See
Die Memoiren des Capt. E. Feith
Erinnerungen an die Seefahrt der 1950 bis 90er Jahre - Band 5 der gelben Zeitzeugenreihe "Seemannsschicksale"
Dritter Teil: Hinter dem Mast
|

|

Zugriffszähler seit 9.03.2003
Band 5 der gelben Zeitzeugenreihe "Seemannsschicksale" von Jürgen Ruszkowski


Emil Feith
Sie können das Buch direkt bestellen beim Herausgeber: siehe unten!
Navigationsschüler
Der A5II-Lehrgang, der mich zum „2.Steuermann auf Großer Fahrt“ befähigen sollte, begann kurz nach meinem 21. Geburtstag, und ich war der jüngste Lehrgangsteilnehmer. Es war ein „akademischer“ Kurs, denn bis auf einige wenige, zu denen ich gehörte, besaßen fast alle das Abitur, damals noch eine „Eliteauswahl“. Auch unser Lehrgangsleiter war ein „akademischer“ Dozent, der nie zur See gefahren war. Er unterrichtete uns in Navigation und Mathematik. Der Bord-Umgangston war ihm fremd, und er drückte sich immer sehr gewählt aus. Das Wort „Scheiße“ verabscheute er zutiefst und ersetzte es durch „Kacke“, was in meinen Ohren auch nicht feiner klang. Wir waren sein zweiter nautischer Lehrgang und saßen mit 26 Teilnehmern hufeisenförmig mit unseren Tischen vor seinem Pult. Hinter unserem Dozenten befand sich die Tafel. Rechts und links neben mir saßen zwei sehr merkwürdige „Schulkollegen“.
Rechts saß Günther, etwa 26 Jahre alt. Er hatte die „Mittlere Reife“ und war als Matrose bei der Hapag gefahren. Günther war mit einer Edelnutte aus dem bekannten Nachtlokal „Reeperbahn-Maxe“ liiert und wohnte bei ihr. Da er selbst mittellos war, bestritt seine Dame seinen Lebensunterhalt und kleidete ihn immer nach der neuesten Mode. Sie sorgte auch für sein stets ausreichendes Taschengeld. Das „Reeperbahn-Maxe“ gehörte damals zu den feudalen Nachtlokalen, die nur mit Schlips und Kragen zu betreten waren. Das billigste Getränk war ein „Pony“ für die Damen. Mit Bier gaben die sich ohnehin nicht ab und wenn man eine „abschleppen“ wollte, musste man schon „gut betucht“ sein. Das war also nichts für „Hein Seemanns“ Geldbeutel. Günther musste für sein Taschengeld hart arbeiten und sich mit seiner Dame die Nächte um die Ohren schlagen, denn das „Reeperbahn-Maxe“ hatte immer bis 6 Uhr früh geöffnet. Kein Wunder also, dass er morgens meist sehr verkatert aussah und sich nur mit Hilfe von „Prelies“ (Prelodin) auf den Beinen halten konnte. Hing bei ihm der Haussegen schief und hatte die Dame schlechte Laune, ging es ihm dreckig. Sie setzte ihn dann auf die Straße, und er kam sehr zerknautscht zum Unterricht. Dauerte der Streit einige Tage, dann wurde seine Situation schlimm, und er musste seine goldene Omega-Armbanduhr versetzen. War auch das dafür erworbene Geld aufgebraucht, irrte er tagelang unrasiert umher und pumpte sich Geld von uns, um etwas im Magen zu haben. Irgendwann fand dann aber immer wieder die Versöhnung statt, und unser „Freund“ erschien fortan wieder geschniegelt und gebügelt mit seiner Omega am Arm.
Auch mein linker Nachbar war ein besonderer Charakter. Er war Mitte Zwanzig, braun- bis dunkelhaarig, sehr klein und schmächtig. Man hätte ihn ohne Weiteres für einen Südländer halten können. Er kam aus der Nähe des Bodensees, hatte ein Gymnasium besucht und war sehr gescheit. Seine Komplexe wegen seiner knabenhaften Größe suchte er durch überlegenes Gehabe und zynisch-abfällige Bemerkungen zu kompensieren. Da ich neben ihm saß, hatte er es damit besonders auf mich abgesehen. Anfangs parierte ich seine Sticheleien mit Bemerkungen über seine Größe und der Frage, ob er seine Garderobe bei C&A in der Kinderabteilung kaufen würde. Damit konnte ich ihn wirklich auf die Palme bringen, und unser Streit eskalierte so weit, dass ich ihm mitten im Unterricht mit voller Wucht in den Magen schlug. Glücklicherweise waren alle Blicke auf die Tafel gerichtet, an der uns unser Dozent gerade Trigonometrische Grundformeln erklärte, so dass uns niemand beobachtet hatte. Mein „Freund“ zur Linken verdrehte die Augen, klappte über seinem Tisch zusammen und alle dachten, ihm sei schlecht geworden. Unser Dozent ließ sofort das Fenster öffnen und ihn nach draußen in den Gang an die frische Luft bringen. Danach verstanden wir uns eine Weile ganz gut, was für mich wiederum nicht so gut war, denn eines Tages überredete er mich, mit ihm abends ins „Reeperbahn-Max“ zu gehen, um unseren Schulkollegen zu meiner Rechten zu besuchen. Leider trafen wir Günther nicht an und nachdem uns einige Damen zu einem Drink überredet hatten, fehlten mir einige Stunden Bewusstheit, und ich erwachte irgendwann am frühen Morgen alleine am Tisch sitzend, umgeben von einer dreiköpfigen Zigeunerkapelle, die herzerweichende ungarische Weisen geigte, die meinem Gemütszustand angepasst waren. Nachdem man mir während der Nacht meine letzten Kröten abgeknöpft hatte, schlich ich mich wie ein geprügelter Hund zu Fuß ins Seemannsheim, wo ich ein sogenanntes „Schülerzimmer“ zum halben Preis bewohnte. Ich war mit etwa 100 Mark losgegangen, was damals für mich enorm viel Geld bedeutete, und kam ohne jeden Pfennig zurück. Wenn man bedenkt, dass ein Glas Bier damals in einem normalen Lokal kaum mehr als 30 Pfennig kostete, konnte es in dieser Nacht nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Aber das „Reeperbahn-Max“ war eben kein normales Lokal, und es war damals nicht unüblich, dass die Damen einem etwas ins Glas mixten, das auch den stärksten Seemann umhaute. Mein Begleiter hatte nach seiner Aussage dort eine alte „Freundin“ getroffen und mit ihr das Lokal verlassen. Als echter „Freund“ hatte er mich alleine meinem Schicksal überlassen. Zwei Monate später bekam ich eine Darminfektion und musste für einen Monat das Bett hüten. Da ich die versäumte Zeit nicht hätte aufholen können, stieg ich in einen gerade neu beginnenden A5II-Lehrgang ein. Von meinen beiden Schulbankkollegen hörte ich später, dass beide das Examen bestanden hatten. Günther fiel noch während des Lehrgangs bei seiner Dame endgültig in Ungnade und freundete sich mit der Tochter einer uns bekannten Kellnerin aus dem Bierlokal „Bei Fiete“ in der Davidstraße an. Er versprach ihr die Ehe und nachdem er sich als zukünftiger „Schwiegersohn“ genügend Geld geliehen und sein Examen bestanden hatte, verschwand er auf Nimmerwiedersehen. Über meinen dunkelhaarigen „Freund“ zur Linken hörte ich einige Jahre später von Gretel, einer Bardame in der „Washington-Bar“, er soll dort als 3.Offizier total besoffen gewesen sein. Seine Leute von Bord hätten ihn in diesem Zustand auf die andere Straßenseite getragen und ihn dort den 50 m tiefen Abhang zur Hafenstraße hinabrollen lassen, wo er im Vollrausch liegengeblieben sei. Man sieht also, schon damals gab es eine ausgleichende Gerechtigkeit. Gretel kannte übrigens auch den bekannten Sänger Freddy Quinn aus der Zeit, als er noch mit seiner Gitarre auf St. Pauli von Kneipe zu Kneipe zog und sich besonders gerne in der „Washington-Bar“ aufhielt.
Mein neuer Lehrgang bestand aus „normalen“ Seeleuten, und unser Lehrgangsleiter war ein „akademischer Nautiker“, der jahrelang selbst als Offizier und Kapitän zur See gefahren war. Wir nannten ihn „Papa Zeuner“ und er verhielt sich wirklich wie ein Vater zu uns und brachte uns unser zukünftiges „Handwerk“ in verständlicher Sprache bei. Anders als die „akademischen Dozenten“, für die wir befahrene Seeleute wegen unserer eigenen Bordsprache und die durch das Bordleben geprägten Verhaltensweisen eine ihnen völlig unbekannte Gattung Mensch waren, verstand Papa Zeuner unsere Sprache und Denkweise. Er unterrichtete uns in Nautik, Mathematik und Seestraßenordnung, und seine Unterrichtsmethoden waren praxisbezogen auf unseren zukünftigen Beruf ausgerichtet. Die nichtbefahrenen „akademischen“ Dozenten mussten deshalb in gewissen Zeitabständen ein paar Wochen als „Passagier auf Staatskosten“ auf einem Frachtschiff hospitierend mitfahren, um die Bordpraxis kennen zu lernen. An Bord dieser Gastschiffe kursierten einige unglaubliche Geschichten über sie. Einer verlangte beispielsweise vom Kapitän, er solle bei voller Fahrt auf See außenbords eine Stellage über der Wasseroberfläche montieren lassen. Er wollte dadurch bei der Winkelmessung Sonne/Horizont mit dem Sextanten die Augenhöhe von der Brücke reduzieren. Der Kapitän soll diesen Dozenten vor versammelter Mannschaft ausgelacht haben, da es Tabellen für eine Berichtigung an Bord gibt. Praxis ist Praxis und grau ist jede Theorie. Bis auf den Physikdozenten waren die anderen Lehrkräfte alle ehemalige befahrene Nautiker. Unter uns Kommilitonen herrschte eine echte Kameradschaft. Wenn jemand von uns in bestimmten Fächern schwach war, wurde ihm nach dem Unterricht von einem unserer Koryphäen alles noch einmal erklärt. Papa Zeuner hatte eine Engelsgeduld mit uns. Wenn aber jemand besonders begriffsstutzig war, ließ er seine Hosenträger über die Schultern hängen und sagte dann verärgert: „Noch einmal das Ganze, dann ist aber Schluss!“
Ich wohnte damals im alten Seemannsheim der Seemannsmission am Wolfgangsweg in der Nähe der Überseebrücke in einem Zweibettzimmer. Als Schüler erhielt ich, wie schon erwähnt, eine merkliche Mietermäßigung, musste aber damit leben, dass ich immer wieder neue Zimmerkollegen bekam. Es waren Seeleute, die wieder anmustern wollten oder gerade abgemustert hatten. Letztere blieben meistens solange, bis ihr Geld all war und sie deshalb wieder an Bord mussten. Es gab für mich nicht immer eine ruhige Nacht, denn wenn „Hein Seemann“ nach langer Zeit an Bord mit Taschen voller Geld abmusterte, stürzte er sich die ersten Tage voll ins Nachtleben. Ich habe nicht gezählt, wie oft ich nachts von solchen „voll unter Dampf“ stehenden Mitbewohnern geweckt und zu einer Sauftour eingeladen wurde. Ließ ich mich einmal dazu überreden, hatte ich natürlich am nächsten Tag einen furchtbaren „Durchhänger“. Das konnte ich mir natürlich nicht oft leisten. Dafür war der Lehrstoff zu umfangreich und die Zeit zu kurz.
Viele Leute, die damals im Seemannsheim wohnten, hatten in Seefahrtskreisen Spitznamen. Da gab es einen „Heizer-Paule“, einen „Perser-Rudi“ und zwei „Alligatoren-Schorschs“. Nr. 1 war ein junger, dunkelhaariger, gut aussehender Bursche mit einem Menjoubärtchen, welches ihm das verwegene Aussehen eines Torero gab. Er trug stets einen blauen Blazer und Krawatte und war an Land meist unter Dampf. Ich habe ihn nie nüchtern gesehen. Seinen Spitznamen bekam er an Bord, als er sich in Südamerika beim Landgang so vollaufen ließ, dass er den Weg zurück an Bord nicht mehr fand. Er verirrte sich volltrunken auf einem Dschungelpfad, schlief dort ein und wachte erst auf, als ihm ein junger Alligator ein paar Zehen abgenagt hatte. So jedenfalls die Legende über „Alligator-Schorsch“ Nr. 1. „Alligator-Schorsch“ Nr. 2 war eine Zeitlang mein Zimmerkollege. Auch er war an Land ein absoluter Alkoholiker. Bei dem Zusammenleben in einem Zimmer hatte ich Gelegenheit, ihn näher kennen zu lernen. Er war 48 Jahre alt, hager und hatte ein faltiges, längliches Gesicht, blaue starre Augen und fuhr als Heizer. An Bord soll er überhaupt keinen Alkohol angerührt haben, ging unterwegs nie an Land und galt als überaus fleißig und zuverlässig. Er hatte außergewöhnlich lange Fahrzeiten und musterte nicht selten erst nach zwei Jahren Borddienst ab. War er jedoch erst einmal abgemustert, war sein Landaufenthalt nur eine einzige Sauforgie, und ich habe ihn ganz selten nüchtern gesehen.
Da er sein Gebiss im Suff immer etwa einen Zentimeter aus seinem Mund vorstehen ließ und starre Augen bekam, sah er tatsächlich wie ein Alligator aus. Daher mag sein Spitzname gerührt haben. Er trank grundsätzlich nur alleine, lud niemals jemanden ein und bevorzugte nur billige Kneipen. Aus Frauen machte er sich überhaupt nichts. Seine einzige Verwandte, eine 85jährige Tante, lebte nur zwei Häuserblocks entfernt vom Seemannsheim in der Rambachstraße. Da sie gehbehindert war und im 2. Stock wohnte, führte er jeden Abend, an dem er einigermaßen nüchtern war, ihren Hund „Gassi“. Schorsch trug immer einen langen, abgewetzten, braunen Ledermantel, der ihm bis zu den Knöcheln reichte. Er sah darin wie ein Gestapomann in einem schlechten amerikanischen Propagandafilm aus. Ich ahnte damals noch nicht, dass ihm dieser Mantel zum Schicksal werden sollte. Jeden Morgen warf er sich volltrunken auf sein Bett, um mittags wieder loszuziehen. Einmal kam er nachts mit einem riesigen herrenlosen Hund in unser Zimmer, und wir hatten große Mühe, das arme Vieh am nächsten Morgen wieder loszuwerden. Langsam stellte sich bei Schorsch auch eine Art Säuferwahn ein. Er litt unter der Furcht, jeden Moment könne ein Atomkrieg losbrechen.
Eines Tages kam ein kleiner Junge mit einem Zettel von Schorschs Tante zu mir ins Seemannsheim. Sie schrieb mir darauf, ihr Neffe habe ihr von mir erzählt und fragte mich, ob ich so freundlich sein würde, ihren Hund „Sherry“ abends auf die Straße zu führen. Ihr Neffe habe sich schon tagelang nicht mehr bei ihr blicken lassen, und sie sei zu gebrechlich, ihren Hund selber auszuführen. So lernte ich die alte Frau Petersen kennen. Sie wirkte auf mich wie die gute alte Großmutter in Filmen von Walt Disney: klein, rund, weißhaarig mit freundlichem Gesicht und blauen Kulleraugen, nur strickte und häkelte sie nicht mehr. Für ihr hohes Alter war sie geistig noch recht rege. Man musste nur laut sprechen, weil sie schon schwer hörte. Ihr Mann war Mitte der 30er Jahre mit einem Schlepper bei einem Orkan nahe des Feuerschiffes „Elbe 1“ untergegangen. Sie hatte nicht wieder geheiratet, hatte aber einige Zeit mit einem Rentner zusammengelebt, bis dieser verstorben war.
Sie lebte von einer bescheidenen Rente und ihr einziger Gesprächspartner war ihr kleiner Hund Sherry. Dieser war eine Promenadenmischung von undefinierbarer Rasse, aber sehr gescheit. Ihr einziger Sohn sei 1922 mit 24 Jahren nach Amerika ausgewandert. Seitdem hatte sie nie wieder etwas von ihm gehört. Sie erzählte mir immer wieder, wie sie ihn zusammen mit ihrem Mann zum Liegeplatz des Auswandererschiffes gebracht hätte und was er doch für ein hübscher und stattlicher Bursche gewesen sei. Ihr Mann habe ihm zum Abschied seine goldene Taschenuhr mitgegeben, so dass er sie im Notfall drüben hätte versetzen können. Das Schicksal sollte ihr noch einen furchtbaren Streich spielen. Mit ihrem Sherry hatte ich mich schnell angefreundet, und wir gingen jeden Abend pünktlich um 20 Uhr „Gassi“. Dafür machte sie mir anschließend ein ausgiebiges Abendbrot, wofür ich ihr sehr dankbar war, denn meine finanziellen Mittel waren stark begrenzt.
Da die Reedereien damals unter akutem Mangel an Schiffsoffizieren litten, vergaben sie an uns Studenten ab dem zweiten Semester großzügig Kredite. Voraussetzung war, dass man sich verpflichtete, nach dem Examen mindestens ein Jahr lang für diese Reederei zu fahren. Den Kredit konnte man dann in monatlichen Raten zurückzahlen. Wegen des Risikos, bei der Prüfung durchfallen zu können, war die Kredithöhe begrenzt. Ich hatte bei der Reederei Ernst Russ einen Antrag auf einen monatlichen Kredit von 250,- DM gestellt, der mir nach dem bestandenen ersten Semester zur Verfügung stehen sollte. Bis dahin musste ich sehr eingeschränkt leben und konnte mir manchmal kaum das nötige Fahrgeld für die Straßenbahn leisten, so dass ich dann gezwungen war, die fünf Kilometer Schulweg zu Fuß zu gehen. Ich beneidete damals diejenigen Studienkameraden, die reiche Eltern hatten und ihren Söhnen finanziell unter die Arme greifen konnten. Der Vorteil meiner Armut: Ich konnte es mir nicht leisten auszugehen, und so war ich gezwungen, in meinem Zimmer zu hocken und zu lernen.
Den Abschluss des ersten Semesters bestanden wir alle. Die Semesterfeier und das anschließende Besäufnis fand in der Baracken-Vereinskantine des Hamburger Polizeisportvereins am Sternschanzenpark statt. Wir hatten sie mit Bedienung und einer Zweimann-Musikband gemietet. Viele der Studienkollegen kamen mit ihren zukünftigen Ehefrauen, denn während der Schulzeit hatte der angehende Nautische Offizier in der Regel ausreichend Zeit, sich eine geeignete Frau zu suchen. Einige hatten bereits während der Matrosenzeit geheiratet, und so lernte ich bei dieser Semesterabschlussfeier auch ihre Ehefrauen kennen. Auch Papa Zeuner erschien mit Gemahlin und 16jähriger Tochter. Es wurde tüchtig gefeiert und getanzt. Da ich mit meinen 22 Jahren der zweitjüngste Lehrgangsteilnehmer war und noch nicht die Absicht hatte, mich dauerhaft zu binden, erschien ich also solo und tat mir hinsichtlich des Getränkekonsums keinen Zwang an. Wir bildeten angesichts der Feier einen Chor und sangen anfangs auch noch recht anhörbar. Mit zunehmender Ölung der Stimme kamen dann immer mehr Dissonanzen auf. Die Verheirateten brachen nach Mitternacht unter dem bestimmenden Einfluss ihrer Gattinnen zuerst auf. Dazu gehörte auch Papa Zeuner mit Familie. Irgendeine barmherzige Seele erbarmte sich später meiner und fuhr mich bis vor die Tür des Seemannsheimes, in dem ich am nächsten Tag mit sehr schwerem Kopf erwachte.
Da wir sechs Wochen Semesterferien hatten und ich mir finanziell keinen Urlaub leisten konnte, musterte ich für vier Wochen als Matrose auf dem Kümo „Hildegard Bülow“ an. Dieses Schiff war etwas größer als die üblichen Kümos, auf denen ich nie wieder hatte fahren wollen. Es war auch bereits mit Zweimannkammern ausgerüstet. Der Kapitän war Schwiegersohn des Eigners und noch recht jung. Er hatte vor noch nicht langer Zeit das große Kapitänspatent A6 gemacht, und ich verstand mich ausgezeichnet mit ihm. Seine Frau, nach der das Schiff benannt war, fuhr samt kleiner Tochter mit und kümmerte sich mit um das Essen. Da der Alte nur einen Steuermann hatte und daher selbst Wache gehen musste, überließ er mir auf freier See manchmal seine Wache. So konnte ich in der Praxis selbst erleben, was mich später als Nautischer Offizier auf der Brücke erwartete. Manchmal wenn ich in Bedrängnis zu sein glaubte oder Zweifel über die richtige Entscheidung hatte, rief ich ihn auf die Brücke, wie wir es vorher vereinbart hatten. Die vier Wochen gingen wie im Fluge dahin, und nach dem anstrengenden halben Jahr auf der Seefahrtschule kam mir diese Zeit wie ein Urlaub vor.
Da ich während der Zeit an Bord mein Zimmer im Seemannsheim aus Kostengründen aufgegeben hatte, musste ich mir dort nach meiner Rückkehr ein neues „Schülerzimmer“ nehmen. Bei der Gelegenheit erfuhr ich, dass sich „Alligator Schorsch Nr.2“, mein ehemaliger Zimmerkollege, während meiner Abwesenheit das Leben genommen hatte. Er hatte sich nur noch im „delirium tremens“ befunden und soll jeden Moment den „Atomschlag“ der Russen erwartet haben. Eines nachts hatte er sich die Pulsadern aufgeschnitten und noch zusätzlich mit dem Gürtel seines Ledermantels an der Türklinke aufgehängt. Die zweite erschütternde Neuigkeit erfuhr ich von der Frau Petersen. Sie hatte ihren verschollenen Sohn wiedergefunden. Er war damals im Jahre 1922 nicht nach Amerika ausgewandert, sondern hatte 36 Jahre lang als Landstreicher in Deutschland gelebt. Das Sozialamt hatte seine Mutter ausfindig gemacht und ihn zu ihr geschickt. Sie klagte darüber, er sei ein 60 Jahre altes, wimmerndes, dem Alkohol verfallenes Wrack geworden, das sie bei jedem Besuch um Geld anbettele. Als ich sie besuchte, weinte sie ganz bitterlich und sagte mir, dass sie ihm kein Geld geben könne, da er alles sofort versaufen würde. Das Sozialamt führte ihren Sohn unter der Rubrik „Hoffnungslose Fälle“. Die arme Frau musste die beiden schweren Schicksalsschläge erst noch verkraften, den Freitod ihres Neffen und dann das Wiedersehen mit ihrem verkommenen Sohn. Sie war froh, dass ich wieder da war und ihren Sherry jeden Abend pünktlich ausführte.
Auch „Alligator-Schorsch Nr.1“ ereilte das Schicksal, am Anfang in tragischer, doch anschließend in positiver Weise. Einer meiner Bekannten saß mit ihm eines Tages im „Cap Hoorn“, einer Kneipe auf der Reeperbahn, an der Theke, wo sie beide einen halben Liter Bier nach dem anderen leerten. Plötzlich holte Alligator-Schorsch unbemerkt eine Selbstladepistole der Marke Walther aus der Tasche und hantierte an ihr herum. Irgend etwas funktionierte wohl nicht an der Waffe, denn Schorsch klopfte kräftig mit ihr an die Theke. Dabei lösten sich plötzlich zwei Schüsse, die ihn in den Bauch trafen. Der Wirt und alle seine Gäste sollen wie erstarrt dagesessen haben, als Schorsch die Pistole seelenruhig zurück in die Tasche steckte, nach seinem Bierglas langte und es in einem Zug austrank. Dann bat er den Wirt, einen Krankenwagen zu rufen und fiel danach vom Barhocker. Die Ärzte kämpften eine Woche lang um sein Leben, bis sie ihn über den Berg hatten. Nach diesem Unfall soll er ein anderer Mensch geworden sein. Er soll die Seefahrt an den Nagel gehängt und das Saufen aufgegeben haben. Man erzählte mir dann auch, dass er aus einer alten Pastorenfamilie komme und sein Vater immer noch Pastor sei. Jedenfalls muss ihm diese Verbindung einen guten Schutzengel beschert haben. Später hörte ich, er sei inzwischen glücklich verheiratet und habe einen Haufen Kinder.
Da ich noch zwei Wochen Ferien hatte, arbeitete ich zehn Tage bei der Schiffs- und Tankreinigungs-Firma Schwarzmann. Diese Firma hatte auch den Auftrag, die großen Ladebrücken bzw. Kräne an der Kalikai in Reete zu entrosten und zu malen, wozu ich eingeteilt war. Da diese Arbeitsstelle im abgelegensten Winkel des Hamburger Hafens lag, musste ich bereits um 6 Uhr früh mit der Fähre vom Baumwall aus losfahren, um pünktlich um 7 Uhr zum Arbeitsbeginn an Ort und Stelle zu sein. Wir waren acht Mann, die dort neu eingesetzt werden sollten. Da man als Seemann damals als ungelernt galt, wurde vom Arbeitsamt ohne Rücksicht auf Rang und Alter vermittelt. Zu solchen Einsätzen schickte man besonders die „schwarzen Schafe“, Seeleute, die sich bei Reedereien einen schlechten Namen gemacht hatten und deshalb schwer vermittelbar waren. Unsere Gruppe der neu Anfangenden bestand aus fünf Seeleuten, drei Matrosen, einem Koch und einem Steward. Die übrigen drei waren Landratten.
Der Vormann war ein hagerer dunkelhaariger Mann Mitte vierzig mit dem Gesichtsausdruck eines Magenkranken. Er musterte uns illusionslos und schickte uns, mit Sicherheitsleine, Rosthammer, Roststecher und Rostbürste ausgerüstet, in das 50 Meter hohe Krangerüst. Wir turnten mit etwa zwanzig Mann da oben herum, um die Streben zu entrosten. Gleich nach Arbeitsbeginn fing das Malheur an. Der Koch, ein kleines zierliches etwa 50jähriges Männchen, der vielleicht als Junge das letzte Mal auf einen Baum geklettert war, bekam in der für ihn ungewohnten Höhe einen Schwindel- und Schreianfall. Er klammerte sich voller Angst an einer Strebe fest, und vier Mann hatten alle Mühe, ihn, nachdem sie ihm die Augen verbunden hatten, in zwei Stunden Schwerstarbeit, Schritt für Schritt auf die sichere Erde zurückzubringen. Auch ich muss gestehen, dass mir die ungewohnte Höhe zuerst etwas zu schaffen machte, denn ich stellte fest, dass mir in der Mittagspause die Knie zitterten. Es war ein wilder Haufen, der da arbeitete. Er bestand aus entlassenen Häftlingen, Asozialen, Seeleuten und anderen Außenseitern der Gesellschaft. Aber auch ein Jurastudent war darunter. Der Vormann warnte uns vor Diebstählen und wir trugen unsere paar Kröten deshalb lieber am Leibe.
Der Gefährlichste von allen war Georg, ein ehemaliger Catcher, der im „Pik-As“, dem bekannten Hamburger Obdachlosenheim, wohnte. Er war ca. 1,90 m groß, ca. 30 Jahre alt, blond, massig und wog gut 150 kg. Seine Oberarme waren so dick wie meine Schenkel, und er hatte Kräfte wie ein Stier. Als Catcher war er einmal aus dem Ring auf den Kopf gefallen und hatte seitdem einen „Dachschaden“. Er arbeitete schon länger bei der Firma und war eine wandelnde Zeitbombe. Sein Aussehen war bedrohlich und furchteinflößend. Er hatte kleine tückische Schweinsaugen und schaute man ihn aus irgend einem Grunde zu lange an, bekam er einen Wutanfall und man tat gut, ihm dann sofort aus dem Weg zu gehen. Da er ein guter und zuverlässiger Arbeiter war, tolerierte der Vormann seine Aggressivität, denn die meisten in unserer Gang waren echte Drückeberger. Sie nutzten jede Gelegenheit, sich vor der Arbeit davonzustehlen. Den meisten Neuankömmlingen machte auch die ungewohnte Höhe des Arbeitsplatzes zu schaffen, so dass viele am nächsten Tag nicht wieder zur Arbeit erschienen. Es wunderte mich nicht, dass unser Vormann bei einem solchen Personal unter Leistungsdruck stand und einen magenkranken Gesichtsausdruck hatte. Ich war einer der Wenigen, die immer pünktlich zur Arbeit erschienen und ihr Soll erfüllten.
Eines Tages, wir arbeiteten gerade wieder in 50 Meter Höhe, explodierte unsere „Zeitbombe“ Georg. Wir hatten in unserer Gang einen ca. 35jährigen schlanken Matrosen, der erst seit zwei Tagen bei uns war. Wider besseren Wissens hatte er es auf Georg abgesehen. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit hänselte er ihn und machte sich einen Spaß daraus, ihn mit dem Neandertaler zu vergleichen. Ich sah, wie Georg plötzlich zuschlug - und wenn Georg zuschlug, dann war das vergleichbar mit dem wuchtigen Huftritt eines Pferdes. Unser Matrose wurde wie von einem Katapult in die Luft geschleudert und blieb an seinem Sicherheitsgurt in 50 Metern Höhe hängen. Wir waren alle geschockt und brauchten einige Zeit, um unsern halbbetäubten Arbeitskollegen sicher auf die Erde hinunterzubringen. Er hatte großes Glück gehabt, denn außer einer Gehirnerschütterung, einigen geprellten Rippen und blau angelaufener Kinnspitze hatte er keine weiteren Verletzungen. Gott sei Dank hatte der Sicherheitsgurt gehalten, sonst wäre unser Matrose „unter die Harfenspieler gegangen“. Georg hatte übrigens weitergearbeitet, als ob nichts besonderes geschehen wäre. Nach diesem Vorfall musste unser Vormann Georg schweren Herzens entlassen, auch wenn er dadurch einen guten und zuverlässigen Arbeiter verlor. Kurz vor dem Wochenende spielte sich ein weiteres Drama ab. Einer der ganz neuen Zugänge, ein verzweifelt aussehender Mann von etwa 45 Jahren, erhängte sich in einem unbeobachteten Moment in unserem Farben- und Werkzeugraum. Für mich war dies auch mein letzter Arbeitstag, da am Montag mein Studium wieder anfangen sollte. Der Vormann bedauerte mein Ausscheiden und nachdem ich meinen Lohn für zehn Tage ausgezahlt bekommen hatte, wünschten wir uns gegenseitig alles Gute. Ich meinte meinen Wunsch besonders ernst, denn wenn es bei ihm das ganze Jahr so zuging wie in diesen zehn Tagen, konnte ich ihn nur bedauern.
Zum Studienbeginn waren wir alle pünktlich zu unserem Lehrgang erschienen. Da ich jetzt durch meinen Kredit von der Reederei Ernst Russ monatlich 250,- DM zur Verfügung hatte, ging es mir finanziell bedeutend besser als vorher, aber noch lange nicht gut. Kurz vor Monatsende musste ich noch immer meinen Gürtel enger schnallen, brauchte die fünf Kilometer aber nicht mehr täglich zu Fuß zur Seefahrtschule gehen, sondern konnte mir immer die Straßenbahn leisten. Unsere Dozenten nahmen uns im letzten Semester tüchtig heran, und so blieb uns wenig Freizeit übrig. Einige unserer Lehrer waren wirklich Koryphäen und Originale. Der Dozent für Seerecht, Kapitän Haamann, der selbst Lehrgangsleiter war, konnte z.B. die Logarithmen von eins bis hundert aus dem Kopf aufsagen und galt als mathematisches Wunder. Ein besonderes Original war unser Dozent für Seemannschaft. Auch er war ein befahrener Nautiker und eine Seele von Mensch. Er war etwa 50 Jahre alt, hatte schütteres graues Haar, sprach immer sehr langsam und hatte eine Ruhe weg, die schon unnatürlich war. Er war Eigner eines kleinen Küstenmotorschiffes. Wenn das Gespräch beim Unterricht auf Kümos oder Küstenschifffahrt kam, wurde seine Macke deutlich: Während der ganzen weiteren Unterrichtsstunde wurde dann über nichts anderes mehr gesprochen, und das eigentliche Unterrichtsthema geriet in Vergessenheit.
Bei den Klausuren zensierte er aber immer knallhart. Anschließend wunderte er sich dann über unser schlechtes Abschneiden, da wir das gestellte Thema ja laut Klassenbuch durchgenommen hatten. Eine Parallelklasse spielte ihm einen Streich. Vielleicht wollten sie ihm auch einen kleinen Denkzettel verpassen. Als unser Dozent sein Auto, einen Mittelklassewagen, wie üblich am Straßenrand geparkt hatte, wuchteten sie es in Handarbeit auf die andere Straßenseite ins absolute Parkverbot. Wie man sich anschließend erzählte, sah man „Albert“, wie er allgemein genannt wurde, kopfschüttelnd und Selbstgespräche führend vor seinem Wagen stehen. Papa Zeuner berichtete uns dann, dass „Albert“ jedem im Kollegiumzimmer erzähle, dass er doch genau wisse, seinen Wagen richtig geparkt zu haben und tagelang über das Rätsel nachgedacht habe. Seine Macke blieb jedoch auch nach diesem Vorfall. Das Stichwort „Kümo“ brachte ihn jedes Mal wieder aus der Reihe.
Am Weihnachtstag 1958 war unser Seemannsheim am Wolfgangsweg fast ausgestorben. Die meisten verbrachten den Heiligen Abend bei ihren Familien, Bekannten oder Bräuten. Einige wenige, die keine Angehörigen hatten und noch bei Kasse waren, feierten auch in irgendeiner Kaschemme auf der Reeperbahn. Für uns Verbliebene etwa acht Mann veranstaltete unser Heimleiter, Diakon Otto Brunschede, eine kleine Feier im Aufenthaltsraum. Jeder von uns bekam einen Bunten Teller und man konnte bis Mitternacht beim Punsch zusammensitzen. Auch der Heimleiter, der Seemannspastor und die Angestellten aus der Küche verabschiedeten sich dann von uns und gingen zu ihren Familien. Wir Verbliebenen waren schon ein verlorener Haufen, und mir kam zu diesem Zeitpunkt wieder mal richtig zum Bewusstsein, was es heißt, Vollwaise zu sein. Um 22 Uhr schlich auch ich mich davon und lernte auf meinem Zimmer die astronomische Kompasskontrolle.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch einen bemerkenswerten Menschen aus dem Büro des Seemannsheimes erwähnen. Er arbeitete in der Verwaltung und wir alle nannten ihn nur „Vater Philipp“. Der Mittfünfziger war für das Kassieren der Mieten zuständig, und sein Sohn fuhr auch zur See. Man konnte jederzeit mit seinen Sorgen zu ihm kommen, und er half einem immer, so gut er konnte. Stets hatte er ein Herz für die Sorgen und Nöte der Seeleute, ähnlich wie unser Heimleiter. Als Vater Philipp an den Folgen eines Unfalls starb, soll seine Beerdigung sehr bewegend gewesen sein. Fast alle Seeleute aus dem Heim waren anwesend, und es gab keinen, der seinen Tod nicht bedauerte.
Die Prüfungszeit für unser Examen begann im Januar 1959 und erstreckte sich bis Februar. Durch die vielen Klausuren und mündlichen Prüfungen waren wir alle stark mitgenommen, und bis zum Abschlussexamen hatten wir wohl alle einige Pfund abgenommen. Bis auf einen, unseren Jüngsten, bestanden wir alle die Prüfung. Dem Durchgefallenen wurde mangelnde Reife vorgeworfen, aber wie ich später hörte, schaffte er es im zweiten Anlauf. Die Zeugnisse wurden uns vom Direktor in einer feierlichen Zeremonie ausgehändigt. Sie berechtigten uns, das Patent A5II („Zweiter Steuermann auf Großer Fahrt“), bei der Behörde für Wirtschaft und Verkehr abzuholen. An die Abschlussfeier am 19. Februar kann ich mich nicht mehr so genau erinnern, aber sie soll ein großes Besäufnis geworden sein. Vielleicht daher meine Erinnerungslücken.
Hinter dem Mast
„Vor dem Mast“ fuhr man als Mannschaftsgrad. „Hinter dem Mast“ fuhren nur der Kapitän und die Offiziere. Diese Redewendungen der alten Seemannssprache stammen noch aus der Segelschiffszeit und hatten sich bis in die moderne Dampf- und Motorschiffzeit erhalten und kamen erst in den letzten Jahren aus dem Sprachgebrauch. Mit der Aushändigung meines Patentes A5II gehörte ich von nun an zu denen, die „hinter dem Mast“ fuhren. Das Patent, jetzt im Behördendeutsch „Befähigungszeugnis“ genannt, war ein schlichtes grünes Faltblatt im Führerscheinformat und sah recht unansehnlich aus. Im Leben hängt vieles vom Zufall ab, und zufälligerweise brauchte meine Reederei, als ich mich dort sofort nach dem Examen meldete, dringend einen 2.Offizier. Das Schiff vom Typ der „Potsdamklasse“ (siehe „Hasselburg“) lag in Hamburg-Waltershof vor Order an den Pfählen, das heißt nach einer alten Segelorder, es lag auf Abruf bereit und konnte jederzeit auslaufen. Normalerweise beginnt der frisch gebackene Nautiker nach dem Studium zunächst als 3.Offizier. Bewährt er sich an Bord, kann er nach einem Jahr Dienstzeit zum 2.Offizier befördert werden und nach zwei Jahren Fahrzeit sein Kapitänspatent A6 („Kapitän auf Großer Fahrt“) machen. Aber Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel.
2.Nautischer Offizier auf der „E. Russ“
So fing ich am 20. Februar 1959 meinen Dienst als 2.Offizier an Bord des Dampfschiffes „E. Russ“ an. Da ich schon als Matrose auf zwei Schiffen dieses Typs gefahren war, kannte ich mich an Bord gut aus und hatte keine Schwierigkeiten, mich zurechtzufinden. Als ich mich bei meinem zukünftigen „Herrn und Meister“ melden wollte, stellte sich heraus, dass übers Wochenende außer einem „Hafenwachoffizier“ und einem „Wachingenieur“ keiner der regulären Offiziere an Bord war. Der Steward zeigte mir meine Kammer, einen gemütlichen Raum mittschiffs an der Backbordseite mit Bett, Schrank, Tisch und einer kleinen Sitzbank, die man auch als Sofa benutzen konnte. Auch hatte die Kammer ein Waschbecken mit Warm- und Kaltwasser. Was für ein Unterschied zu den engen stickigen Löchern der Mannschaft achtern unter der Poop, die man Kammern nannte und die ich selbst noch vor nicht langer Zeit mit einem Kollegen geteilt hatte. Erst jetzt, als ich das saubere Bettzeug, die Handtücher und ein neues Stück Seife auf dem Waschbecken sah, kam mir so richtig zum Bewusstsein, dass ich nun zu denen gehörte, die „hinter dem Mast“ fuhren.
Der „Hafenwachoffizier“, ein pensionierter Reedereiveteran, der nicht mehr zur See fuhr und durch die Hafenwachen seine Rente aufbesserte, übergab mir die Hafenwache. Er erzählte mir, dass die Besatzung bis auf den 3.Offizier vollständig sei und die Reederei dabei sei, einen „Dritten“ zu suchen. Das Schiff läge hier vor Order, und es würde wahrscheinlich nächste Woche eine „Time-Charter“ nach Kanada abgeschlossen werden. Ich erfuhr auch, dass der Kapitän Schmidt hieß. Er fragte mich auch, ob ich schon von ihm gehört hätte und als ich dies verneinte, schaute er mich so merkwürdig an, ging aber nicht mehr näher darauf ein. Erst als ich noch am selben Tag den Koch kennen lernte, wusste ich, was dieser merkwürdige Blick zu bedeuten hatte. Der Koch war ein baumlanger Ostpreuße, der während des Krieges bei den Fallschirmjägern war und nach dem Krieg zum Schiffskoch umgesattelt hatte. Er war ca. 40 Jahre alt und fuhr schon einige Zeit bei der Reederei. Er erzählte mir nun, dass wir unter dem Kommando von „Leichen-Willy“, auch „Rucksack-Willy“ genannt, fahren würden. Er berichtete mir die haarsträubendsten Geschichten, die er mit ihm erlebt hatte. Ohne vorgreifen zu wollen, kann ich durch eigene spätere Erlebnisse bestätigen, saß seine Schilderungen nicht übertrieben waren.
Die Reederei Ernst Russ war ein altes, 1893 gegründetes, angesehenes Schifffahrtsunternehmen mit einer Flotte von über 20 Schiffen, die weltweit operierten, davon etwa fünf kleinere Frachtschiffe, die von Hamburg im Liniendienst nach Finnland fuhren.
Wie damals jede alteingesessene Reederei besaß auch die Firma Ernst Russ einen Stamm langgedienter Leute. Einige hatten es sogar bei der Reederei vom Moses bis zum Kapitän gebracht, und es gab auch richtige Originale darunter. Ein Kapitän war unter dem Namen „Hein Gröl“ bekannt, ein anderer wurde nur „Balle-Schmidt“ (nach der Rum-Marke) genannt und natürlich unser „Rucksack-Schmidt“ alias „Leichen-Willy“. Wie unser Willy zu seinem Spitznamen kam, darüber gab es viele Versionen. Einige Leute meinten, weil unser Willy laufend „Säcke“ (Entlassungen) verteile, was durchaus zutraf, sei er zu dem Namen gekommen. Die wahrscheinliche Ursache rührte wohl aus der Zeit seiner Kriegsgefangenschaft in Jamaika her, wo er immer mit einem Rucksack herumgelaufen sein soll, damit er seine Habseligkeiten vor Diebstahl sichern konnte. Auch die Bezeichnung „Leichen-Willy“ sollte aus dieser Zeit stammen. Er soll der einzige gewesen sein, der sich um die Beerdigung der verstorbenen Kameraden gekümmert habe und um die Benachrichtigung der Angehörigen über das Rote Kreuz, was ihm durchaus zur Ehre gereicht. Beide Spitznamen schufen jedoch eine negative Aura um ihn, und seine Persönlichkeit trug nicht dazu bei, dieses Negativimage abzubauen. Im Gegenteil, er wurde zum gefürchtetsten Kapitän der Flotte, und niemand mochte unter ihm fahren, denn das brachte immer eine Menge Ärger und Aufregung mit sich. Nach allem, was ich zu hören bekam, rechnete ich mir keine lange Fahrzeit an Bord dieses Schiffes aus, womit ich auch recht behalten sollte. Der Grund war aber ein anderer. Ich ahnte jedoch noch nicht, dass meine Dienstzeit bei der Reederei Ernst Russ neun Jahre währen würde. Sie wurde eine der besten Zeiten meiner langjährigen Seefahrtskarriere. Wie ich weiter zu hören bekam, war Ernst Russ eine sehr konservative Reederei, die von ihren Offizieren im Hafen Pünktlichkeit erwartete. Wie mir der Koch erzählte, kam es nicht selten vor, dass die Reedereiinspektion Punkt 8 Uhr an Bord erschien und die Anwesenheit der Offiziere überprüfte. Wehe, wenn der Wachoffizier bzw. -Ingenieur nicht anwesend war oder „in Sauer“ in der Koje lag!
Pünktlich zum Arbeitsbeginn am Montag Morgen fanden sich also meine neuen Kollegen an Bord ein, und so lernte ich als ersten meinen unmittelbaren Vorgesetzten, den 1.Offizier, kennen. Der „Erste“, wie er gewöhnlich an Bord genannt wurde, war ein vierschrötiger, großer Mann, Mitte der vierzig und kam aus der Gegend von Stade. Er war gut gebaut und „langte auch mal kräftig hin“, wenn es angebracht war. So jedenfalls erzählte man es sich an Bord. Irgendwann muss er mal zu oft hingelangt haben, denn er fuhr noch immer als 1.Offizier, sollte aber demnächst Kapitän werden. Er war kein Mensch, mit dem leicht auszukommen war, und es steckte viel Bitternis in ihm. Wahrscheinlich war er schon zu oft bei der Beförderung zum Kapitän übergangen worden. Ich sollte jedoch sehr gut mit ihm auskommen. Nach und nach lernte ich auch die anderen Offiziere kennen. Der Leitende 1.Ingenieur hieß Falk und war ein typischer „Dampfer-Chief“, der schon ein Leben lang bei der Reederei fuhr. Er war Anfang sechzig, ausgeglichen und wartete sehnsüchtig auf den Tag seiner Pensionierung. Auch der 2.Ingenieur war schon ein älterer Herr und hieß Schwidrowski. Er war Ende fünfzig und hatte nur auf Dampfschiffen gefahren. Da es immer weniger Dampfschiffe gab, hatte er schon die Hoffnung aufgegeben, jemals Chief zu werden. Ich erwähne die beiden besonders, denn wir drei sollten, auch wenn ich damals mit 23 Jahren der jüngste Offizier an Bord war, gute Freunde werden, die immer zusammen an Land gingen und auch einen zusammen tranken. Man nannte uns später an Bord „die drei Musketiere“. Beide waren verheiratet und fuhren schon vor dem Krieg bei der Reederei.
Auch der Funkoffizier, den man an Bord gewöhnlich „Sparky“ nannte, gehörte zum Reedereiinventar. Über seine amourösen Abenteuer in der Südamerika-Fahrt erzählte man sich die unglaublichsten Geschichten. Eine dieser Storys war reedereiweit im Umlauf und machte auf allen Schiffen die Runde. Er hatte in einem brasilianischen Hafen eine dieser feurigen Señoritas mit an Bord genommen und lag mit ihr in einer unmöglichen Liebesstellung in seiner Koje. Als die Dame unter ihm während ihres orkanartigen Orgasmus seinen Hintern mit aller Kraft hochdrückte, bekam sein Hinterteil minutenlang Berührung mit der heißen Kojenlampe am Kopfende. Dabei zog er sich eine sehr schmerzhafte Verbrennung zu. Sein furchtbarer Schrei, der durch das ganze Schiff hallte, veranlasste den Kapitän, die Tür aufbrechen zu lassen. Dabei kam dann die Geschichte heraus.
Ich stellte fest, dass keiner der Offiziere mich frisch von der Schule kommenden Neuling mit Geringschätzung oder Herablassung behandelte. Gegen Mittag lernte ich auch unseren Alten kennen. Unser „Master next God“ war ein kleiner, stämmiger, grauhaariger Mann von 50 Jahren mit blassen blauen Augen und einer etwas quäkenden Stimme. Er kam, wie mir bereits vorher angekündigt, mit seinem ständigen Begleiter an Bord. Das war ein mittelgroßer grauer Schnauzer-Rüde mit Namen „Rhino“, der ihn auf Schritt und Tritt begleitete. Man hatte mir schon erzählt, dass das Tier durch die schnell wechselnden Launen seines Herrn hochgradig neurotisch und unberechenbar geworden war. Unseren Alten konnte man mit Sicherheit als einen unangenehmen Menschen und Choleriker bezeichnen. Er provozierte, beleidigte und scheuchte jeden an Bord und konnte sich auf Grund seiner Stellung damals so ziemlich alles ungestraft erlauben. Seine Ausbrüche erfolgten in einer gewissen Regelmäßigkeit und nach einem bestimmten Modus. Man konnte sich mit der Zeit darauf einstellen. Am zutreffendsten beschrieb ihn unser Chief, als er meinte, wenn unser Alter in einer ländlichen Idylle einige Hühner zusammen mit ihrem Hahn friedlich fressen sehen würde, könne er nicht widerstehen, einen Stein dazwischen zu werfen, nur um den Frieden zu stören. Bei all diesen negativen Eigenschaften hatte er auch eine gute Seite: Er war nicht nachtragend, und am nächsten Tag war immer alles vergessen. Ohne diese positive Seite an ihm hätte man den Stress auf die Dauer auch nicht ertragen können. Als Begrüßung sprach er mich auf mein neues Patent A5II an, indem er meinte, dass wohl nach dem „A5halbe“ nun bald das „A5viertel“ und später die „Achtelnautiker“ kommen würden. Das neue Patent wurde also bei den noch „richtigen“ Nautikern herabgewürdigt.
An meinem ersten richtigen Arbeitstag an Bord wirbelte unser Alter alles durcheinander und man hatte Mühe, seinen Anordnungen zu folgen. Da ich als 2.Offizier außer für die nautische Ausrüstung, wie etwa die erforderlichen Seekarten, auch für den Proviant verantwortlich war, nahm er sich zuerst den Koch und dann mich vor. Nachdem er den Koch wegen des Zustandes der Kombüse, die übrigens tipp topp sauber war, „zur Sau“ gemacht hatte, kam ich an die Reihe. Er hielt mir einen langen Vortrag über meine zukünftigen Pflichten als Proviant- und Navigationsoffizier und was mich alles erwarten würde, sollte ich diesen Pflichten nicht nachkommen. Als nächster war der 1.Offizier an der Reihe, und so ging es weiter bis er beim Bootsmann angelangt war. Sein Hund war immer dabei und je mehr sich der Alte in Rage steigerte, desto feindlicher und böser blickte der einen an, bis er schließlich zu knurren begann, um sich dann anschließend mit wildem Gebell auf einen zu stürzen. Im letzten Moment hinderte ihn der Alte dann mit einem Fußtritt daran, dass er zubiss. Wie ich später erfuhr, hatte der Alte keine Kinder und seine Frau und er hielten sich den Hund als Kinderersatz. Ich traue mich nicht, mir auszudenken was aus den Kindern bei solchem Vater geworden wäre, hätte er tatsächlich welche gehabt. So blieb der Welt einiges erspart.
Inzwischen erfuhren wir vom Alten, dass wir uns mit Beginn der kommenden Woche in einer „Time-Charter“ befinden würden, das bedeutete, dass irgendeine Charterfirma oder andere Reederei unser Schiff für einen bestimmten Zeitraum von unserer Reederei gemietet hatte. Da wir nur eine Reise mit Stückgut von Europa nach Halifax und St. Johns in Kanada machen wollten, bekam die Reederei auch nur für diese Zeitdauer bezahlt. Die ganze Woche waren wir mit der Vorbereitung der Reise beschäftigt. Wir übernahmen Proviant und Ausrüstung und bunkerten den Treibstoff. In meiner Verantwortung lag es auch, dafür zu sorgen, dass die nötigen Seekarten, Seehandbücher, Gezeitentafeln ect. an Bord und auf dem neuesten Stand waren. Außerdem musste ich mir auf Reedereianweisung eine Uniform zulegen, für die ich einen monatlichen Reedereizuschuss erhielt. Als 2.Offizier war ich auch Messevorstand für die Offiziersmesse, und zu meinen Aufgaben gehörte es unter anderem, dafür zu sorgen, dass jeder ordentlich und sauber angezogen in die Messe kam. Auch den Messesteward musste ich beaufsichtigen und dafür sorgen, dass er seinen ihm aufgetragenen Pflichten ordentlich nachkam. Dies alles bedeutete für mich eine totale Umstellung aus meinem bisherigen Milieu, und ich musste mich erst in meine neue Rolle hineinfinden und an sie gewöhnen. Ich sollte noch oft zu hören bekommen, dass ich meine „Matrosenallüren“ nun ablegen müsse.
Zwei Tage vor Ladebeginn kam auch ein neuer 3.Offizier an Bord, und zu meinem Erstaunen war es ein Klassenkamerad aus meinem Lehrgang. Ich hatte ihm während unserer gemeinsamen Schulzeit nie besondere Beachtung geschenkt, da er erst im letzten Semester zu uns gekommen war. Er war aus einem anderen Lehrgang zu uns gestoßen, in dem er die Abschlussprüfung nicht bestanden hatte und musste das ganze Semester bei uns wiederholen. Damals war, auch wenn man nur in einem Fach durchgefallen war, das ganze Semester nachzustudieren. Er war immer ein magerer, sehr ruhiger Mensch gewesen, der nie besonders aufgefallen war. Nur bei der Abschlussfeier hatte er einiges Erstaunen hervorgerufen, als er mit seiner vollbusigen rothaarigen Verlobten erschien. Er war natürlich auch sehr erstaunt, mich hier als zweiten Offizier vorzufinden, und in der kurzen Zeit, die wir zusammen fuhren, kamen wir uns nie irgendwie näher. Er entwickelte von seiner Seite aus eine Art Konkurrenzdenken mir gegenüber, was selbst dem Alten und dem 1.Offizier manchmal zuviel wurde. Las ich z.B. den achteren Tiefgang ab und meldete ihn dem 1.Offizier, so kam er kurze Zeit nach mir zu ihm und meldete einen um angeblich 1/10 Inch genaueren. Einmal lasen der 1.Offizier und ich gemeinsam den Tiefgang ab, was er nicht wusste. Als er anschließend mit seinen Zahlen erschien, platzte dem Ersten der Kragen, und es herrschte fortan so eine Art Burgfrieden zwischen uns.
Unser erster Ladehafen war Hamburg, und wir verholten das Schiff an den Schuppen 71 im Kaiser-Wilhelm-Hafen, wo wir einen Teil des Stückguts übernehmen sollten. Meine Station war während des Ab- und Anlegemanövers am Heck und die des 3.Offiziers vorne auf der Back. Als Mannschaftsgrad hatte ich bisher während solcher Manöver Befehle empfangen, nun musste ich welche geben und darauf achten, dass sie richtig befolgt wurden. Ich musste mich auch beherrschen, wenn etwas nicht klappte, selbst an die Leinen und Winden zu gehen. So sehr steckte noch der Matrose in mir. Von Hamburg ging es nach Rotterdam, Antwerpen und Liverpool. Da wir beiden „Neunautiker“ noch nie eine selbständige Wache gegangen waren, teilten sich der Alte und der Erste die Wachen zu je sechs Stunden, um uns einzuweisen. Ich hatte Wache mit dem 1.Offizier von 12 bis 18 Uhr und dann von Mitternacht bis 6 Uhr früh. Von Antwerpen nach Liverpool waren wir nach der Passage des Englischen Kanals uns selbst überlassen.
Die „E. Russ“ war auch nach damaligem Standard nautisch sehr dürftig ausgerüstet. Wir hatten zwei Magnetkompasse, einen auf dem Peildeck zur Kontrolle und einen zum Steuern im Ruderhaus, außerdem einen Funkpeiler mit Rahmenantenne, wie er schon Anfang der 30er Jahre im Gebrauch war, ein Echolot und ein altes Röhrenradargerät. Letzteres durfte bei Nebel und bei der Ansteuerung nur auf Anweisung des Alten benutzt werden. Lief es mehr als zwei Tage durch, fiel es garantiert aus. Es war ein altes Kriegsnachfolgegerät der Marke „Pathfinder“, und wir führten immer einen ganzen Satz Ersatzröhren mit uns. Bei Ausfall wurden die Röhren eine nach der anderen ausgewechselt, bis das Gerät wieder anzeigte. Blieb es blind, was meistens der Fall war, musste im nächsten Hafen der Reparaturservice bestellt werden. Das Schiff hatte auch keine Selbststeueranlage für lange Passagen und musste immer per Hand gesteuert werden. Wir besaßen damals auch noch kein UKW-Telefoniegerät und der Lotse musste am Tage mit der Signalflagge „G“ und nachts mit der Morselampe gerufen werden.
Die einzige Sprechverbindung von der Brücke zum Kapitän und zum Maschinenraum bestand aus zwei Sprechrohren. Diese Messingrohre waren fest auf der Brücke installiert und führten zum Schlafraum des Kapitäns und zum Manöverstand des Maschinenraumes. An beiden Enden der Rohre steckten Pfeifen und Stöpsel. Zog man an einem Ende den Stöpsel heraus und blies kräftig ins Rohr hinein, ertönte am anderen Ende ein Pfeifsignal. Wurde auch dort der Stöpsel herausgezogen, konnte man durch das Rohr sprechen. Diese Sprechverbindung sollte mir später noch einigen Ärger bereiten. Für die astronomische Navigation standen uns zwei Sextanten und ein Chronometer zur Verfügung, der jeden Tag manuell aufgezogen werden musste. Seine Abweichung wurde jeden Tag durch Funksignale kontrolliert. An der Küste wurde terrestrisch navigiert, wobei nach alter Väter Sitte der Standort durch Funkpeilung, Kreuzpeilung, Vierstrichpeilung usw. bestimmt wurde.
Während des Ladens in Liverpool sahen wir unseren Alten sehr wenig, da er durch das Einlaufen und die Behördenabfertigung sehr ermattet war und im Hafen seine Ruhephase hatte. Unsere Ladung bestand aus einem Sortiment von Maschinenteilen, Kisten, Rohren, Sackgut, Kraftfahrzeugen, Reifen ect. Da der 1.Offizier zugleich Ladungsoffizier war, hielt er uns ganz schön in Trab. Wir standen den ganzen Tag an Deck und mussten auf kleinen Zetteln die verschiedenen Positionen der Ladung in den Luken notieren, von denen sie dann auf einen Generalstauplan übertragen wurden. Nach dem Laden beaufsichtigte ich zusammen mit dem 3.Offizier das Laschen bzw. Festzurren der Ladung in den Laderäumen durch unsere Crew. Wir waren alle froh, dass wir keine Decksladung hatten, denn eine Überquerung des Nordatlantik im Winter ist auch für größere Schiffe keine angenehme Reise und erst recht nicht mit unserem „Bügeleisen“.
Nachdem wir nach dem Auslaufen von Liverpool den Lotsen abgegeben hatten und Holyhead passiert hatten, begann für uns alle der Seealltag. Als 2.Offizier hatte ich die „Hundewache“, die, wie schon erwähnt, von Mitternacht bis 4 Uhr morgens und von Mittag bis 16 Uhr ging. Ich hatte einen Vollgrad und einen Leichtmatrosen auf meiner Wache, die sich Stunde um Stunde am Ruder ablösten und Ausguck gingen. Nach Passieren von Galley Head an der Südspitze von Irland traten wir von der Irischen See in den Nordatlantik ein, der sich von seiner ruhigen Seite zeigte. Von seiner typischen Seite zeigte sich unser Alter. Es ging täglich nach dem gleichen Modus: Herrschte bis ca. 9 Uhr morgens eine himmlische Ruhe an Bord, so wurde plötzlich die Tür des Alten aufgeschleudert, so dass sie mit Wucht gegen die Wand prallte und die ganze Steuerbordseite erbebte. Kurz darauf ertönte seine schrille Stimme durch das ganze Mittelschiff: „Steward! Kaffee!“ Unser Herr und Meister war erwacht.
Gleich danach raste er mit dem Hund die Treppe hinunter zur Kombüse und stauchte aus irgend einem Grund den Koch zusammen. Danach flitzte er übers Bootsdeck zur Brücke hoch, wo er den 3.Offizier „zur Sau“ machte. Ein Grund war immer vorhanden und sei es, dass die Bleistifte nicht richtig angespitzt waren oder eine andere Kleinigkeit seinen Unmut erregte. Nun kam der Chief an die Reihe, weil angeblich der Schornstein eine „Fahne“ zeigte, zu stark qualmte oder rußte. Der Letzte war dann der 1.Offizier. Bei der ganzen Prozedur machte der Hund ein höllisches Spektakel, so dass das ganze Schiff in Aufruhr geriet und die Freiwache, zu der auch ich gehörte, „senkrecht in den Kojen stand“. Danach trank er seelenruhig seinen Kaffee, und es kehrte wieder Frieden in das Schiff ein. Dieser Vorgang wiederholte sich auf See jeden Tag um die gleiche Zeit, so dass allmählich ein Gewöhnungseffekt eintrat und sich keiner mehr besonders darüber aufregte.
Jeden Mittag wurde, wenn es das Wetter erlaubte, das „Mittagsbesteck“ genommen, das heißt, die Position des Schiffes wurde mit Hilfe der Sextanten und der Sonne astronomisch festgestellt. War das Wetter sonnig, war es des 3.Offiziers und meine Aufgabe, den Standort zu bestimmen und danach die nötigen Eintragungen, wie Mittagsposition und Etmal (die in 24 Stunden zurückgelegte Reise in Seemeilen) im Logbuch zu vermerken. Hatten wir einige Tage lang bedeckten Himmel, konnten wir unseren Standort nur „gissen“ (schätzen) und jede Wache wartete auf ein Wolkenloch oder aufklarenden Himmel, um sofort die Sonne oder ein paar Sterne zu „schießen“. In solchen Situationen befand sich meistens die ganze „nautische Elite“ auf der Brücke. Wir hatten nur zwei Sextanten an Bord, einen modernen Trommelsextanten, der einfach abzulesen war und einen Noniussextanten, ein antikes Stück mit Lupenablesung, der schwer zu handhaben war. Während sich der Alte mit dem Ersten den Trommelsextanten teilte, mussten der Dritte und ich uns mit dem Nonius begnügen. Gab es nach dem Ende der Beobachtungen verschiedene, geringfügig abweichende Standorte bzw. Positionen, wurde nach dem § 1 der Bordordnung verfahren, der lautete: „Der Kapitän hat immer recht! Hat der Kapitän nicht recht, tritt automatisch § 1 in Kraft“, und damit hatten wir unsere genaue Position.
Die Mahlzeiten an Bord wurden in den jeweiligen Messen eingenommen. Während die Mannschaft achtern in der Poop ihre Messen hatte, aßen wir Offiziere außer dem Alten, dem Chief und dem Ersten in der Offiziersmesse mittschiffs. Die „drei Eisheiligen“ (Kapitän, Leitender Ingenieur und 1.Offizier) speisten in dem Kapitänssalon, der sich über der Offiziersmesse befand. Auch unter den Stewards gab es Rangunterschiede. Die „drei Eisheiligen“ wurden von ihrem „Salonsteward“ bedient, während wir übrigen Offiziere unseren Messesteward hatten. Der Salonsteward, offiziell als 1.Steward bezeichnet, war mit einer Engelsgeduld gesegnet. Ihn konnte nichts aus der Ruhe bringen. Wir vermuteten, dass die Reederei ihn für unseren Alten extra ausgesucht hatte. Je mehr der Alte ihn anschrie, ihm drohte oder ihn zu scheuchen versuchte, desto ruhiger wurde er. Er war ein kleiner, älterer, milde lächelnder Mann, an dem alle Launen des Alten wie an einer Gummiwand abprallten. Er war nur für diese eine Reise gemustert worden. Länger als eine Reise hielt es auch ein normaler Steward nicht aus, wenn er nicht ohnehin vom Alten gefeuert wurde. Es hieß an Bord, dass der Alte sonst normalerweise seinen eigenen Steward mitbrächte, dieser jedoch für diese Reise nicht zur Verfügung stand.
Den Hund des Alten konnte man nur bedauern. Er war gleichzeitig Gesprächspartner und Ventil für die Launen seines Herrn. Manchmal hörten wir, wie er mit ihm sprach: „Du bist der Beste, Rhino, braver Rhino, du verstehst dein Herrchen am besten“, um ihn dann zehn Minuten später zu schlagen und zu beschimpfen: „Du dreckiger Köter, du Schweinehund, ich werf dich gleich über Bord!“ Der Hund heulte dann fürchterlich und wurde von Tag zu Tag neurotischer. An manchen Tagen wurde er bis zu drei Mal gestriegelt und jeden Abend und Morgen putzte ihm der Alte die Zähne mit einer Zahnbürste und Zahncreme. Der Hund entwickelte Hassgefühle gegen die Menschen und einmal, als ich die Treppe vom Bootsdeck herunterging und mein Kopf in gleicher Höhe mit dem Bootsdeck war, riss er mir unerwartet und ohne Laut ein Dreieck aus meiner Mütze. Anschließend verschwand er lautlos. Der Alte beteuerte, sein Hund sei nicht von seiner Seite gewichen und meinte, ich leide wohl an Halluzinationen oder wolle gar auf Kosten seines Hundes zu einer neuen Mütze kommen. Da der Alte immer recht hatte, musste ich den neuen Mützenüberzug natürlich selbst bezahlen.
Nach einer Woche relativ guten Wetters brieste es von Nordwest kräftig auf und wir bekamen „tüchtig einen auf die Mütze“. Der Wind erreichte gegen Mittag Stärke 9 bis 10 aus NW, so dass der Alte beidrehen musste. Wir dampften gegen die See mit soweit reduzierter Geschwindigkeit, die gerade noch nötig war, um das Schiff noch steuerfähig zu halten. Durch die Fahrtreduzierung und Ausrichtung des Bugs gegen den Wind sollte den Wellen eine möglichst kleine Angriffsfläche geboten und Schäden an Schiff und Ladung vermieden werden. Man nennt diese Maßnahme, „den Sturm abreiten“, und in unserer Situation lag das Schiff, abgesehen von einigen Stampfbewegungen, relativ ruhig in der See. Aus einem uns nicht erklärbarem Grund entschloss sich der Alte gegen 14 Uhr auf meiner Wache, das Schiff umzudrehen, um mit dem Heck zur See zu liegen. Er befahl „hart Steuerbord“ und mit langsamer Fahrt kam das Schiff während des Wendemanövers quer zur See zu liegen, wobei es sich teilweise bis zu 40 Grad nach Steuerbord neigte. Die Zeit, bis es sich wieder aufrichtete, kam mir wie eine Ewigkeit vor, und ich dachte schon, dass wir kentern könnten. Da dieses Manöver ohne jede Vorwarnung erfolgt war, ging alles, was nicht besonders gelascht oder befestigt war, „über Stach“. Leute purzelten aus ihren Kojen, Teller, Tassen, Töpfe, Stühle, alles geriet in Bewegung und der Schaden an Geschirr war beträchtlich. Jeder klammerte sich, so gut er konnte, irgendwo fest und es war ein Wunder, dass außer einigen blauen Flecken keiner ernstlich verletzt wurde. Es stellte sich heraus, dass das Schiff in dieser neuen Position mit der schweren See von achtern bei der langsamen Fahrt heftig schlingerte und rollte, so dass der Alte, wieder durch ein waghalsiges Manöver, auf den alten Kurs zurückgehen musste. Wir alle verfluchten unseren Kapitän und nachdem wir wieder einigermaßen ruhig gegen die See lagen, ging der Alte unter Deck und ließ sich eine ganze Weile nicht mehr sehen. Wie es in den Laderäumen aussah und ob sich dort Ladung losgerissen hatte, konnten wir erst nach Wetterbesserung feststellen. Zwei Tage tobte der Sturm und zwei Tage lagen wir beigedreht in der See, bis der Sturm abflaute und wir wieder mit voller Maschinenkraft auf unseren ursprünglichen Kurs gehen konnten. In den Laderäumen lag alles wie Kraut und Rüben durcheinander und alle Mann hatten mehrere Tage vollauf zu tun, bis alles wieder festgelascht und die Schäden protokolliert waren.
Drei Tage vor St. Johns, unserem ersten Löschhafen, bekamen wir Nebel und wie befürchtet, fiel unser Radargerät aus und war mit Bordmitteln nicht zu reparieren. Der Nebel klarte erst kurz vor St. Johns auf, und die ganze Zeit bis dahin tasteten wir uns mit reduzierter Fahrt und mit Hilfe von Funkpeilungen durch den Nebelbrei. Der Alte, der die ganze Zeit auf der Brücke verbrachte, war ungenießbar und explodierte bei geringstem Anlass. Ich war immer froh, wenn meine Wache zu Ende war und der Erste mich ablöste. Der Hund, der die ganze Zeit mit auf der Brücke stand, bekam am meisten die Launen des Alten zu spüren und pinkelte mehrmals aus Angst auf den Boden, was unseren Alten auch nicht gerade erheiterte.
St. Johns liegt an der Ostseite Neufundlands und ist die Hauptstadt der Provinz. Als wir einliefen, war die Temperatur nahe am Gefrierpunkt und der Himmel am frühen Nachmittag dunkel und bedeckt. Wir löschten dort drei Tage lang jeweils bis 22 Uhr und da der Dritte und ich während des gesamten Löschbetriebs an Deck stehen mussten, waren wir immer sehr durchgefroren. Meine Station war das Achterschiff hinter den Mittelaufbauten, und so konnte ich mich ab und zu in die Kammer des 2.Ingenieurs stehlen und mit ihm und dem Chief einen Grog trinkend etwas aufwärmen. Abends nach dem Löschen mussten wir darauf achten, dass unsere Leute das Wasser aus den Dampfwinden und Rohrleitungen ablaufen ließen, damit sie nachts bei Frost nicht zufroren. So kamen wir nie vor Mitternacht zum Schlafen, und morgens um 6 Uhr war die Nacht für uns schon wieder zu Ende.
Die Reise von St. Johns nach Halifax dauerte zwei Tage und da Eisberg- und Growlergefahr bestand, gingen wir auf der Brücke Doppel- und in der Maschine Manöverwache. Gefährlicher als Eisberge, die man wegen ihrer Größe noch sehen kann, sind die „Growler“, abgesprengte Stücke von Eisbergen. Sie ragen wie die größeren Eisberge nur zu 1/8 aus der Wasseroberfläche heraus, können aber unter Wasser die Größe eines Einfamilienhauses haben. Größe und Gewicht sind verschieden. Besonders nachts und bei schlechter Sicht sind sie ohne Radar kaum auszumachen, und so manches Schiff ereilte schon das Schicksal einer „Titanic“. Da unser Radargerät in St. Johns repariert worden war, erreichten wir ohne Zwischenfall Halifax. Die Stadt liegt an der Ostseite von Nova Scotia (Neuschottland) und hatte damals über 100.000 Einwohner. Der Hafen liegt in der Chebuctobai und war während des 2.Weltkrieges ein wichtiger Nachschubhafen der Alliierten für die Rüstungstransporte nach England und via Murmansk in die Sowjetunion.
Als wir einliefen, wurde es schon dunkel und es wehte ein eisiger Wind von Norden, der die Temperatur unter den Gefrierpunkt sinken ließ. Der Alte beorderte uns schon eine Stunde bevor die Schlepper kamen, auf unsere Stationen, und wir froren fürchterlich. Besonders übel dran waren die Leute auf der Back, die sich nirgends unterstellen konnten. Wir achtern konnten uns, wenn nichts anlag, ab und zu in der Mannschaftsmesse aufwärmen. Nachdem die Schlepper vorne und achtern festgemacht hatten, stellte sich heraus, dass unser Kaiplatz noch nicht frei war, und so mussten wir noch eine Stunde warten, bis wir endlich anlegen konnten. Da wir die ganze Zeit bei den Leinen stehen mussten, waren wir alle schlecht gelaunt und fluchten auf den Alten, der uns über eine Stunden umsonst hatte frieren lassen. Aus irgend einem Grunde klappte auch das Anlegemanöver nicht so, wie es sollte und wir sahen und hörten, wie der Alte mit seinem Megaphon neben dem Lotsen wie ein Irrer herumbrüllte. Keiner wusste, was los war und nachdem wir achtern von uns aus die Achterspring und Achterleine festgemacht hatten, schrie der Alte noch immer: „Achterleine an Land!“ Da platzte einem Matrosen hinter mir der Kragen und er schrie zur Brücke: „Halt doch mal endlich deine dumme Schnauze, du dummes Schwein. Die Achterleine ist doch längst an Land!“
Wir erstarrten alle, und der Alte verschwand im Brückenhaus. Nach dem Festmachen musste ich mich bei ihm melden und er verlangte von mir, dass ich ihm die Person nenne, die diese ungeheure Majestätsbeleidigung begangen hatte. Im Grunde genommen hatte der Mann das ausgesprochen, was wir alle dachten. Aus einem gewissen Solidaritätsgefühl - ich war ja selbst vor noch nicht langer Zeit Matrose gewesen - erklärte ich, ich wisse nicht, wer da gerufen habe. Derjenige habe weit hinter mir gestanden und wegen des lauten Dampfwindengeräusches und des zischenden Dampfes hätte ich seine Stimme und ihn nicht erkennen können. Trotz seiner Drohung und der Überredungsversuche der anderen Offiziere, den Namen doch zu nennen, blieb ich bei meiner Darstellung. Ich weiß nicht, wie die Sache für mich ausgelaufen wäre, hätte sich der Matrose nicht freiwillig gemeldet und beim Alten entschuldigt. Merkwürdigerweise nahm der Alte die Entschuldigung an, und es wurde darüber nicht mehr geredet. „Rucksack-Schmidt“ war eben nicht nachtragend.
Wir lagen zwei Tage in Halifax, wo wir den Rest der Ladung löschten. Da wir auch hier bis spät abends mit dem Löschen zu tun hatten, bekamen die Wenigsten vom Land etwas zu sehen - nach dem alten ironischen Seemannsspruch: „Was braucht der Seemann an Land zu gehen, er kann es auch vom Schiff aus sehen.“ Die Reederei hatte versucht, eine neue Charter oder Ladung zurück nach Europa zu bekommen. Die Marktlage war jedoch sehr schlecht und viele Schiffe lagen auf. So bekamen wir Order, in Ballast zurück in Richtung Englischer Kanal zu gehen. Um den Tiefausläufern zu entgehen, die um diese Jahreszeit von Westen in Richtung Irland ziehen, entschied sich der Alte für einen südlicheren Kurs. Wir steuerten danach fast 90 Grad, um dann bei Erreichen des 20. Längengrades Kurs auf den Englischen Kanal zu nehmen. Den ersten Tag nach dem Auslaufen ließ sich unser Alter meistens nicht blicken, um dann am zweiten Tag wie gewohnt wieder mit seinen „Spielchen“ zu beginnen. Am dritten Tag gerieten wir in eine Regenfront, und es regnete ununterbrochen. Der Wind wehte von Südost mit Stärke 4 bis 5, so dass der Regen die ganze Zeit gegen das Ruderhaus und dessen Fensterscheiben klatschte und wir nur durch unsere zwei rotierenden Sekuritscheiben einigermaßen nach vorne sehen konnten.
Wir ahnten nicht, dass der Regen stetig durch die Holzfensterrahmen leckte und in die an den vorderen Fensterscheiben installierten zwei Sprechrohre eindrang. Das in den Schlafraum des Kapitäns führende Sprechrohr endete an dessen Bett in einen beweglichen Gummischlauch mit Stöpsel, der mit dem Stöpsel nach oben an einer Halterung hing. Wollte der Alte von seinem Bett aus mit der Brücke Verbindung aufnehmen, musste er nach dem Gummischlauch greifen, den Stöpsel herausziehen und kräftig ins Rohr blasen, um sich auf der Brücke mit einem Pfeifton bemerkbar zu machen. Durch den anhaltenden Regen musste sich in dem Sprechrohr und anhängendem Gummischlauch eine enorme Wassermenge angesammelt und gestaut haben. Etwa um 2 Uhr nachts während meiner Wache hörten wir ein leises gurgelndes Geräusch aus der Richtung der Sprechrohre, schenkten dem aber keine Beachtung, denn durch den Wind und Regen plätscherte und pfiff es sowieso um uns herum. Plötzlich stürmte kurz darauf von draußen - man konnte bei diesem Schiffstyp die Brücke nur von außen betreten - eine kleine weiße Gestalt im Nachthemd wutentbrannt ins Brückenhaus und beschuldigte uns mit sich überschlagender Stimme, Wasser ins Sprachrohr geschüttet zu haben.
Was war geschehen? Der Alte, schlaftrunken, wie er war, wollte aus irgend einem Grund (vielleicht wollte er die Wetterlage wissen) die Brücke anrufen. Als er im Dunkeln nach dem Sprachrohr-Gummischlauch griff und den Stöpsel herausriss, ergoss sich ein Strahl kalten Wassers über seinen warmen Körper und sein Bett. Kein Wunder, dass er so erbost war. Trotz meiner Unschuldsbeteuerungen blieb er bei seiner Anschuldigung, und ich hatte am kommenden Morgen eine harte Zeit, da der Alte mir drohte, mich bei der Reederei zu melden mit all den daraus drohenden Konsequenzen. Gott sei Dank wiederholte sich der Vorfall während der Wache des 1.Offiziers noch einmal, und die Sache wurde nach Klärung des wahren Grundes stillschweigend vergessen. Es war das erste und einzige Mal in meinem Leben, dass ich einen wutentbrannten Kapitän im Nachthemd sah. Wie so oft, bleibt immer etwas an einem hängen und es gab Gerüchte, die besagten, ich hätte absichtlich das Sprechrohr des Alten so gedreht, dass das Wasser eindringen konnte. Ich kann aber versichern, dass ich unschuldig war!
Diese Reise war eine Reise der Vorfälle, und ich werde sie nie vergessen. Der nächste Vorfall ereignete sich ein paar Tage später. Nach der alten Volksweisheit „Nach Regen folgt Sonne“ gerieten wir in den Einfluss eines Azorenhochs und hatten wunderbaren Sonnenschein mit sommerlichen Temperaturen und ruhiger See. Auf dem ganzen Schiff wurde entrostet, gemennigt (Rostschutzfarbe aufgetragen) und gemalt. Selbst der 1.Offizier betätigte sich in einem Anfall von unbekannter Arbeitswut an Deck. Da ich seinen Eifer nicht bremsen wollte, übernahm ich nachmittags zwei Stunden seiner Wache, um auch meinen bescheidenen Beitrag zur Erhaltung unseres Schiffe zu leisten. Als ich wieder einmal, wie gewöhnlich, meine Wache um 12 Uhr mittags antrat, herrschte gerade Mittagspause auf dem Schiff. Überall lagen unsere Leute nach dem Essen an Deck oder auf den Luken und ließen sich von der Sonne den Bauch wärmen. Auch unser noch junger Bootsmann, ein etwa 30jähriger energischer Bursche, sonnte sich mit angewinkelten Beinen auf der hinteren Ladeluke.
Auf dem Schiff herrschte eine himmlische Ruhe. Überall standen Farbtöpfe, Pinsel und Entrostungswerkzeuge herum und dazwischen - ich glaubte meinen Augen nicht zu trauen - spazierte Rhino, der vierbeinige Begleiter unseres Alten herum. Ich nehme an, dass auch unser Kapitän, durch das üppige Mahl und das schöne Wetter leicht ermattet, sich ein wenig aufs Ohr gelegt hatte und Rhino die Gelegenheit wahrnahm, sein Revier alleine zu durchstreifen, denn als ich von der Steuerbord-Brückennock nach achtern schaute, sah ich ihn, wie er mal hier, mal da sein Bein hochhebend sein Revier markierte. Ich weiß nicht, was in dem Gehirn des Hundes vorging und ob er den Bootsmann zu seinem Revier zählte. Er hob jedenfalls blitzschnell sein rechtes Bein und markierte jenen mit einem kräftigen Strahl. Der Bootsmann, so plötzlich seinen Träumen entrissen und zum Dominium erklärt, war natürlich sehr entrüstet und griff sich den Rhino am Halsband. Nachdem er ihn kräftig durchgeschüttelt hatte, schnappte er sich einen neben ihm liegenden Pinsel, tauchte ihn in einen Mennigetopf und pinselte dem armen Rhino seine zwei Testikel mit Bleimennige an. Außer mir, den er nicht sehen konnte, gab es keine Zeugen, da die anderen an Deck mehr oder weniger dösten oder schliefen. Rhino verzog sich nach dieser unfreundlichen Behandlung auf das Vorschiff und ich sah, wie er dort mit seinem Stummelschwanz wedelnd und mit orange leuchtenden Testikeln weiterhin Duftmarken setzte.
Am nächsten Morgen zu der Zeit, in der der Alte normalerweise aufzustehen pflegte, hörten wir plötzlich einen furchtbaren Schrei und sahen einen wutentbrannten Kapitän durch das Schiff rasen. Alles lief zusammen und fragte sich, was wohl passiert sei, als der Alte mit fassungsloser, wütender Stimme von dem ruchlosen Anschlag auf Rhinos Testikel berichtete und den armen Rhino mit seinen leuchtenden Testikeln vorführte. Es mag aus der Sicht der Tierschützer ein verwerflicher Akt gewesen sein, aber Menschen sind nun einmal Menschen und als wir unseren Rhino so mit seinen orangenen Testikeln sahen, mussten wir uns alle das Lachen verbeißen. Je mehr der Alte redete, um so mehr steigerte sich seine Wut und er befahl die ganze Besatzung ohne Ausnahme auf das Bootsdeck, um den Täter zu entlarven. Wir mussten uns alle in eine Reihe stellen und der Alte ging mit seinem Hund zu jedem Einzelnen und fragte ihn eindringlich, ob er die Tat begangen habe. Anschließend fragte er den Hund: „Rhino, wer war das?“ Aber Rhino wedelte bei jedem, auch beim Bootsmann, nur mit seinem Stummelschwanz. Da sich keiner gemeldet hatte, blieb die ganze Untersuchung ohne Ergebnis. Zuletzt appellierte der Alte an das Gewissen des Täters, er möge doch „Manns genug“ sein und sich stellen, es würde ihm auch nichts geschehen. Aber das traute sich unser Bootsmann nun doch wohl nicht, und auch ich hätte mich auf die Zusicherung unseres Alten nicht verlassen. Als alles nichts nützte, stieß der Alte wüste Drohungen aus, er werde den „Schweinehund“ schon noch finden und persönlich zur Rechenschaft ziehen und vor Gericht bringen. Er wisse genau, dass es dafür ein Jahr Gefängnis gebe. Ich beobachte den Bootsmann und er kam mir blasser als sonst vor. Anschließend versuchte der Alte in seiner Kammer, die Farbe mit Terpentinersatz zu entfernen, aber nach Rhinos lautem Gebell und Gejaule gab er auf. Wir sahen unseren Rhino noch etliche Tage mit seinen leuchtenden Testikeln herumlaufen, bis die Farbe nach und nach verblasste und verschwand. Die Geschichte mit Rhino wurde übrigens über längere Zeit in der ganzen Flotte erzählt. Wie üblich bildeten sich später darüber Legenden. Eine Variation wollte wissen, ein Testikel sei rot wie Backbord, der andere grün wie Steuerbord bemalt gewesen. Ich kann bezeugen, dass es nur Bleimennige war.
Der nächste Schlag erfolge zwei Tage später. Das Schlafgemach unseres Alten befand sich an der Rückseite seines Wohnraumes. Es war eine kleine Kammer mit einem einzigen Bullauge zum Bootsdeck hin. An dem Bullauge befand sich ein kleiner Vorhang, den der Alte vor dem Schlafengehen zuzuziehen pflegte, so dass ihn niemand beobachten konnte. Wenn es Tag wurde, schimmerte das Licht durch den Vorhang und er wusste so, wann er aufstehen musste. An diesem Tag wunderten wir uns alle, dass sich um die Zeit, in der der Alte sich sonst zu erheben pflegte, nichts rührte. Keine Tür wurde aufgeschlagen, und kein Schrei nach dem Steward war zu hören. Weder Herr noch Hund kläfften durch den Morgen. Es herrschte weiterhin himmlische Ruhe. Wir fragten uns, ob unserem „Meister“ etwas zugestoßen sein könnte, als gegen Mittag ein empörter Schrei durch das Schiff schrillte. Was war passiert? Irgendein Spaßvogel hatte während der Nacht das Bullauge zum Schlafraum des Alten mit schwarzer Farbe zugemalt, so dass kein Lichtschein mehr in sein Gemach dringen konnte. Der Alte, im Glauben, es sei noch finstre Nacht, war erst gegen Mittag misstrauisch geworden und hatte dann das Attentat entdeckt. Diesmal bemühte er sich nicht, den Täter ausfindig zu machen und schickte sich auf Grund jüngster Erfahrungen in die Einsicht, dass das wohl zwecklos sei und so blieb auch dieses Delikt unaufgeklärt.
Es war der letzte Vorfall während dieser Reise und das Bordleben verlief wieder in den gewohnten Bahnen. Ich hatte mich in meine neue Rolle als 2.Offizier eingelebt, und nur manchmal vergaß ich, meine Untergebenen mit „Sie“ anzureden.
Zu lange war ich mit ihnen zusammen „vor dem Mast“ gefahren. Wie immer, wenn ich meine Wache auf der Brücke antrat, hatten meine beiden Wachgänger, ein Matrose und ein Leichtmatrose, für uns drei je eine große Mug Kaffee gekocht, den wir zusammen im Ruderhaus tranken. Der Rudergänger trank seine Mug am Ruder, während wir zwei anderen unseren Kaffee am vorderen Klapptisch schlürften. Wenn draußen die Sicht gut und auf dem Atlantik kein Verkehr war und es die Situation erlaubte, unterhielten wir drei uns dabei über Gott und die Welt, meistens über Schiffe, auf denen wir gefahren waren, und so verging die Wache für uns recht schnell. Ich wusste, dass es der Alte nicht gerne sah, wenn sich ein Offizier zu vertraut mit der Mannschaft unterhielt. Aber um Mitternacht pflegte er meistens zu schlafen und zuvor hatte er sich, außer in besonderen Situationen, noch nie nach Mitternacht auf der Brücke sehen lassen. Aber Ausnahmen bestätigen eben die Regel, denn als wir wieder einmal bei guter Sicht und freier See unsere zweite Mug Kaffee tranken, tauchte plötzlich von draußen aus dem Dunkeln wie ein Geist unser Alter auf. Wir hatten ihn zunächst gar nicht bemerkt und erst, als er zu toben anfing, wurden wir seiner gewahr. Er machte mich tüchtig „zur Schnecke“ und schrie, ich sei wohl verrückt geworden, hier seien nachts keine Kaffeekränzchen abzuhalten. Sein Hund unterstützte ihn mit lautem Gebell, und die stille Nachtruhe war dahin. Unser Chief hatte schon recht mit seinem Vergleich mit der aufgescheuchten ländlichen Hühnerhofidylle. Am nächsten Vormittag wusste schon das ganze Schiff vom „Kaffeekränzchen“ des 2.Offiziers. Er hielt mir dann einen Vortrag über seinen Standpunkt vom Verhalten eines Offiziers zu seinen Untergebenen und der erforderlichen Distanz, die ich einhalten müsse. Wir tranken trotzdem weiterhin unseren Kaffee gemeinsam, passten aber auf, dass uns niemand mehr dabei überraschte.
Meine einzigen Freunde unter den Offizieren waren also der Chief und der 2.Ingenieur. Wir saßen meistens zusammen und tranken, je nach Wetterlage, einen steifen Grog oder ein kühles Bier. Obwohl die beiden so viel älter waren, hatten wir nie Verständigungsschwierigkeiten. Es waren großartige Kollegen ohne jegliche Arroganz oder Dünkel. Wenn man bedenkt, dass der Leitende Ing. in der Bordhierarchie gleich nach dem Kapitän rangiert, fand ich unser Verhältnis bemerkenswert. Viele Chiefs, die ich später kennen lernen sollte, waren eingebildete Pinsel mit einem übersteigerten Selbstwertgefühl, bei denen der Mensch erst beim 1.Offizier anfing. Beide, Chief und 2. Ing., waren etwas korpulent. Sie strahlten eine natürliche Autorität aus, wie man sie nur bei echten Respektspersonen findet. Unser Verhältnis war kollegial unter Wahrung der nötigen Distanz.
Auf See bekamen wir über Funk die Order, in Le Havre zu bunkern und anschließend nach Hamburg zu gehen. Nachdem wir den Leuchtturm von Isle d’ Ouessant, den man wegen seiner schwarz-weißen Streifen auch den „Preußischen Grenadier“ nennt, passiert hatten, befanden wir uns wieder im Englischen Kanal. Vierundzwanzig Stunden später erreichten wir Le Havre und machten spät abends an der Bunkerkai fest. Nach der Einklarierung durch die Behörden gelüstete es unseren Alten kurz vor Mitternacht noch ein wenig nach Zerstreuung. Da erst am kommenden Morgen mit dem Bunkern begonnen werden sollte, lud er den Chief und den 1.Offizier zu einem kleinen Umtrunk an Land ein. Der Agent hatte unserem Alten einen mondänen Nachtclub empfohlen, wo die Damen recht freizügig und die Beleuchtung dezent sein sollte. Auf Wunsch des Alten wurde blauer Uniformrock mit „Kolbenringen“ (Goldstreifen am Ärmel) angelegt, und wir sahen unsere „drei Eisheiligen“ beschwingten Schrittes dem Land entgegen eilen. Wir, die übrigen Chargen, gingen brav, wie es sich für rechtschaffene Seeleute gehört, in unsere Kojen und hofften auf süße Träume.
Am Morgen hing der Haus- bzw. Schiffssegen sehr schief. Wir sahen einen sehr verkaterten Alten und einen sehr mürrischen Chief und ebensolchen Ersten. Wie mir beide später fluchend erzählten, wurden sie im Nachtclub von den Damen großartig empfangen. Da die Einladung durch den Alten erfolgt war, war dieser natürlich „Hahn im Korb“. Die Damen wärmten ihren Busen an ihm, und er bestellte großzügig Getränke für sie. Sie knutschten ihn dafür natürlich laufend ab, während unsere beiden anderen Kavaliere zu Statisten verdammt waren. Die Rechnung war danach natürlich ebenfalls großartig, und der Alte bezahlte sie mit einer noblen Geste. Als alle drei wieder an Bord zurück waren, benahm sich der noble Gastgeber gar nicht mehr nobel und verlangte, dass die Rechnung durch drei geteilt werden sollte und er von ihnen eine Menge Geld zu bekommen habe.
Von Le Havre ging es nach dem Bunkern am selben Tag weiter in Richtung Hamburg, wo wir wieder an den Pfählen, diesmal im Hansahafen, festmachten und auf neue Ladung warteten. Während die „drei Eisheiligen“ als Senioroffiziere zu ihren Familien nach Hause fuhren, teilten wir übrigen Offiziere uns die Hafenwachen. Am Einlauftag kam auch unser oberster nautischer Inspektor, Kapitän Graf, an Bord. Er war ein hochgewachsener, schweigsamer Mann Mitte Fünfzig, vor dem der Alte und die übrigen Offiziere einen höllischen Respekt hatten. Um es vorwegzunehmen, er war einer der anständigsten und meiner Meinung nach besten Inspektoren, die ich in meiner ganzen Seefahrtszeit kennen gelernt habe, in der Sache knallhart, aber doch mit dem nötigen Verständnis für das Leben an Bord. In Hamburg bekamen wir auch einen neuen 3.Offizier, da unser bisheriger auf ein größeres Schiff der Reederei versetzt wurde. Der neue Dritte war schon über vierzig Jahre alt und besaß ein kleines „Küstenschifferpatent“, welches ihn mit einer Sondergenehmigung befähigte, auf unserem Schiff als 3.Offizier zu fahren.
Er war ein großer, dunkelhaariger, athletisch gebauter Mann mit hartem wettergegerbtem Gesicht, sprach sehr wenig und schloss sich niemandem an. Ich kam gut mit ihm aus und hatte nie Schwierigkeiten mit ihm. Nur unser Alter behandelte ihn wegen seines niedrigen Patents immer geringschätzig und herablassend. Wie mir der Dritte später einmal erzählte, war er als junger Mann in den 30er Jahren zusammen mit seinem Freund in einem kleinen Segelboot von Hamburg nach Brasilien gesegelt und 20 Jahre lang dort geblieben. Er hatte dort ein abenteuerliches Leben geführt und war auch auf brasilianischen Schiffen gefahren. Erst Anfang der 50er Jahre war er wieder nach Deutschland zurückgekehrt und hatte sein kleines Küstenschifferpatent gemacht. Durch Zufall hatte er nach 20 Jahren in Hamburg seine alte Liebe wiedergefunden und geheiratet. Es war eine romantische Liebesgeschichte, da auch sie ihn nie vergessen und deshalb nie geheiratet hatte. Wie er mir erzählte, war sie beruflich selbständig und finanziell unabhängig von ihm. Ich sah sie einmal, als sie ihn an Bord besuchte, eine große, dunkelhaarige, gut aussehende Frau.
Während der Liegezeit in Hamburg besuchte ich auch die alte Frau Petersen, die inzwischen 86 Jahre alt geworden war. Ihr Hund Sherry war an einer Nierenkrankheit gestorben, und sie hatte sich jetzt eine Katze zugelegt, die nicht „Gassi“ geführt zu werden brauchte. Es war das letzte Mal, dass ich sie sah. Einen Monat später starb sie. Ich denke noch oft an diese großartige Frau, die das Schicksal so hart geprüft hatte und die sich nie hatte unterkriegen lassen.
Am Wochenende beschlossen der Chief und ich, einen kleinen Kneipenbummel zu machen. Wir wollten auch das „Hofbräuhaus“ am Dammtor besuchen, und da dort gerne „Krawatte“ gesehen wurde, machten wir uns extra fein. Der Chief zog seinen dunklen Anzug an und sah darin so solide aus, wie ein Londoner Banker, während ich in meinem einzigen Sakko und Krawatte höchstens als Clerk durchging. Nun war es nicht ganz so einfach, an Land zu kommen, da unser Schiff an den Pfählen im Strom lag und wir auf die Jolle angewiesen waren. Man musste am Tage zu genau festgesetzten Zeiten die „Jollenflagge“ und nachts eine rote Laterne im Mast setzen. Damit zeigte man dem Jollenführer an, dass man an Land wollte. Die Jolle kam dann längsseits und wenn man an Bord gejumpt war, klapperte sie die anderen an den Pfählen liegenden Schiffe nacheinander ab, bis sie voll war. Endstation war dann die Anlegestelle am Baumwall, von wo man mit der Hochbahn, der Straßenbahn oder per Taxi weiterkommen konnte. Nach Mitternacht fuhr nur noch um 3 Uhr morgens die letzte Jolle zurück, um dann um 6 Uhr den stündlichen Betrieb wieder aufzunehmen. Hatte man einen über den Durst getrunken, war das Wiedererklimmen des Schiffes von der Jolle aus eine ziemlich schwankende und riskante Angelegenheit, und so mancher brave Seemann hatte dabei schon ein kühles Bad in der Elbe genommen.
Da der Chief und ich uns an Bord noch nicht vorgewärmt hatten, wie es durchaus unter Seeleuten vor dem Landgang üblich war, kamen wir ohne Schwierigkeiten zum Baumwall und setzten uns zur Seelenstärkung in eine der vielen Kneipen, die es dort damals gab. Nachdem wir uns so an Land akklimatisiert hatten, ließen wir uns mit einem Taxi zum „Zillertal“ auf die Reeperbahn fahren, wo am Wochenende immer „was los“ war. Wie erwartet, ging es dort hoch her, und es herrschte Jubel, Trubel, Heiterkeit. Eine große Blaskapelle in bayrischer Nationaltracht schmetterte alpenländische Folklore und wir hatten Mühe, noch zwei freie Plätze zu finden. Überall wurde Bier aus großen Krügen getrunken, und die Leute waren außer Rand und Band. Einige tanzten sogar auf den Tischen. An unserem Tisch saßen dänische und norwegische Touristen, die schon tüchtig getankt hatten, und nach der vierten Runde wurde nur noch mit „Skål“ zugeprostet.
Zwischendurch kam eine japanische Delegation herein, die wahrscheinlich zu einer Tagung in Hamburg weilte. Die Blaskapelle empfing sie geschäftstüchtig mit der japanischen Nationalhymne. Die Japaner, ganz gerührt, schmissen für die Kapelle einige Runden Bier, die danach erst richtig aufdrehte, so dass alles noch mehr in Schwung kam. Einer der Japaner bekam den Dirigentenstab in die Hand gedrückt und einen Seppelhut aufgesetzt und durfte das Lied dirigieren: „Hamburg ist ein schönes Städten“, was dann von einigen hundert Stimmen mitgegröhlt wurde. Zuletzt schunkelten wir alle an den Tischen, tanzten auf den Tischen und einige fielen auch schon unter die Tische. Die Skandinavier waren ganz begeistert von der überschäumenden teutonischen Lebensfreude. Etwa eine Stunde vor Mitternacht verließen wir, im leichten Seegang schlingernd, das „Zillertal“, nicht ohne uns vorher herzlichst von unseren netten skandinavischen Tischfreunden verabschiedet zu haben. Da der Abend noch jung war, ließen wir uns per Taxi zum „Hofbräuhaus“ am Dammtor fahren. Auch dort ging es hoch her, aber etwas gesitteter, als im „Zillertal“. Wir setzten uns an einen Tisch zu vier dezent aussehenden Damen, die schon leicht die Vierzig überschritten hatten und sich hier ebenfalls einen vergnügten Abend machen wollten.
Der Chief mit seiner noblen Art war natürlich sofort der Hahn im Korb und genoss sichtlich die Aufmerksamkeit der Damen, während ich mit meinen 23 Jahren mit den „Muttis“ nicht viel anfangen konnte. Der Chief legte mit den Damen nacheinander „eine heiße Sohle aufs Parkett“, die ich ihm gar nicht zugetraut hätte. Während wir eine Runde Bier und Wein nach der anderen bestellten, kam ich mit unserer Kellnerin, einer hübschen blonden Dreißigjährigen, ins Gespräch. Ihr Hobby war ein großes Aquarium mit Süßwasserfischen zu Hause und da der Lebensgefährte meiner Tante auch ein Aquarium besessen hatte, konnte ich mit einigem Wissen über „Skalare, „Mohrchen“ und „Neonfische“ aufwarten. Sie war ganz begeistert über meine Anteilnahme an ihren Lieblingen, wenngleich mein Interesse mehr auf die blonde „Seejungfrau“ gerichtet war, als auf die kalten Fischlein. Wir verabredeten uns, nach Lokalschluss, etwa um 4 Uhr morgens, gemeinsam zu ihr nach Hause zu fahren, um dort ihre Lieblinge zu bewundern.
Etwa um 1 Uhr brachen die Damen an unserem Tisch, die auch nicht mehr ganz sicher auf den Beinen waren, auf. Eine dieser Damen, eine Frau von Eggert, wollte unbedingt noch bleiben, um an Bord mit dem Chief dessen alte Dampfmaschine zu besichtigen. Ihr technisches Interesse war wirklich groß, denn ihre drei Freundinnen hatten alle Mühe, sie von unserem Tisch fortzubekommen. Erst nachdem sie unserem Chief ihre Visitenkarte in seine Jackentasche gesteckt und ihm das Versprechen abgenommen hatte, sie anzurufen, verließ auch sie mit den anderen das Lokal. Als wir anschließend alleine am Tisch saßen, merkte ich erst, dass der Chief bereits sehr schwere Schlagseite hatte und nahe dem Kenterpunkt angelangt war. Als er zur Toilette ging und auch nach einer halben Stunde immer noch nicht zurück war, machte ich mich besorgt auf die Suche nach ihm. Auf der Toilette war er nicht, und auch der Portier hatte ihn nicht hinausgehen sehen. Das Lokal war noch zu einem Drittel gefüllt, und die Musik spielte auf Stimmung. Überall wurde geschunkelt und getanzt. Ich hoffte, ihn an irgend einem Tisch zu finden, aber mein Chief blieb verschwunden. Nun war ich wirklich in Sorge und machte mich zusammen mit dem Geschäftsführer und meiner blonden Fischliebhaberin auf die Suche, denn ein leibhaftiger Chief konnte sich doch nicht einfach in Luft aufgelöst haben. Als wir von der Küche bis zu Privaträumen alles abgesucht und ihn nicht gefunden hatten, winkte uns plötzlich die Garderobenfrau aufgeregt zu, und wir fanden unseren Chief. Er hatte sich unbemerkt in die Garderobe geschlichen und war auf einem Stuhl zwischen den Mänteln eingeschlafen.
Als er da so auf dem Stuhl selig schlafend saß, sah er wie ein übergroßes Baby ans, nur dass er dabei Geräusche wie eine Dampfmaschine im Leerlauf von sich gab, störte ein wenig die Idylle. Der Geschäftsführer nahm es mit Humor, meinte aber auch, dass der bessere Platz für ihn wohl die Koje wäre. Ich stand nun vor einer schweren Entscheidung: Aquarium oder Chief? Er wäre wohl in seinem Zustand nie alleine heil an Bord zurückgekommen. So entschied ich mich zu meinem größten Bedauern für den Chief, nicht ohne vorher meiner „Nixe“ hoch und heilig versprochen zu haben, kommende Woche ihre Fische anzuschauen. Um es vorwegzunehmen: Ich habe ihre wunderbaren Fische nie gesehen, da wir einige Tage später ausliefen. So blieb alles für mich ein schöner Seemannstraum, an den ich während der folgenden Reise oft dachte.
Wir erreichten unsere Jolle noch gerade rechtzeitig vor der Abfahrt, und ich hatte einige Mühe, den Chief wieder heil an Bord zu bringen. Die 3-Uhr-Jolle wurde auch „Lumpensammler“ genannt, denn alles, was sich nachts an Land herumgetrieben hatte, fand sich jetzt samt „Mitbringsel“ ein. Zu diesen „Mitbringseln“ zählten besonders die „Damen der besten Gesellschaft“, die sich „Hein Seemann“ auf seiner Exkursion durch die Kneipen während der Nacht angelacht hatte. Es waren schon einige besonders exotische Exemplare darunter, und bei einigen würde es morgens ein böses Erwachen geben. Während der Fahrt herrschte unter den etwa 50 Fahrgästen eine ausgelassene Stimmung und die mitgebrachten Sekt- und Schnapsflaschen machten die Runde. Schwierigkeiten gab es nur nach dem Anlegen, wenn die lusteren Gestalten über die schwankende Gangway an Bord übersetzen mussten. So manche Schnapsleiche wurde mit vereinten Kräften an Bord gehievt, und den nicht schwindelfreien Damen wurde mit kräftiger Unterstützung von hinten durch Schieben bei Gejohle und Gekreische nachgeholfen. Zum Glück schlief unser Wachmann bei unserer Ankunft nicht, und mit vereinten Kräften brachten wir unseren Leitenden Ing. sicher in seine Koje.
Gegen Mittag sah ich einen ziemlich verkaterten Chief, der mir gestand, dass ihm einige Stunden der gestrigen Nacht fehlten und er sich nicht mehr erinnern könne, wie er an Bord zurückgekommen sei. Schon über die Geschehnisse im Hofbräuhaus hatte er Gedächtnislücken. Als ich ihn die vier Damen an unserem Tisch, die ganz vernarrt in ihn waren in Erinnerung bringen wollte und ihm erzählte, eine derselben habe nur mit großer Mühe ihrer Freundinnen davon abgehalten werden können, mit ihm an Bord zu gehen, wollte er es mir nicht abnehmen. Erst als wir in seiner Kammer die Visitenkarte dieser Dame aus seiner Jackentasche gefingert hatten und er andächtig darauf starrte, glaube er mir, und dich musste ihm erzählen, wie alt sie war und wie sie aussah. Da sie von Eggert hieß, musste sie natürlich eine Gräfin gewesen sein und da ich wusste, dass er während des Krieges eine Bewunderin der Filmschauspielerin Brigitte Hornig war, gab ich ihm eine mehr oder weniger genaue Beschreibung von ihr. Sie sei etwas über 40 Jahre alt mit Traumfigur und einem Gesicht wie besagte Schauspielerin. Mit einiger Toleranz und Abstrichen war meine Beschreibung auch gar nicht so unzutreffend, und nur ihre rauchige Stimme sprengte etwas den Rahmen. Aber haben nicht alle Frauen abends in der Bar eine rauchige Stimme? Unser Chief lauschte mit der Karte in der Hand andächtig meiner Beschreibung, und ich musste sie ihm während des Tages noch mehrmals wiederholen und er war glücklich wie ein kleiner Junge. Er fragte mich, ob er sie wirklich kommende Woche anrufen solle, und natürlich riet ich ihm dazu. Aber unser Chief war ein kreuzbraver, glücklich verheirateter, treuer Ehemann und ich glaube nicht, dass er die „Gräfin“ jemals angerufen hat. So war auch sie für ihn nur ein schöner Seemannstraum und die Visitenkarte eine Bestätigung seiner selbst.
Nach nicht ganz zwei Wochen Liegezeit in Hamburg bekamen wir Order nach Archangelsk zu gehen, wo wir Schnittholz für Rotterdam laden sollten. Auf dem Weg nach Archangelsk führte uns ein Stück der Route durch die norwegischen Lofoten und Fjorde. Da wir mit Lotsenberatung fuhren, hatte ich von der Brücke aus Gelegenheit, diese einzigartig schöne Landschaft im Mai bei strahlendem Wetter zu bewundern. Viele große Passagierschiffe wählen auf ihren Kreuzfahrten nach Norden speziell diese Route, um ihren betuchten Fahrgästen den Anblick dieser Naturwunder zu bieten. Hier hatten wir als „Hein Seemann“ einmal den seltenen Fall, umsonst und obendrein noch bezahlt, bewundern zu können, wofür andere viel Geld hinlegen müssen. Nachdem wir Honningsvåg südöstlich vom Nordkap passiert hatten, traten wir in die Barentssee ein. Hier ging um diese Jahreszeit die Sonne nachts nicht mehr unter und man musste sich erst an den Zustand gewöhnen, bis man normal schlafen konnte. Nach der Passage von Kap Orlov Tresky wurde auch die Sowjetmacht durch ein Wachboot präsent, welches uns die ganze Zeit über durch das Weiße Meer bis Archangelsk eskortierte. Es war die Zeit des „Kalten Krieges“, und das Verhältnis zwischen Ost und West befand sich auf einem Tiefpunkt, was wir bei unserer Ankunft in Archangelsk zu spüren bekamen. Nachdem wir auf der Reede Anker geworfen hatten, kamen die sowjetischen Behörden mit vielen Uniformierten an Bord. Da in jedem westlichen Bürger ein Spion vermutet wurde, war die Kontrolle besonders scharf. Wir mussten uns auf dem Bootsdeck in einer Reihe aufstellen. Bei der Gesichtskontrolle wurde jedes Passbild gründlich mit dem Gesicht verglichen. Der Funkraum wurde versiegelt und das ganze Schiff genauestens nach möglichen Agenten und Saboteuren untersucht. Danach wurden alle westlichen Zeitungen und Zeitschriften eingesammelt und in einem Locker eingeschlossen und versiegelt. Auch jeder Fotoapparat wurde genau registriert, und natürlich war Fotografieren strengstens verboten.
Für den Landgang, der nur bis 23.30 Uhr begrenzt war, bekamen wir besondere Landgangsscheine, die später an der Kai von einem Posten an der Gangway kontrolliert wurden. Eine zweite Kontrolle erfolgte bei einem Kontrollposten am Hafentor. Aber wo sollte man in Archangelsk schon hingehen, da es doch der Bevölkerung bei Strafe verboten war, sich mit Ausländern zu unterhalten. Der einzige Ort für uns Seeleute war der „Internationale Seemannsclub“, in dem man Wodka trinken und sich politisch berieseln lassen konnte. An der Kai wurde man abends mit einem Sammelbus abgeholt und zum Club gefahren und mit einem Arm voll Propagandamaterial kurz vor Mitternacht wieder zurückgebracht. Da während des Ladens an der Kai in drei Schichten gearbeitet wurde, ging der 3.Offizier mit dem Ersten von 6 Uhr morgens bis 18 Uhr Ladungswache. Meine Wache begann um 18 Uhr und endete um 6 Uhr früh. Während des Ladens mussten wir die Bretter mit zwei Matrosen zählen. Jede Hieve mit Brettern wurde, bevor sie an Bord ging, zusammen mit einem Tallymädchen, Brett bei Brett gezählt und in ein Tallybuch eingetragen.
Die Tallymädchen waren noch sehr jung und hatten meistens geläufige russische Namen, wie Tanja, Olga, Natascha oder Svenja. Sie waren wohl alle vorher vom Politkommissar instruiert worden, denn anfangs waren sie uns gegenüber sehr misstrauisch und ängstlich. Mein Tallymädchen hieß Svenja und nach wenigen Tagen, als sie merkte, dass ich kein böser abgefeimter Kapitalist war, entwickelte sich ein besonders freundschaftliches Verhältnis zwischen uns. Sie war ein hübsches, blondes, natürliches und sehr kluges Mädchen. Wenn wir nachts unseren Kaffee kochten, brachten wir unserem Tallymädchen und dem Wachposten am Schiff stets eine Tasse mit. Letzterer trank sie immer heimlich. Wir konnten den Mädchen die größte Freude machen, wenn wir ihnen Minen für ihre Kugelschreiber gaben. So räumten wir heimlich unsere Schreibstore an Bord aus, so dass wir am Ende kaum noch Reserveminen für das Schiff hatten. Ich erfuhr, dass Svenja neben ihrer Arbeit im Hafen Maschinenbau studierte und Ingenieurin werden wollte. Nach dem Studium wollte sie heiraten und zwei Kinder haben. Da wir immer unter Beobachtung standen, war unser Freundschaftsverhältnis rein platonisch und blieb somit auch nur ein weiterer schöner Seemannstraum. Trotzdem denke ich oft an diese natürlichen, durch keine übersteigerte Zivilisation degenerierten Mädchen zurück. Trotz ihrer unförmigen Arbeitskleidung und wenig „make up“ verzauberten sie uns durch ihren natürlichen Charme und ihre Bescheidenheit.
Wir verließen Archangelsk nach ca. drei Wochen Ladezeit mit einer riesigen Deckslast auf dem Vor- und Achterdeck in Richtung Rotterdam. Vorher wurden wir noch einmal gründlich gefilzt und dreifach gezählt, damit auch ja keiner das „Arbeiterparadies“ verlassen und kein böser Spion sich einschleichen konnte. Natürlich fand wieder eine gründliche Gesichtskontrolle statt, aber keiner von uns hatte sich verändert. Zurück nahmen wir die gleiche Route, nur dass wir in Honningsvåg, einem kleinen Fischerhafen, bunkerten und Frischproviant ergänzten. Da wir dort nur einige Stunden lagen, gab es für uns keinen Landgang. Unterwegs nach Rotterdam kam ich meiner Pflicht als „Erbsenzähler“ nach, wie der 2.Offizier als „Proviantoffizier“ genannt wurde. Zu diesen meinen Pflichten gehörte es, am Monatsende die Proviantabrechnung zu erstellen. Dazu musste jeweils der genaue Bestand aufgenommen werden. Jedes Stück Fleisch, Wurst, Butter, Käse, Erbsentüte ect. wurde mit Hilfe eines Matrosen mit einer Waage genau gewogen und mit deutscher Gründlichkeit aufgelistet.
Am Ende des Buches befand sich eine Strichliste, in der alle Besatzungsmitglieder, Lotsen oder bordfremden Personen aufgeführt waren, die an unseren Mahlzeiten teilgenommen hatten. Anhand dieser Strichliste und den neuen Bestandszahlen wurde der Proviantsatz errechnet. Der vorgegebene Satz von 4,25 DM pro Person durfte nicht überschritten werden, sonst war der Teufel los. Ich sollte später Kapitäne kennen lernen, die schon bei 5 Pfennigen über dem Satz verrückt spielten und verlangten, dass jeden Morgen der Tagesproviant unter Aufsicht des 2.Offiziers genau abgewogen wurde, bevor er zur Verarbeitung kam. Diese subtile Handhabung wurde nicht nur von unserer, sondern von den meisten deutschen Reedereien praktiziert und war ein unausrottbares Relikt aus alten Segelschiffszeiten. Nicht umsonst wurde eine große deutsche Reederei unter den Seeleuten „Knapp & Billig“ genannt. Dank meiner Rechnung lagen wir zwei Pfennige unter dem Satz, und unser Alter war zufrieden.
Auf See wurden wir über Funk von unserer Reederei unterrichtet, dass wir in Rotterdam einen neuen 1.Offizier und 1.Steward bekämen. Unser bisheriger Erster sollte auf ein größeres Schiff versetzt werden, was wahrscheinlich als eine Vorstufe der Beförderung zum Kapitän gedeutet werden konnte. Der 1.Steward war ja von Anfang an nur für eine kurze Reise bei uns gemustert. Natürlich waren wir zwei Nautiker und die Deckscrew gespannt, wie der zu erwartende neue 1.Offizier hieß und da die Reederei keinen Namen genannt hatte, ergingen sich alle in die wildesten Spekulationen. Nach acht Tagen Seereise von Archangelsk erreichten wir an einem sonnigen Junitag Rotterdam. An der Kai standen schon der neue 1.Offizier, der neue 1.Steward und der Agent, und sie begutachteten während des Anlegens unser Schiff. Einigen Leuten von unserer Deckscrew, die schon länger bei der Reederei waren, fiel beim Anblick des neuen Ersten die Kinnlade herunter, und sein Erscheinen versprach nichts Gutes. Er war etwa 30 Jahre alt, ca. 1,90 m groß, schlank und furchtbar arrogant. Wie sich herausstellte, besaß er das große Kapitänspatent und war schon zwei Jahre als 1.Offizier bei unserer Reederei gefahren. Er war ein richtiger Senkrechtstarter, der offenbar so schnell wie möglich Kapitän werden wollte. Sein Ehrgeiz war bei der ganzen Flotte bekannt, und wir alle bedauerten, dass unser bisheriger Erste von Bord ging. Der Abschied war entsprechend herzlich. Wie ich später hörte, wurde er nach einem halben Jahr Kapitän, was sich sehr negativ auf seinen Charakter ausgewirkt habe, denn er soll einer der unangenehmsten und unzulänglichsten Kapitäne der Reederei geworden und bis zu seiner Pensionierung geblieben sein.
Der neue Erste trat sehr schnell in Aktion. Natürlich fand er einen „Saustall“ vor, mit laxen Offizieren, womit er den Dritten und mich meinte, aber er wollte hier schon aufräumen und alles „auf Vordermann bringen“. Als ich ihm widersprach und äußerte, dass doch bisher alles an Bord gut gelaufen sei und von der Reederei und unserem Alten keine Klagen gekommen seien, wurde er fuchsteufelswild wie ein Choleriker und ich hatte von diesem Moment an keine guten Karten bei ihm. Überhaupt waren der 3.Offizier und ich wegen unseres niedrigen Patents und Ranges in seiner Wertschätzung ganz unten. Er grüßte uns kaum und wenn er mit uns sprach, dann nur mit schnarrender Stimme im Befehlston. Beim „Dritten“ war er wegen dessen Größe und Stärke ein wenig zurückhaltender, aber bei mir tat er sich keinen Zwang an. Am meisten ärgerte ihn wohl, dass ich sofort 2.Offizier geworden war, ohne wie üblich zunächst als „Dritter“ gefahren zu sein. Auch dass ich es wagte, ihm hin und wieder zu widersprechen. Wo immer er mich Kraft seines höheren Rangs schikanieren konnte, tat er es. Unser Alter, der ja nicht blind war, hielt sich aus allem heraus. Aber darüber später mehr. Da wir in Rotterdam über zwei Wochen zum Löschen liegen sollten, verordnete unser neuer 1.Offizier dem Dritten und mir gegen unseren Willen „freie Tage“. Nach einer Tarifregelung stand uns für jeden Sonntag auf See ein zusätzlicher freier Tag und für Sonnabende ein halber freier Tag zu. Diese freien Tage sollten im Heimat- oder jedenfalls in einem deutschen Hafen genommen werden. Kam das Schiff nicht nach Deutschland, sollten diese Tage als bezahlte Urlaubstage dem Tarifurlaub zugeschlagen werden. Man war also nicht verpflichtet, die freien Tage im Ausland zu nehmen. Die Reederei begrüßte es natürlich, wenn möglichst viele freie Tage während der Bordzeit abgegolten wurden und hatte entsprechend in einem Rundschreiben an die Freiwilligkeit der Besatzungen appelliert. Fast alle Kapitäne und 1.Offiziere tolerierten die „Freiwilligkeit“, die dieses Rundschreiben offen ließ, da man ja durch die zusätzlichen Tage seinen Urlaub verlängern und selber gestalten konnte. Nicht aber unser „Senkrechtstarter“! Mit barschen Worten verordnete er die freien Tage, ohne uns zu fragen. Für mich war das tolerierbar, denn ich war ledig und hatte keine familiären Verpflichtungen und konnte ein paar ruhige Tage in Rotterdam gut gebrauchen. Unser Dritter war als verheirateter Mann damit natürlich nicht einverstanden und nach einer sehr hitzigen Debatte in Gegenwart des Alten musste der Erste seine Anordnung zurücknehmen. Da konnte er vor Wut noch so schnauben, Tarif blieb Tarif.
Während meiner freien Tage sah ich zu, dass ich möglichst großen Abstand von unserem Schiff, dem Alten und dem neuen Senkrechtstarter gewann. Das Wetter war herrlich und ich genoss es, am Tage unbeschwert durch Rotterdam zu spazieren. Leider fand ich trotz mehrmaligem Suchen nicht meine erste große Liebe und Lehrmeisterin „Maisje“ wieder. Sie wohnte nicht mehr in ihrer großen Wohnung in der Nähe des Yachthafens, und auch ihre Nachbarn konnten mir nicht sagen, wohin sie verzogen war. Auch im Tanzcafé im Park neben der Parkkaade wusste niemand etwas von ihr. An den alten Kellner konnte sich ebenfalls keiner mehr erinnern. Vielleicht war ja „Maisje“ schon längst verheiratet und hatte bereits einen Haufen Kinder. Nun blieb auch sie für mich nur ein vergangener schöner Seemannstraum. Rotterdam ist keine sehr schöne Stadt, wie etwa Amsterdam, seit die Altstadt, der Kohlenzingel, während des 2. Weltkrieges von den Deutschen total zerstört worden war. Der neue Kohlenzingel bestand fast nur aus Betonbauten und hohen Geschäftshäusern. Am Abend traf ich mich mit dem Chief und dem 2.Ingenieur an Bord, und wir unternahmen zusammen einen Streifzug durch die vielen Familienlokale in der Nähe des Schiedam. Wir tranken Bier und Genever und als Seeleute hatten wir, obwohl wir Deutsche waren, mit den Holländern keine Probleme. Wir schlossen jedenfalls viele Freundschaften.
Da „grüne Heringszeit“ war, standen überall bis in die Nacht hinein kleine Verkaufswagen, die frische Matjes feilboten. Der Matjes wurde gleich auf der Straße nach einem bestimmten Ritual gegessen. Man fasste den Matjes mit Zeigefinger und Daumen am Schwanz, legte den Kopf wie beim Trinken in den Nacken und ließ den Matjes dabei langsam in den Mund gleiten, wobei man natürlich nicht das Kauen vergessen durfte. Es blieb danach nur das Schwanzende zwischen Daumen und Zeigefinger zurück. Ich habe nicht gezählt,
wie viele Matjes wir bei unseren abendlichen Streifzügen vertilgt haben, jedenfalls hatten wir anschließend immer einen sehr großen Durst, aber auch eine solide Unterlage für diesen Durst im Bauch. Am nächsten Morgen brauchte ich ja nicht so früh aufzustehen und wenn ich auf war, drückte ich mich ganz schnell von Bord.
Auch die schönsten freien Tage gehen einmal vorbei, und die raue Wirklichkeit hatte mich wieder. Es war, als ob unser neuer Erster nur auf mich gewartet hatte, denn kaum war ich an Deck, als er mich schon mit den unmöglichsten Dingen immer auf Trab hielt. Natürlich hatte er immer etwas an mir auszusetzen, bis es mir zuviel wurde und ich unsere Deckscrew bat, mir Zeichen zu geben, wenn der Erste im Anmarsch war. Näherte er sich dem Vordeck, verzog ich mich, so schnell ich konnte, auf das Achterdeck oder umgekehrt. So spielten wir den ganzen Tag Katz und Maus. Erwischte er mich einmal, war er vor Wut außer sich. Ich hatte aber immer Zeugen dafür, dass ich mich die ganze Zeit während des Löschens an Deck aufgehalten hatte. Gott sei Dank spielte die ganze Deckscrew mit, da sie den neuen Ersten ebenfalls nicht mochte, und er gab sich erst einmal geschlagen. Dass dies unser Verhältnis zueinander nicht verbesserte, versteht sich von selber, und so blieb unsere Beziehung eisig und gespannt.
Nach der Entlöschung bekamen wir Order, in Rotterdam und Bremen Stückgut für Lulea in Schweden zu laden. Wir verholten das Schiff in ein anderes Hafenbecken und da wir unter Zeitdruck gerieten, wurde sofort mit dem Laden begonnen. Es wurde eine Nachtschicht eingelegt, so dass wir nach 24 Stunden in Richtung Bremen ausliefen. Auch in Bremen wurde in drei Schichten geladen. Da ich als 2.Offizier bei der Nachtschicht die Ladeaufsicht hatte, der 1.Offizier aber Ladungsoffizier war, weckte ich ihn mehrmals in der Nacht wegen einiger sehr banaler Ladungsfragen. Das machte ihn sehr wütend, entschädigte mich aber etwas für seine Schikanen. Überraschend für uns kam noch Hamburg als Ladehafen hinzu. Da wir am Sonnabend spät in Hamburg einliefen, sollte erst am Sonntag früh mit dem Laden begonnen werden und das Schiff noch am Sonntag wieder auslaufen. Weil der verheiratete 3.Offizier seine Frau sehen wollte, übernahm ich als Junggeselle die Hafenwache. Dadurch hatte ich auch Gelegenheit, die Frau des Ersten kennen zu lernen. Sie war eine schlanke, sympathische „kühle Blonde“ Ende zwanzig mit einem kleinen Silberblick. Gegensätze ziehen sich bekanntlich an.
Bei der Gelegenheit lernte ich auch unseren neuen 1.Steward näher kennen, den besagten „Leibsteward“ des Alten, der in Rotterdam an Bord gekommen war. Er war schon ein merkwürdiger Bursche: Mittelgroß, blond, blauäugig und ca. 32 Jahre alt. Mit 18 Jahren hatte er sich noch am Ende des 2.Weltkrieges zur Waffen-SS gemeldet und davon war einiges an ihm hängen geblieben. Wenn er an Land ging, trug er immer dunkle Breecheshosen und hohe schwarze Schaftstiefel wie ein Rittmeister. Er antwortete unserem Alten stets mit einem zackigen „Jawoll, Herr Kapitän“, was dem Alten wie Honig herunterging. Wenn unser Alter morgens die Tür aufschlug, stand sein „Bursche“ schon draußen bereit. Der Alte hatte ihn vor Jahren irgendwo aufgelesen und bei der Reederei untergebracht, und seitdem war er sein „Leibsteward“. Er rauchte und trank nicht und war seit kurzem verheiratet. Seine Frau war gut zehn Jahre älter und hatte einen 10jährigen Sohn mit in die Ehe gebracht. Sie war etwas rundlich und verkörperte so ganz den treu-deutschen mütterlichen Typ, wie man ihn in alten Propagandafilmen über die „Deutsche Familie“ sah. Politisch war die Zeit für ihn so bei ca. 1944 stehen geblieben, als Hamburg noch einen Gauleiter hatte und man in ganz Deutschland nachts die Fenster verdunkelte. Dunkel waren auch seine politischen Ansichten, und man unterhielt sich mit ihm besser über das Wetter oder andere Belanglosigkeiten.
Am Montag, einige Stunden vor dem Auslaufen, bekamen wir als eines der letzten Schiffe der Reederei ein UKW-Telephon auf der Brücke installiert, was für uns eine große Hilfe bedeutete. Mussten wir vorher beim Einlaufen den Lotsen am Tage mit der Signalflagge „G“ und nachts mit der Morselampe durch das Signal G (--.) anfordern, konnten wir jetzt mit dem UKW-Gerät schon 25 Seemeilen vorher mit ihm Kontakt aufnehmen. In Küstennähe war nun auch generell das Telefonieren zum Land hin problemlos möglich. Nach dem Auslaufen probierte unser Alter gleich auf der Elbe das neue UKW-Gerät aus und telefonierte über „Radio Hamburg“ mit seiner Frau. Auch der Hund durfte am Telefon der Stimme seines „Frauchen“ lauschen. Zum Schluss hielt der Alte den Hörer vor Rhinos Schnauze und kniff ihm kräftig ins Hinterteil, bis er aufjaulte. „Hast du Rhino gehört?“, röhrte er ins Telefon, „er ist ganz traurig, dass er „Frauchen“ nicht mehr sieht, er hat soeben sogar geweint.“
Nach ca. vier Stunden erreichten wir die Schleuse Brunsbüttel und befanden uns nach einer Stunde Aufenthalt im Nord-Ostsee-Kanal. Außer dem Kanallotsen befanden sich auch zwei Kanalsteuerer an Bord, die sich beim Steuern bis Kiel jede Stunde ablösten. Da unser Alter in den vergangenen Jahren fast nur in der Nord- und Ostsee gefahren hatte, kannten ihn die meisten Kanallotsen und Steuerer. Auf meiner Wache hörte ich während der Kanal-Passage, während sich der Alte nicht auf der Brücke befand, die unglaublichsten Geschichten über „Rucksack-Willi“ und seinen Hund. Eine davon wurde überall auf dem Kanal und auf der Elbe erzählt. „Rucksack-Willi“ kam mit seinem Schiff von Hamburg und war in Richtung Nordsee unterwegs. Kurz nach dem Lotsenwechsel in Brunsbüttel schwärmte er dem neuen Seelotsen von Rhinos ellenlangem Stammbaum vor und wie klug und gelehrig sein Hund sei. Der Hund, der sich mit auf der Brücke befand, verfolgte mit gespitzten Ohren aufmerksam das Gespräch.
Der Lotse, wahrscheinlich eher ein Katzenfreund, zeigte sehr wenig Interesse an Rhinos Vorzügen, so dass der Alte ihn fragte, ob er denn Hunde möge. Der Lotse soll mit den Achseln gezuckt und geantwortet haben: „Eigentlich nicht besonders.“ Kaum hatte er dies ausgesprochen, sprang Rhino ihn von hinten an und biss ihm kräftig ins Hinterteil. Der Lotse, außer sich, verlangte sofort ärztliche Behandlung, und der Alte musste das Schiff umdrehen und vor Brunsbüttel vor Anker gehen. Nun ging alles seinen behördlichen Gang, und die Wasserschutzpolizei kam mit dem Veterinär und einem Arzt an Bord. Während die Polizei den Tatbestand aufnahm, untersuchte der eine den Hund auf Tollwut und der andere den Lotsen auf seine Verletzungen. Nachdem der Lotse zur Sicherheit eine Spritze gegen Tollwut bekommen hatte und ein neuer Lotse an Bord war, konnte der Alte seine Reise fortsetzen. Da dies alles mit enormen Kosten und Verzögerungen verbunden war, war die Reederei über den Vorfall nicht sonderlich erfreut, und der Alte soll einige Tag mit hängenden Ohren herumgelaufen sein. Vielleicht hätte der Lotse sich besser positiver über Hunde äußern sollen!
Nachdem wir den Seelotsen bei Feuerschiff Kiel abgegeben hatten, gingen wir wieder selbständig unsere Seewachen. Unser Erster, der mich ja immer morgens um 4 Uhr und nachmittags um 16 Uhr ablöste, hatte sich für mich ein neues „Spielchen“ ausgedacht. Immer wenn ich mich nach meiner Wache um 4 Uhr zum Schlafen hingelegt hatte, ließ er mich nach einer halben Stunde wecken und auf die Brücke kommen. Er hatte entweder an meiner Schreibweise in der Seekarte etwas auszusetzen (die Uhrzeit an der Position soll quer zur Kurslinie geschrieben sein) oder er fand die Anschlusskarte nicht. Auch Zigarettenkippen in der Brückennock waren ein Grund mich zu wecken. Ich war natürlich sehr erbost darüber, konnte aber nicht viel ausrichten, denn er war immerhin der Erste an Bord und der Alte hielt sich heraus.
Im Gegenzug spitzte ich vor Wachende immer den einzigen Bleistift am Kartentisch (damals wurde noch richtig gespart und einen neuen Bleistift gab es nur, wenn der alte aufgebraucht war) scharf an und lockerte dann anschließend die Mine kurz bevor ich die Brücke verließ. Ich amüsierte mich dann köstlich darüber, wenn ich anschließend hörte, dass die Mine abbrach, wenn der Erste etwas in die Seekarte eintragen wollte. Er fluchte dann immer furchtbar und musste den Bleistiftanspitzer einige Zeit suchen, weil ich jenen so deponiert hatte, dass er ihn nicht gleich finden konnte, er aber trotzdem vor seiner Nase lag. Meistens versteckte ich ihn unter dem äußersten Ende der Seekarte, unter dem Logbuch oder legte ihn auf den Boden direkt neben dem Kartentisch. Es war die „Rache des kleinen Mannes“.
Unseren Ersten mochte niemand an Bord recht leiden, von der Deckscrew, dem Steward und dem Koch ganz zu schweigen, denen er die Überstunden kürzte, wie er nur konnte. Diese Überstunden brachten aber gerade das Geld, denn die Grundheuer war minimal, und mit ihr allein konnte man keine großen Sprünge machen. Aber unser „Senkrechtstarter“ wollte eben schnell Kapitän werden und der Reederei zeigen, wie ökonomisch es bei ihm an Bord zuging. Mit der normalen Arbeitszeit konnte man aber auf die Dauer ein Schiff nicht instand halten und sich um 10 oder 20 Minuten zu streiten, tat der Motivation an Bord nicht gut. Der Koch stand z.B. schon um 5.45 Uhr in seiner Kombüse, auch wenn seine offizielle Arbeitszeit erst um 6 Uhr anfing. Der Grund war der alte Kohleherd. Bei regnerischem oder stürmischem Wetter war es schwer, ein Feuer in Gang zu bringen und auch in Gang zu halten. Während meiner Moseszeit hatte ich selbst ein Lied davon singen können. Die Mahlzeiten mussten aber rechtzeitig auf dem Tisch sein, und es kam uns manchmal wie ein Wunder vor, wie unser Koch das immer alles schaffte. Wenn man sich vorstellt, dass er ganz alleine ohne jegliche Hilfe für über zwanzig Leute die Mahlzeiten vorbereiten und kochen musste, war dies eine enorme Leistung, die eine hohe Motivation voraussetzte. Sich da um einige Minuten zu streiten und auf der normalen Arbeitszeit zu beharren, war von unserem Ersten sehr kurzsichtig und unklug, zumal von der Reederei niemals Einwände gekommen waren. So herrschte jetzt an Bord ein noch wesentlich schlechteres Klima, als zu der Zeit, da nur die Spielchen des Alten für Verunsicherung sorgten.
Nach dreieinhalb Tagen erreichten wir Lulea an der Ostküste Schwedens im hohen Norden des Bottnischen Meerbusens. In Lulea, unserm Löschhafen, der zur Winterzeit nur mit Eisbrecherhilfe angelaufen werden konnte, herrschten jetzt im Juli hochsommerliche Temperaturen von über 30 Grad. Da wir in unseren Kammern keine Ventilatoren hatten, litten wir sehr unter der Hitze. Das Klima zwischen dem 1.Offizier und mir hatte jedoch einen Tiefpunkt erreicht, so dass wir jetzt anfingen, uns an Deck anzuschreien und der Alte uns mehrmals in seine Kammer rief und versuchte, unserem Streit zu schlichten. Unsere gegenseitige Abneigung war jedoch schon so groß, dass ich beschloss, bei der nächsten besten Gelegenheit das Schiff zu verlassen. Diese Gelegenheit bot sich in Kemi, unserem nächsten Ladehafen, der einige Seemeilen nördlich von Lulea in Finnland lag. Wir luden dort Zelluloseballen und große Papierrollen für England. Als ich während des Ladens im Laderaum eine Partie Papierrollen mit Kreide markierte, wurde ich von einer Hieve leicht berührt und mit dem Kopf gegen die Laderaumwand gestoßen, wobei ich mir eine große Beule am Kopf zuzog. Ich klagte über große Kopfschmerzen und wurde zum Arzt gefahren, dem ich erzählte, mir sei immer übel und ich müsse mich übergeben. Vom Erste-Hilfe-Unterricht in der Seefahrtschule wusste ich, dass das die typischen Anzeichen für eine Gehirnerschütterung sind. Der Arzt schrieb mich sofort dienstunfähig und wollte mich ins städtische Krankenhaus einweisen. Ich konnte ihn schließlich überzeugen, dass ich an Bord mit Bettruhe auch gut aufgehoben sei. Da unser Schiff noch am selben Tage auslaufen sollte, vereinbarte ich mit dem Alten, dass ich bis zur Schleuse Kiel-Holtenau meine Seewache gehen, in der Schleuse aber das Schiff wegen Krankheit verlassen sollte. Da er selber keine Lust hatte, meine Wache zu übernehmen und die andern beiden Nautiker nicht mit zusätzlichen Wachen überlasten wollte, zeigte er sich sofort mit meinem Vorschlag einverstanden. Unser Erster benahm sich sehr manierlich, und es waren die ruhigsten Seewachen, die ich auf diesem Schiff ging.
In der Schleuse stand schon mein Ablöser bereit. Der neue Zweite war ein langjähriger Reedereifahrer, hatte aber wie der Dritte nur ein „Küstenschifferpatent“ mit einer Sondergenehmigung für Schiffe dieser Größe. Ich verabschiedete mich von meinen beiden Freunden, dem Chief und dem 2.Ingenieur, die, wie die übrige Crew, mein Ausscheiden sehr bedauerten, ebenfalls von unserem Alten, dem „Rucksack-Willy“, der mir trotz seiner Macken ein guter Vorgesetzter gewesen war. Auch sein Rhino, diese arme neurotische Kreatur, war mir irgendwie ans Herz gewachsen. Danach verließ ich das Schiff, welches für mich der Beginn einer neuen Laufbahn gewesen war. Um der Zeit vorauszueilen: Unser „Senkrechtstarter“ wurde sehr bald Kapitän und später ein recht guter Elblotse. Als 1.Offizier besuchte er mich ein Jahr später zusammen mit seiner Frau an Bord, als sein Schiff mit meinem Reedereischiff in Hamburg nebeneinander lagen, was mich mit ihm versöhnte. Vielleicht waren wir auch damals während der gemeinsamen Fahrzeit zwei zu gegensätzliche Charaktere gewesen, um verträglich miteinander auskommen zu können.
Lesen Sie im Buch weiter!
Fortsetzung
Schiffsbilder bei goole
Seefahrtserinnerungen - Seefahrtserinnerungen - Maritimbuch
Informationen zu den maritimen Büchern des Webmasters finden Sie hier:
zur gelben Zeitzeugen-Bücher-Reihe des Webmasters:
© Jürgen Ruszkowski

zur gelben Zeitzeugen-Bücher-Reihe des Webmasters:
© Jürgen Ruszkowski
Maritime books in German language: fates of international sailors
Los libros marítimos en el idioma alemán: los destinos de marineros internacionales:
zu meiner maritimen Bücher-Seite
navigare necesse est!
Maritime books in German language: fates of international sailors
Los libros marítimos en el idioma alemán: los destinos de marineros internacionales:
Diese Bücher können Sie direkt bei mir gegen Rechnung bestellen: Kontakt:
Zahlung nach Erhalt der der Ware per Überweisung.
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
Zahlung nach Erhalt der der Ware per Überweisung.
Bücher in der gelben Buchreihe" Zeitzeugen des Alltags" von Jürgen Ruszkowski:
|
Seemannsschicksale
Band 1 - Band 1 - Band 1 - Band 1
Begegnungen im Seemannsheim
ca. 60 Lebensläufe und Erlebnisberichte
von Fahrensleuten aus aller Welt

http://www.libreka.de/9783000230301/FC
libreka.de: unter Ruszkowski suchen!
13,90 € - Bestellung -
|
Seemannsschicksale
Band 2 - Band 2
Lebensläufe und Erlebnisberichte

Lebensläufe und Erlebnisberichte von Fahrensleuten, als Rentner-Hobby aufgezeichnet bzw. gesammelt und herausgegeben von Jürgen Ruszkowski
http://www.libreka.de/9783000220470/FC
libreka.de: unter Ruszkowski suchen!
13,90 € - Bestellungen -
|
Seemannsschicksale
Band_3
Lebensläufe und Erlebnisberichte

Lebensläufe und Erlebnisberichte von Fahrensleuten
http://www.libreka.de/9783000235740/FC
libreka.de: unter Ruszkowski suchen!
13,90 € - Bestellungen -
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
|
|
Edition 2004 - Band 4
Seemannsschicksale unter Segeln

Die Seefahrt unserer Urgroßväter
im 19. Jahrhundert und am Anfang des 20. Jahrhunderts
13,90 €
- Bestellungen -
|
Band 5
Capt. E. Feith's Memoiren:

Ein Leben auf See
amüsant und spannend wird über das Leben an Bord vom Moses bis zum Matrosen vor dem Mast in den 1950/60er Jahren, als Nautiker hinter dem Mast in den 1970/90er Jahren berichtet
http://www.libreka.de/9783000214929/FC
libreka.de: unter Ruszkowski suchen!
13,90 € - Bestellungen -
|
Band 6 ist geplant
Leseproben und Bücher online
Seemannsschicksale
maritimbuch
Schiffsbild - Schiffsbild
Schiffsbild
erwähnte Personen
- erwähnte Schiffe -
erwähnte Schiffe E - J
erwähnte Schiffe S-Z
|
|
Band 7
in der Reihe Seemannsschicksale:
Dirk Dietrich:
Auf See
ISBN 3-9808105-4-2
Dietrich's Verlag
Band 7
Bestellungen
Band 8:
Maritta & Peter Noak
auf Schiffen der DSR
ISBN 3-937413-04-9
Dietrich's Verlag
Bestellungen
|
Band 9
Die abenteuerliche Karriere eines einfachen Seemannes
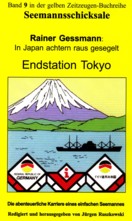
Endstation Tokyo
12 € - Bestellungen
|
Band 10 - Band 10
Autobiographie des Webmasters
Himmelslotse
Rückblicke: 27 Jahre Himmelslotse im Seemannsheim - ganz persönliche Erinnerungen an das Werden und Wirken eines Diakons

13,90 € - Bestellungen -
|
|
- Band 11 -
Genossen der Barmherzigkeit

Diakone des Rauhen Hauses
Diakonenportraits
13,90 € - Bestellungen -
|
Band 12 - Band 12
Autobiographie:
Diakon Karlheinz Franke

12 € - Bestellungen -
|
Band 13 - Band 13

Autobiographie:
Diakon Hugo Wietholz
13,90 € - Bestellungen -
|
|
Band 14
Conrad H. v. Sengbusch

Jahrgang '36
Werft, Schiffe, Seeleute, Funkbuden
Jugend in den "goldenen 1959er Jahren"

Lehre als Schiffselektriker in Cuxhaven
13,90 € - Bestellungen -
|
Band 15
Wir zahlten für Hitlers Hybris
mit Zeitzeugenberichten aus 1945 über Bombenkrieg, Flucht, Vertreibung, Zwangsarbeit und Gefangenschaft

Ixlibris-Rezension
http://www.libreka.de/9783000234385/FC
libreka.de: unter Ruszkowski suchen!
13,90 € - Bestellungen -
|
Band 16
Lothar Stephan
Ein bewegtes Leben - in den Diensten der DDR - - zuletzt als Oberst der NVA
ISBN 3-9808105-8-5
Dietrich's Verlag
Bestellungen
Schiffsbild
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
|
|
Band 17
Als Schiffskoch weltweit unterwegs


Schiffskoch Ernst Richter
http://www.libreka.de/9783000224713/FC
13,90 € - Bestellungen -
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seit
|
Band 18
Seemannsschicksale
aus Emden und Ostfriesland

und Fortsetzung Schiffskoch Ernst Richter auf Schleppern

http://www.libreka.de/9783000230141/FC
libreka.de: unter Ruszkowski suchen!
13,90 € - Bestellungen -
|
Band 19
ein Seemannsschicksal:
Uwe Heins

Das bunte Leben eines einfachen Seemanns
13,90 € - Bestellungen -
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
|
|
Band 20
ein Seemannsschicksal im 2. Weltkrieg

Kurt Krüger
Matrose im 2. Weltkrieg
Soldat an der Front
- Bestellungen -
|
Band 21
Ein Seemannsschicksal:
Gregor Schock

Der harte Weg zum Schiffsingenieur
Beginn als Reiniger auf SS "RIO MACAREO"
13,90 € - Bestellungen -
|
Band 22
Weltweite Reisen eines früheren Seemanns als Passagier auf Fähren,
Frachtschiffen
und Oldtimern
Anregungen und Tipps für maritime Reisefans

- Bestellungen -
|
|
Band 23
Ein Seemannsschicksal:
Jochen Müller

Geschichten aus der Backskiste
Ein ehemaliger DSR-Seemann erinnert sich
12 € - Bestellungen -
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
|
Band 24
Ein Seemannsschicksal:
Der maritime Liedermacher
Mario Covi: -1-
Traumtripps und Rattendampfer

Ein Schiffsfunker erzählt
über das Leben auf See und im Hafen
http://www.libreka.de/9783000221460/FC
libreka.de: unter Ruszkowski suchen!
13,90 € - Bestellungen -
|
Band 25
Ein Seemannsschicksal:
Der maritime Liedermacher
Mario Covi: -2-
Landgangsfieber und grobe See

Ein Schiffsfunker erzählt
über das Leben auf See und im Hafen
http://www.libreka.de/9783000223624/FC
libreka.de: unter Ruszkowski suchen!
13,90 € - Bestellungen -
|
|
Band 26
Monica Maria Mieck:


Liebe findet immer einen Weg
Mutmachgeschichten für heute
Besinnliche Kurzgeschichten
auch zum Vorlesen
- Bestellungen -
|
- Band 27 -
Monica Maria Mieck


Verschenke kleine
Sonnenstrahlen
Heitere und besinnliche Kurzgeschichten
auch zum Vorlesen
- Bestellungen -
|
- Band 28 -
Monica Maria Mieck:


Durch alle Nebel hindurch
erweiterte Neuauflage
Texte der Hoffnung
besinnliche Kurzgeschichten und lyrische Texte
ISBN 978-3-00-019762-8
- Bestellungen -
|
|
Band 29

Logbuch
einer Ausbildungsreise
und andere
Seemannsschicksale
Seefahrerportraits
und Erlebnisberichte
ISBN 978-3-00-019471-9
http://www.libreka.de/9783000194719/FC
13,90 € - Bestellungen -
|
Band 30
Günter Elsässer

Schiffe, Häfen, Mädchen
Seefahrt vor 50 Jahren
http://www.libreka.de/9783000211539/FC
- Bestellungen -
13,90 €
- Bestellungen -
|
Band 31
Thomas Illés d.Ä.
Sonne, Brot und Wein

ANEKIs lange Reise zur Schönheit
Wohnsitz Segelboot
Reise ohne Kofferschleppen
Fortsetzung in Band 32
13,90 €
- Bestellungen -
|
|
Band 32
Thomas Illés d.Ä.
Sonne, Brot und Wein
Teil 2

Reise ohne Kofferschleppen
Fortsetzung von Band 31 - Band 31
13,90 € - Bestellungen -
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
|
Band 33
Jörn Hinrich Laue:
Die große Hafenrundfahrt in Hamburg
reich bebildert mit vielen Informationen auch über die Speicherstadt, maritime Museen und Museumsschiffe

184 Seiten mit vielen Fotos, Schiffsrissen, Daten
ISBN 978-3-00-022046-3
http://www.libreka.de/9783000220463/FC
- Bestellungen -
|
Band 34
Peter Bening
Nimm ihm die Blumen mit

Roman einer Seemannsliebe
mit autobiographischem Hintergrund
http://www.libreka.de/9783000231209/FC
- Bestellungen -
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
|
|
Band 35
Günter George

Junge, komm bald wieder...
Ein Junge aus der Seestadt Bremerhaven träumt von der großen weiten Welt
http://www.libreka.de/9783000226441/FC
13,90 € - Bestellungen -
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
|
Band 36
Rolf Geurink:

In den 1960er Jahren als
seemaschinist
weltweit unterwegs
http://www.libreka.de/9783000243004/FC
13,90 €
- Bestellungen -
libreka.de: unter Ruszkowski suchen!
meine google-Bildgalerien
realhomepage/seamanstory
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
|
Band 37
Schiffsfunker Hans Patschke:


Frequenzwechsel
Ein Leben in Krieg und Frieden als Funker auf See
auf Bergungsschiffen und in Großer Linienfahrt im 20. Jahrhundert
http://www.libreka.de/9783000257766/FC
13,90 € - Bestellungen -
|
|
Band 38 - Band 38
Monica Maria Mieck:

Zauber der Erinnerung
heitere und besinnliche Kurzgeschichten
und lyrische Texte
reich sw bebildert
12 € - Bestellungen -
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
|
Band 39
Hein Bruns:


In Bilgen, Bars und Betten
Roman eines Seefahrers aus den 1960er Jahren
in dieser gelben maritimen Reihe neu aufgelegt
kartoniert
Preis: 13,90 €
Bestellungen
|
Band 40
Heinz Rehn:


von Klütenewern und Kanalsteurern
Hoch- und plattdeutsche maritime Texte
Neuauflage
13,90 € - Bestellungen -
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
|
|
Band 41
Klaus Perschke - 1 -
Vor dem Mast
1951 - 1956
nach Skandinavien und Afrika

Ein Nautiker erzählt vom Beginn seiner Seefahrt
Preis: 13,90 € - Bestellungen
|
Band 42
Klaus Perschke - 2 -
Seefahrt 1956-58

Asienreisen vor dem Mast - Seefahrtschule Bremerhaven - Nautischer Wachoffizier - Reisen in die Karibik und nach Afrika
Ein Nautiker erzählt von seiner Seefahrt
Fortsetzung des Bandes 41
13,90 € - Bestellungen
|
Band 43
Monica Maria Mieck:

Winterwunder

weihnachtliche Kurzgeschichten
und lyrische Texte
reich sw bebildert
10 € - Bestellungen -
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
|
|
Band 44
Lothar Rüdiger:

Flarrow, der Chief 1
Ein Schiffsingenieur erzählt
Maschinen-Assi auf DDR-Logger und Ing-Assi auf MS BERLIN
13,90 € - Bestellungen
Band 47
Seefahrtserinnerungen

Ehemalige Seeleute erzählen
13,90 € - Bestellungen
Band 50
Jürgen Coprian:
Salzwasserfahrten 2
Trampfahrt worldwide
mit
FRIEDERIKE TEN DOORNKAAT

- - -
Band 53:
Jürgen Coprian:
MS COBURG

Salzwasserfahrten 5
weitere Bände sind geplant
13,90 € - Bestellungen
|
Band 45
Lothar Rüdiger:

Flarrow, der Chief 2
Ein Schiffsingenieur erzählt
Fortsetzung des Bandes 44
Flarrow als Wachingenieur
13,90 € - Bestellungen
Band 48:
Peter Sternke:
Erinnerungen eines Nautikers

13,90 € - Bestellungen
Band 51
Jürgen Coprian:
Salzwasserfahrten 3

- - -
Jürgen Coprian:
Salzwasserfahrten 6
weitere Bände sind geplant
alle Bücher ansehen!
hier könnte Ihr Buch stehen
13,90 € - Bestellungen
|
Band 46
Lothar Rüdiger:

Flarrow, der Chief 3
Ein Schiffsingenieur erzählt
Fortsetzung des Bandes 44 + 45
Flarrow als Chief
13,90 € - Bestellungen
Band 49:
Jürgen Coprian:
Salzwasserfahrten 1

Ostasienreisen mit der Hapag
13,90 € - Bestellungen
- - -
Band 52 - Band 52
Jürgen Coprian:
Salzwasserfahrten 4
MS "VIRGILIA"
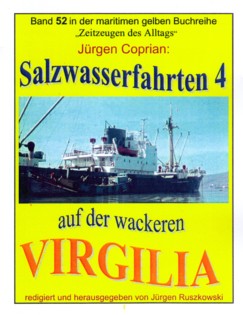
---
Band 56
Immanuel Hülsen
Schiffsingenieur, Bergungstaucher

Leserreaktionen
- - -
Band 57
Harald Kittner:

zeitgeschichtlicher Roman-Thriller
- - -
Band 58

Seefahrt um 1960
unter dem Hanseatenkreuz
weitere Bände sind in Arbeit!
|
Diese Bücher können Sie für direkt bei mir gegen Rechnung bestellen: Kontakt:
Zahlung nach Erhalt der der Ware per Überweisung.
|
Meine Postadresse / my adress / Los orden-dirección y la información extensa:
Jürgen Ruszkowski, Nagelshof 25,
D-22559 Hamburg-Rissen,
Telefon: 040-18 09 09 48 - Anrufbeantworter nach 30 Sekunden -
Fax: 040 - 18 09 09 54
Bestellungen am einfachsten unter Angabe Ihrer Anschrift per e-mail: Kontakt
|

|
Bücher in der gelben Buchreihe" Zeitzeugen des Alltags" von Jürgen Ruszkowski:
Wenn Sie an dem Thema "Seeleute" interessiert sind, gönnen Sie sich die Lektüre dieser Bücher und bestellen per Telefon, Fax oder am besten per e-mail: Kontakt:
Meine Bücher der gelben Buchreihe "Zeitzeugen des Alltags" über Seeleute und Diakone sind über den Buchhandel oder besser direkt bei mir als dem Herausgeber zu beziehen, bei mir in Deutschland portofrei (Auslandsporto: ab 3,00 € )
Bestellungen am einfachsten unter Angabe Ihrer Anschrift per e-mail: Kontakt
Sie zahlen nach Erhalt der Bücher per Überweisung.
Maritime books in German language: fates of international sailors
Los libros marítimos en el idioma alemán: los destinos de marineros internacionales:
Los libros en el idioma alemán lo enlatan también, ( + el extranjero-estampilla: 2,70 €), directamente con la editor Buy de.
Bestellungen und Nachfragen am einfachsten über e-mail: Kontakt
Wenn ich nicht verreist bin, sehe ich jeden Tag in den email-Briefkasten. Dann Lieferung innerhalb von 3 Werktagen.
Ab und an werde ich für zwei bis drei Wochen verreist und dann, wenn überhaupt, nur per eMail: Kontakt via InternetCafé erreichbar sein!
Einige maritime Buchhandlungen in Hamburg in Hafennähe haben die Titel auch vorrätig:
HanseNautic GmbH, Schifffahrtsbuchhandlung, ex Eckardt & Messtorff, Herrengraben 31, 20459 Hamburg, Tel.: 040-374842-0 www.HanseNautic.de
WEDE-Fachbuchhandlung, Hansepassage, Große Bleichen 36, Tel.: 040-343240
Schifffahrtsbuchhandlung Wolfgang Fuchs, Rödingsmarkt 29, 20459 Hamburg, Tel: 3193542, www.hafenfuchs.de
Ansonsten, auch über ISDN über Buchhandlungen, in der Regel nur über mich bestellbar.
Für einen Eintrag in mein Gästebuch bin ich immer dankbar.
Alle meine Seiten haben ein gemeinsames Gästebuch. Daher bitte bei Kommentaren Bezug zum Thema der jeweiligen Seite nehmen!
Please register in my guestbook
Una entrada en el libro de mis visitantes yo agradezco siempre.
Za wpis do mej ksiegi gosci zawsze serdecznie dziekuje.
erwähnte Personen
Leseproben und Bücher online

meine websites bei freenet-homepage.de/seamanstory liefen leider Ende März 2010 aus! Weiterleitung!
Diese website existiert seit dem 26.12.2010 - last update - Letzte Änderung 16.02.2012
Jürgen Ruszkowski © Jürgen Ruszkowski © Jürgen Ruszkowski
|

